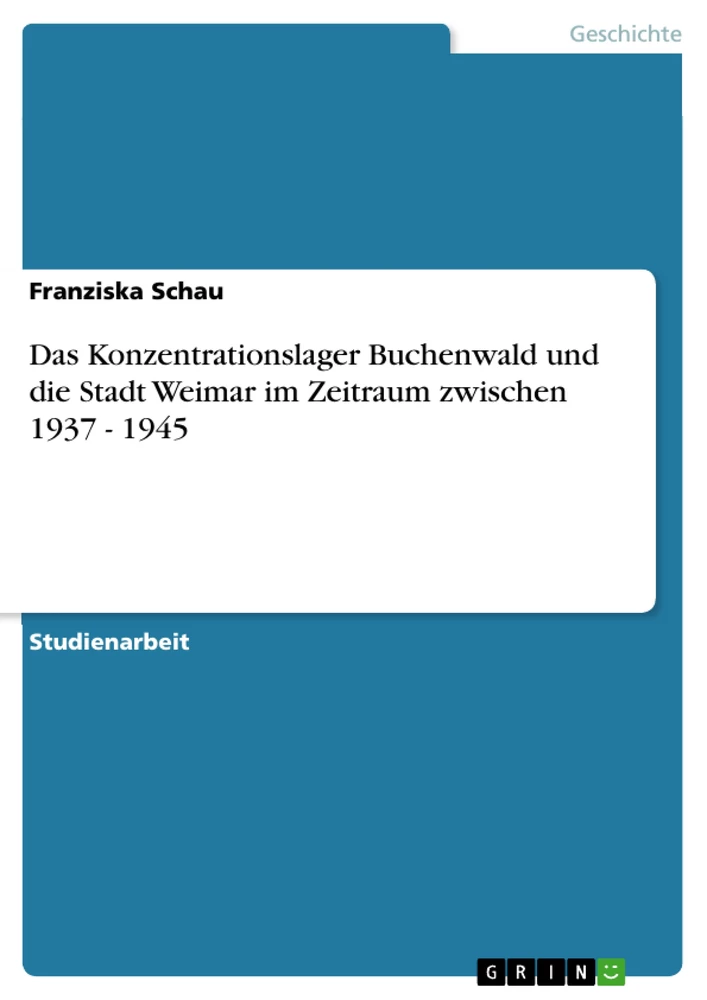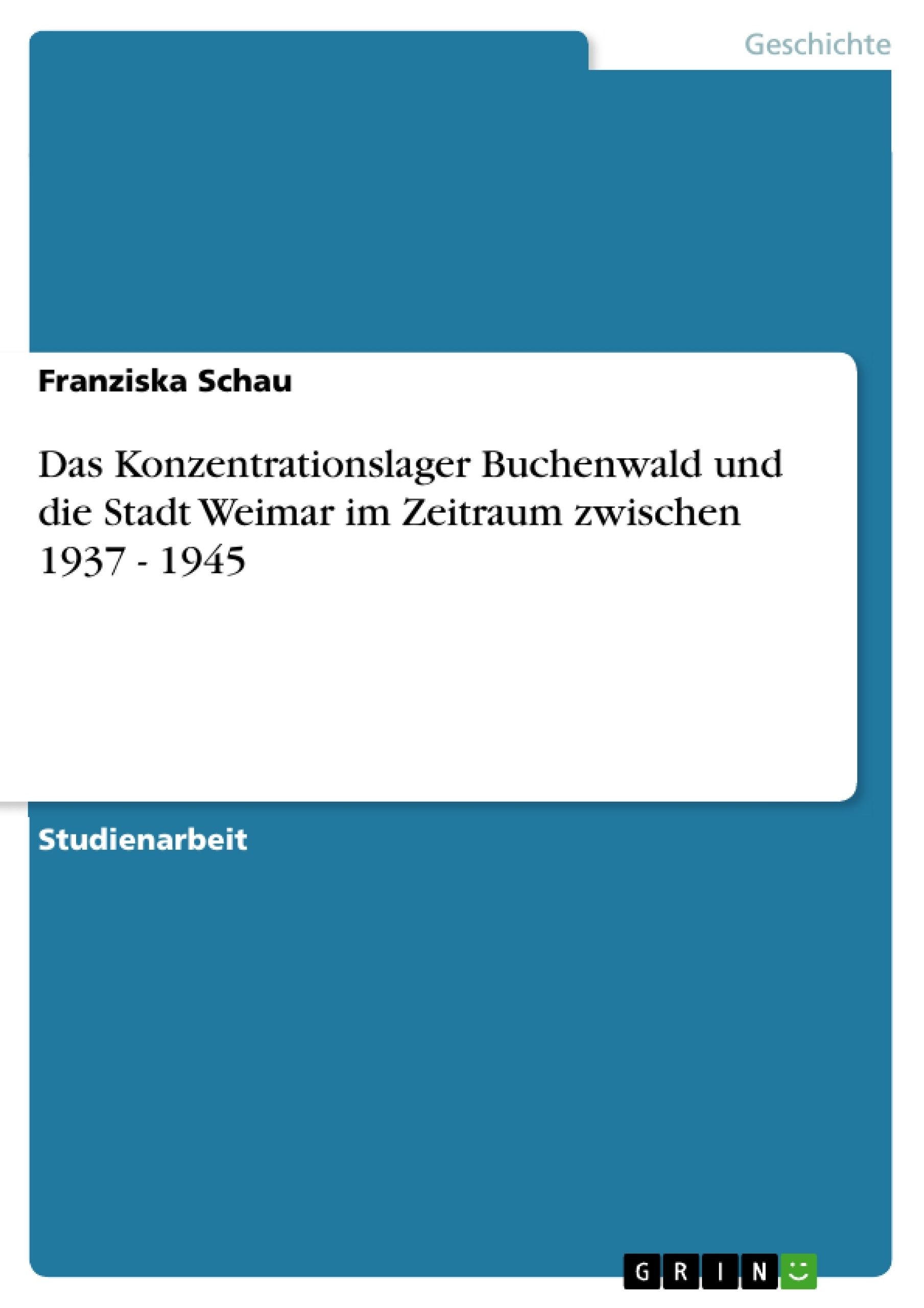Weimar gilt heute als Kulturstadt Thüringens sowie Deutschlands. Die Stadt wird in Verbindung mit Goethe und Schiller betrachtet, sie gilt als „Stadt der Dichter und Denker“. Allerdings wird sie ebenso mit grausigen Verbrechen verbunden, welche auf dem Ettersberg, innerhalb des Konzentrationslager Buchenwald, stattfanden. Heute ist das ehemalige Konzentrationslager eine Gedenkstätte, welche besichtigt werden kann und ein ständiges Mahnmal darstellt.
Innerhalb dieser Arbeit „Das Konzentrationslager Buchenwald und die Stadt Weimar“ möchte ich darstellen, wie sich das Konzentrationslager in die Infrastruktur seiner Umwelt einbettet, wie sich Stadt und Lager gegenseitig durchdringen und wie das Lager innerhalb der Gesellschaft akzeptiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Geschichte Weimars zwischen 1920 und 1937
- 2.1 1937: Der Bau des Konzentrationslagers Buchenwald
- 3 Beziehungen zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald
- 3.1 Der wirtschaftliche Sektor
- 3.2 Handelsbeziehungen zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald zwischen 1937 und 1945. Das Hauptziel ist es, aufzuzeigen, wie sich das Lager in die städtische Infrastruktur integrierte, wie Stadt und Lager sich gegenseitig beeinflussten und wie das Lager von der Weimarer Gesellschaft wahrgenommen und akzeptiert wurde.
- Die politische Entwicklung Weimars in den Jahren vor der Errichtung des Konzentrationslagers.
- Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Weimar und Buchenwald.
- Die Rolle der Weimarer Bevölkerung gegenüber dem Lager.
- Die Handelsbeziehungen zwischen Weimarer Unternehmen und dem Konzentrationslager.
- Die Integration des Lagers in den Alltag der Stadt.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Beziehung zwischen Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald in den Mittelpunkt. Sie betont den Gegensatz zwischen Weimars Image als Kulturstadt und der grausamen Realität des Lagers auf dem Ettersberg. Die Arbeit soll untersuchen, wie sich das Lager in die Infrastruktur der Stadt einbettete und wie es von der Gesellschaft akzeptiert wurde.
2 Die Geschichte Weimars zwischen 1920 und 1937: Dieses Kapitel beschreibt die politische Entwicklung Weimars in den 1920er und frühen 1930er Jahren. Es zeigt die Entstehung nationalistischer und völkischer Gruppen, aber auch die Bedeutung Weimars als Zentrum für Intellektuelle. Die zunehmende Akzeptanz nationalsozialistischer Ideologien und die reibungslose „Gleichschaltung“ der Stadt werden dargestellt. Der Bau des Konzentrationslagers Buchenwald im Jahr 1937 wird als Höhepunkt dieses Prozesses beschrieben, wobei der einzige nennenswerte Widerstand gegen die Lagererrichtung aus dem Kontext des Goethe-Kultes resultierte – der Name „Ettersberg“ wurde abgelehnt, da er mit Goethe assoziiert wurde.
3 Beziehungen zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Beziehungen zwischen Weimar und Buchenwald, unterteilt in wirtschaftliche und Handelsbeziehungen. Es wird detailliert beschrieben, wie Weimarer Firmen wirtschaftlich vom Einsatz von Häftlingen profitierten und wie die Stadt das Lager mit Waren belieferte. Trotz der grausamen Bedingungen im Lager gab es, zwar zögerlich, eine zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit Weimars von Buchenwald, die durch den Einsatz von Häftlingsarbeit und den Warenverkehr entstand. Es wird gezeigt, wie sich die gegenseitige Durchdringung von Stadt und Lager im wirtschaftlichen Bereich besonders stark manifestierte und dass auch soziale Kontakte zwischen Weimarer Bürgern und Häftlingen entstanden, vor allem durch die gemeinsame Arbeit, obwohl Berührungsängste anfänglich bestanden. Im weiteren Verlauf des Krieges, vor allem nach den Bombenangriffen auf Weimar, wurden die Häftlinge verstärkt für Aufräumungsarbeiten eingesetzt, und sie wurden so Teil des alltäglichen Bildes der Stadt.
Schlüsselwörter
Konzentrationslager Buchenwald, Weimar, Nationalsozialismus, Gleichschaltung, Wirtschaft, Häftlingsarbeit, Handelsbeziehungen, Stadt-Lager-Beziehung, Gesellschaftliche Akzeptanz, Zwangsarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Beziehung zwischen Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die komplexe Beziehung zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald zwischen 1937 und 1945. Der Fokus liegt auf der Integration des Lagers in die städtische Infrastruktur, den gegenseitigen Einflüssen von Stadt und Lager sowie der Wahrnehmung und Akzeptanz des Lagers durch die Weimarer Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die politische Entwicklung Weimars vor der Lagererrichtung, die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Weimar und Buchenwald, die Rolle der Weimarer Bevölkerung gegenüber dem Lager, die Handelsbeziehungen zwischen Weimarer Unternehmen und dem Konzentrationslager, und die Integration des Lagers in den Alltag der Stadt.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf den Zeitraum zwischen 1937 und 1945, mit einem historischen Rückblick auf die politische Entwicklung Weimars ab 1920, um den Kontext der Lagererrichtung besser zu verstehen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus drei Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschichte Weimars zwischen 1920 und 1937, und ein Kapitel zur Analyse der Beziehungen zwischen Weimar und Buchenwald (wirtschaftlich und Handelsbeziehungen).
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung im Kapitel "Die Geschichte Weimars zwischen 1920 und 1937"?
Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg nationalistischer und völkischer Gruppen in Weimar, die zunehmende Akzeptanz nationalsozialistischer Ideologien und die "Gleichschaltung" der Stadt. Der Bau des Konzentrationslagers Buchenwald wird als Höhepunkt dieses Prozesses dargestellt. Es wird auch auf den geringen Widerstand gegen die Lagererrichtung hingewiesen, der hauptsächlich aus dem Kontext des Goethe-Kultes resultierte (Ablehnung des Namens "Ettersberg").
Welche Erkenntnisse liefert das Kapitel "Beziehungen zwischen der Stadt Weimar und dem Konzentrationslager Buchenwald"?
Dieses Kapitel analysiert die wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zwischen Weimar und Buchenwald. Es zeigt, wie Weimarer Firmen vom Einsatz von Häftlingen profitierten und wie die Stadt das Lager belieferte. Es wird eine zunehmende wirtschaftliche Abhängigkeit Weimars von Buchenwald beschrieben, die durch Häftlingsarbeit und Warenverkehr entstand. Es wird auch auf soziale Kontakte zwischen Weimarer Bürgern und Häftlingen eingegangen, die vor allem durch die gemeinsame Arbeit entstanden, sowie auf die zunehmende Integration der Häftlinge in den städtischen Alltag, insbesondere nach Bombenangriffen auf Weimar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Konzentrationslager Buchenwald, Weimar, Nationalsozialismus, Gleichschaltung, Wirtschaft, Häftlingsarbeit, Handelsbeziehungen, Stadt-Lager-Beziehung, Gesellschaftliche Akzeptanz, Zwangsarbeit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Leser bestimmt, die sich für die Geschichte des Nationalsozialismus, die Geschichte Weimars und die Geschichte der Konzentrationslager interessieren, insbesondere für Wissenschaftler und Studenten im akademischen Bereich.
- Quote paper
- Franziska Schau (Author), 2007, Das Konzentrationslager Buchenwald und die Stadt Weimar im Zeitraum zwischen 1937 - 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93752