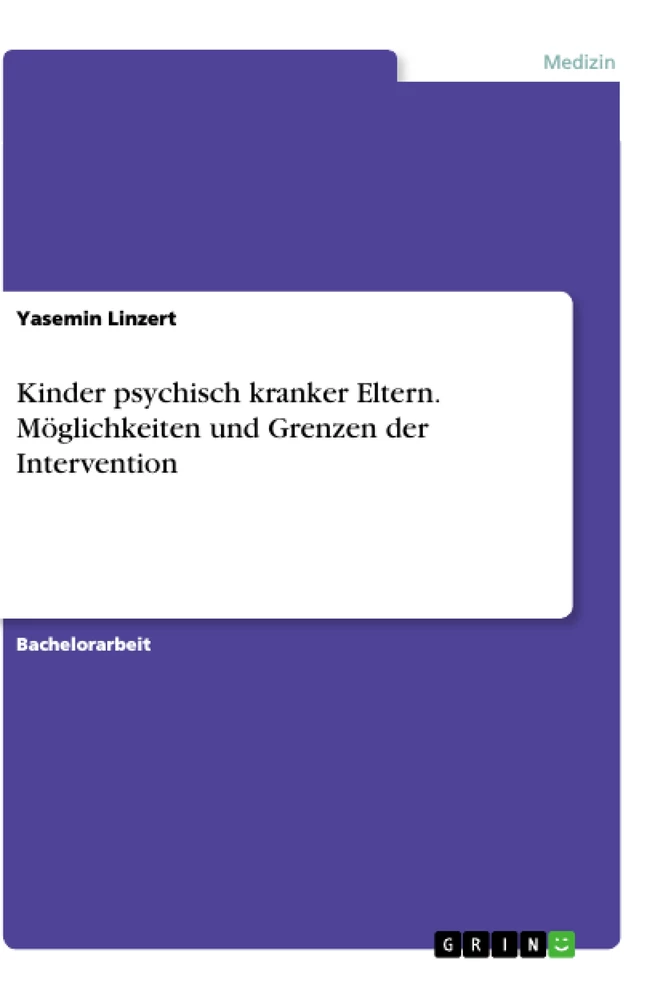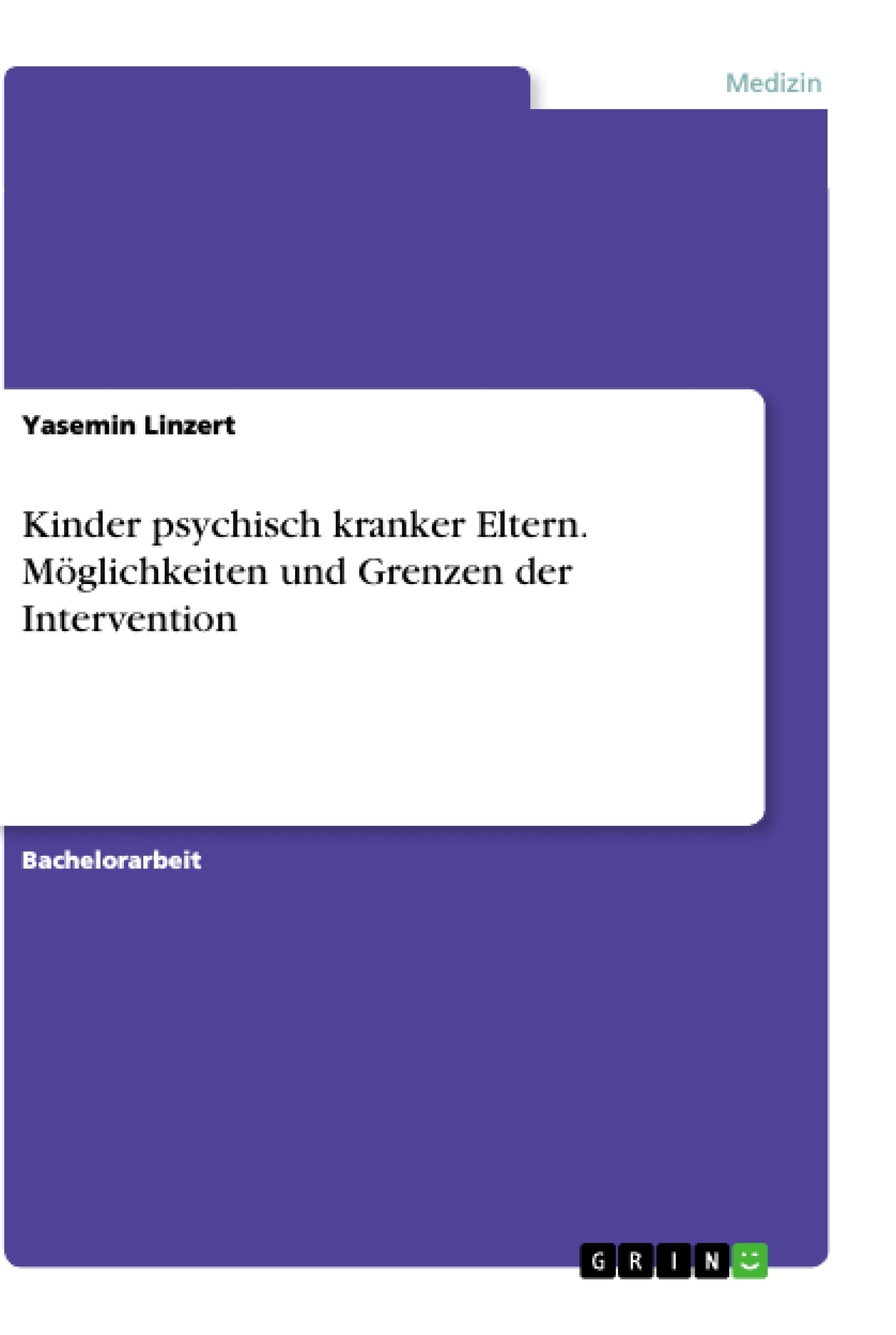Die Arbeit thematisiert Kinder psychisch kranker Eltern und zeigt Möglichkeiten und Grenzen der Intervention auf. In Deutschland erleben rund drei Millionen Kinder im Verlaufe eines Jahres, dass mindestens ein Elternteil an einer psychischen Störung leidet. Oftmals wird die psychische Erkrankung eines Elternteils innerhalb sowie außerhalb der Familie aus Angst vor Stigmatisierung verschwiegen. Demnach können die Kinder das Verhalten der Eltern während einer akuten Krankheitsphase nicht einordnen und glauben häufig, sie seien der Auslöser der psychischen Probleme.
Da Kinder darüber hinaus einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, sollten frühzeitig Maßnahmen zur Prävention geboten werden, um etwaig auftretende Belastungen für die Kinder zu mildern oder gar zu verhindern. Allerdings werden den Kindern die Maßnahmen nicht früh genug gewährt, sodass sie Unterstützung in Form von Interventionsprogrammen erst erfahren, wenn eine akute Krise die familiäre Situation belastet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Resilienz
- Definition Resilienz
- Schutzfaktoren
- Risikofaktoren
- Psychische Erkrankung der Eltern als Risikofaktor
- Definition psychischer Erkrankungen
- Epidemiologie
- Krankheitsbilder und deren Auswirkung auf die Kinder
- Angststörung
- Schizophrene Störung
- Depressive Erkrankung
- Lebenssituation von Kindern psychisch kranker Eltern
- Unmittelbare Probleme
- Desorientierung
- Schuldgefühle
- Angst
- Tabuisierung und Kommunikationsverbot
- Isolierung
- Folgeprobleme
- Betreuungsdefizit
- Parentifizierung
- Loyalitätskonflikte
- Trennung der Eltern als zusätzliche Belastung
- Einflussfaktoren
- Bewältigung der Lebenssituation
- Interventionsmöglichkeiten
- Kindzentrierte Maßnahmen
- Besonderheiten bei der Intervention mit Kindern
- Aktivierung von spezifischen Resilienzprozessen
- Patenschaften
- Gruppenangebote für Kinder
- Unterstützung für erwachsene Kinder psychisch kranker Eltern
- Familienorientierte Hilfen
- Gruppenangebote für Eltern
- Förderung der familiären Schutzfaktoren
- Chimps-Ansatz als Familienintervention
- Mutter-Kind-Therapie
- Maßnahmen des Jugendamtes
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lebenssituation von Kindern psychisch kranker Eltern und analysiert die Möglichkeiten und Grenzen der Intervention. Sie beleuchtet die Auswirkungen der psychischen Erkrankung der Eltern auf die kindliche Entwicklung sowie die spezifischen Herausforderungen, denen diese Kinder gegenüberstehen.
- Das Konzept der Resilienz und seine Relevanz für die Bewältigung von Belastungen
- Die Auswirkungen psychischer Erkrankungen der Eltern auf die Kinder
- Die besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen von Kindern psychisch kranker Eltern
- Mögliche Interventionen und Unterstützungsangebote für die Kinder und Familien
- Die Bedeutung von Schutzfaktoren und die Förderung von Resilienzprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kinder psychisch kranker Eltern ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas in der aktuellen Gesellschaft. Sie stellt die Herausforderungen und die Notwendigkeit von Unterstützung für diese Kinder dar.
Kapitel 2 widmet sich dem Konzept der Resilienz, wobei die Definition, Schutzfaktoren und Risikofaktoren beleuchtet werden. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Risikofaktor "psychische Erkrankung der Eltern" geschenkt.
Kapitel 3 behandelt die psychische Erkrankung der Eltern als Risikofaktor. Es werden die Definition psychischer Erkrankungen, die Epidemiologie sowie verschiedene Krankheitsbilder und deren Auswirkungen auf die Kinder näher betrachtet.
Kapitel 4 analysiert die Lebenssituation von Kindern psychisch kranker Eltern. Es werden die unmittelbaren und Folgeprobleme sowie die Herausforderungen in Bezug auf Betreuungsdefizit, Parentifizierung und Loyalitätskonflikte beleuchtet.
Kapitel 5 bietet einen Überblick über die Interventionsmöglichkeiten für Kinder psychisch kranker Eltern. Es werden sowohl kindzentrierte als auch familienorientierte Maßnahmen sowie Maßnahmen des Jugendamtes vorgestellt und deren Relevanz für die Unterstützung der Kinder und Familien diskutiert.
Schlüsselwörter
Kinder psychisch kranker Eltern, Resilienz, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, psychische Erkrankungen, Angststörung, Schizophrene Störung, Depressive Erkrankung, Lebenssituation, Intervention, Familienorientierte Hilfen, Kindzentrierte Maßnahmen, Jugendamt, Unterstützung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Kinder in Deutschland haben psychisch kranke Eltern?
Rund drei Millionen Kinder erleben in Deutschland jährlich, dass mindestens ein Elternteil an einer psychischen Störung leidet.
Was versteht man unter "Parentifizierung"?
Parentifizierung beschreibt eine Rollenumkehr, bei der das Kind Aufgaben und Verantwortung der Eltern übernimmt, was zu einer massiven Überforderung führen kann.
Welche Rolle spielt Resilienz bei betroffenen Kindern?
Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit. Schutzfaktoren können helfen, trotz der Belastungen eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen.
Warum verschweigen viele Familien die psychische Erkrankung?
Oft geschieht dies aus Angst vor Stigmatisierung und sozialer Ausgrenzung, was jedoch zu Isolation und Schuldgefühlen bei den Kindern führen kann.
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es?
Es gibt kindzentrierte Maßnahmen (z. B. Gruppenangebote, Patenschaften) und familienorientierte Hilfen (z. B. CHIMPS-Ansatz, Mutter-Kind-Therapie).
- Citar trabajo
- Yasemin Linzert (Autor), 2015, Kinder psychisch kranker Eltern. Möglichkeiten und Grenzen der Intervention, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937550