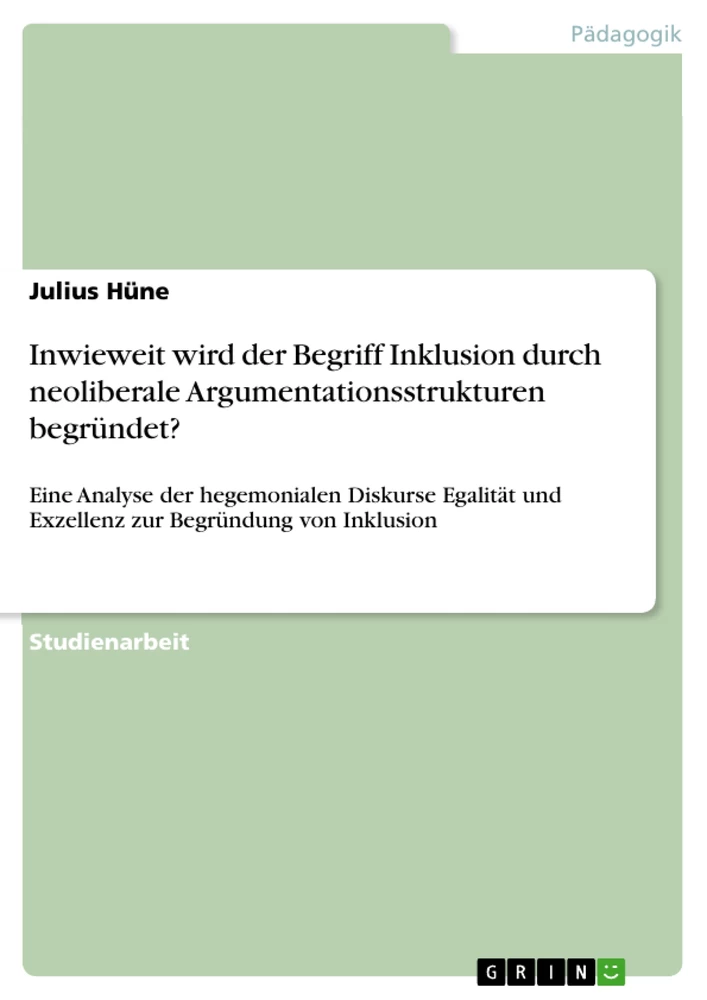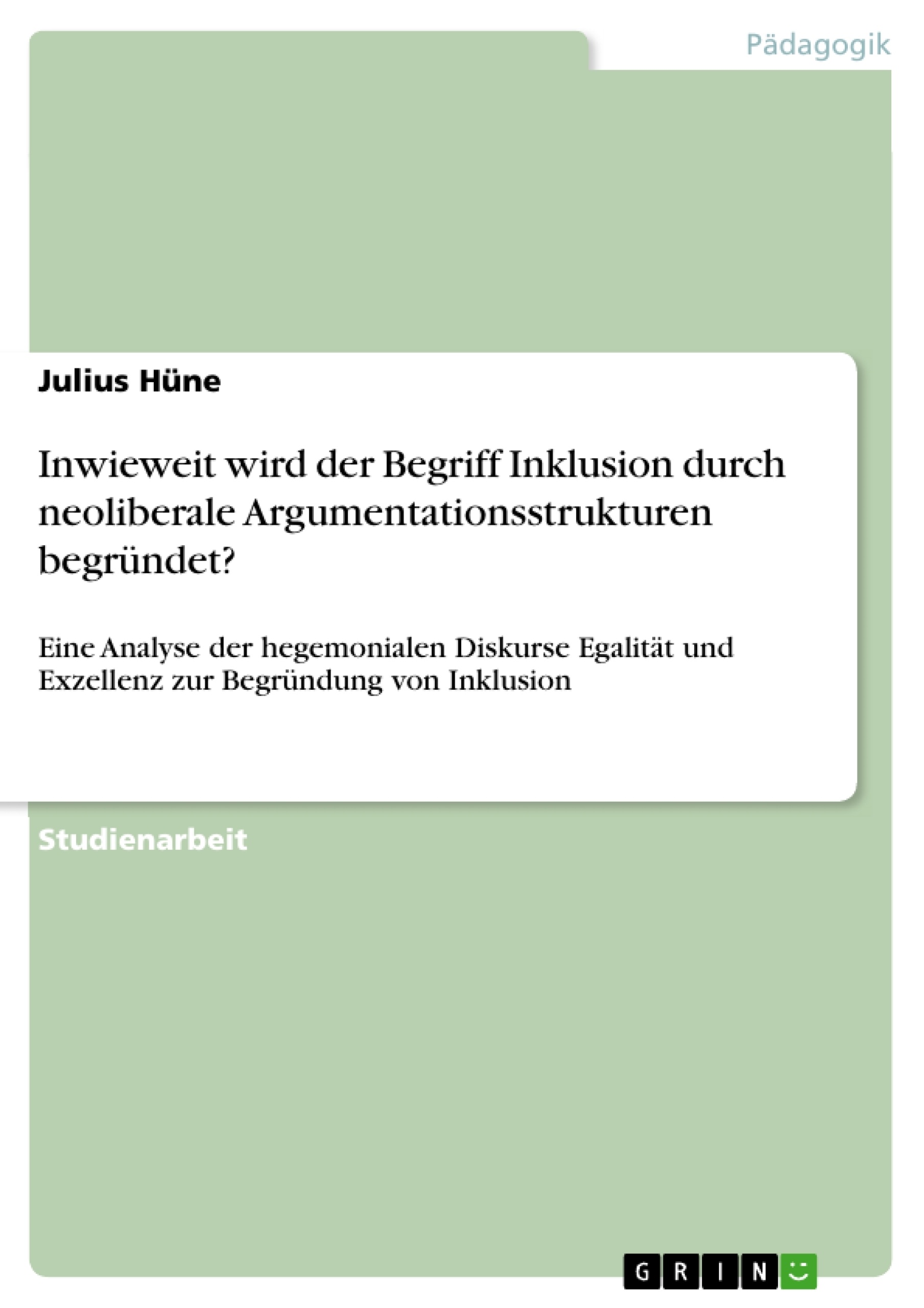Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist, wie unterschiedlich Inklusion verstanden wird und die Frage inwieweit sie durch neoliberale Argumentationsstrukturen begründet wird sowie ausblicksartig, welche bildungspolitischen Maßnahmen daraus folgen. Eine solche Betrachtung soll offenlegen, inwieweit der Begriff Inklusion einer paradigmatischen Orientierung folgt. Eine solche Offenlegung soll es erleichtern, bestimmte Maßnahmen hinsichtlich der ihr zu Grunde liegenden ideologischen Motivation zu analysieren und Ansatzpunkte zu liefern, diese zu kritisieren. Eine solche Kritik ermöglicht, die Ausrichtung und Auslegung des Begriffs sowie die praktische Ausgestaltung in der Zukunft zu beeinflussen.
Bei näherer Betrachtung dieser Fragestellung fällt auf, dass bei der Begründung von Inklusion neoliberal orientierte Argumente sehr wohl Eingang in den inklusionsbefürwortenden Diskurs finden. So finden sich immer wieder Argumentationsstrukturen die Inklusion befürworten und sich in ihrer Begründung primär ökonomisch orientieren. Dies überrascht angesichts der von der UNESCO formulierten, als unveräußerlich geltenden Menschenrechte auf Teilhabe. Diese Form der Begründung von Inklusion legt nahe, das Verhältnis von Inklusion und Neoliberalismus näher zu betrachten und unterschiedliche Argumentationsstrukturen im Fachdiskurs über Inklusion mit dem Ziel zu untersuchen, inwieweit neoliberale Argumentationsstrukturen zur Begründung von Inklusion leitend sind und in welcher Form hier diskursive Kämpfe ausgetragen werden. Es bleibt zu prüfen, inwieweit Inklusion als Instrument neoliberaler gesellschaftlicher Transformation gesehen werden kann. Hierzu sollen exemplarisch einige wissenschaftliche Beiträge zur Inklusionsdebatte betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Divergente Verständnisse von Inklusion
- Historische Entwicklung
- Aktuelle Entwicklungen
- Normalismusverständnisse
- Neoliberale Argumentationsstrukturen in der Begründung von Inklusion
- Neoliberalismus
- Die Humankapitaltheorie im Inklusionsdiskurs
- Einfluss auf den Inklusionsdiskurs
- Individualisierung/ Neue Lernkultur
- Umgang mit dem Begriff Vielfalt
- Chancengleichheit
- Zwischenfazit
- Hegemoniale Diskurse
- Vorstellung der Analyse
- Theoretischer Inklusionsdiskurs
- Praxisorientierter Inklusionsdiskurs
- Fazit
- Ausblick: Gefährdung des Sozialen durch eine Vereinnahmung des Begriffs Inklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedlichen Bedeutungen des Inklusionsbegriffs im Kontext bildungspolitischer Debatten in Deutschland und analysiert, inwieweit neoliberale Argumentationsstrukturen diesen Begriff prägen und beeinflussen. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze und Begründungen für Inklusion zu identifizieren und aufzuzeigen, wie sie in hegemonialen Diskursen um Egalität und Exzellenz verankert sind.
- Divergente Verständnisse von Inklusion im historischen und aktuellen Kontext
- Der Einfluss neoliberaler Argumentationsstrukturen auf die Begründung von Inklusion
- Die Rolle der Humankapitaltheorie im Inklusionsdiskurs
- Die Bedeutung von Individualisierung und neuer Lernkultur im Kontext von Inklusion
- Die Auswirkungen von hegemonialen Diskursen auf die Konzeption und Umsetzung von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inklusion ein und erläutert die Relevanz des Begriffs im Kontext der deutschen Bildungspolitik. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss neoliberaler Argumentationsstrukturen auf die Begründung von Inklusion und skizziert die Vorgehensweise der Arbeit.
- Divergente Verständnisse von Inklusion: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Bedeutungsdimensionen von Inklusion. Dabei werden die historische Entwicklung des Begriffs beleuchtet und unterschiedliche Ansätze im aktuellen Diskurs vorgestellt. Die Betrachtung fokussiert auf die Frage, inwieweit diese Ansätze an neoliberale Ideologien anschließen.
- Neoliberale Argumentationsstrukturen in der Begründung von Inklusion: Hier wird die Rolle des Neoliberalismus im Inklusionsdiskurs beleuchtet. Das Kapitel analysiert die Relevanz der Humankapitaltheorie und untersucht, wie neoliberale Argumente die Debatte um Inklusion beeinflussen. Themen wie Individualisierung, neue Lernkultur und Chancengleichheit werden im Kontext neoliberaler Denkweisen betrachtet.
- Hegemoniale Diskurse: Dieses Kapitel befasst sich mit hegemonialen Diskursen, die die Inklusionsdebatte prägen. Der Fokus liegt auf den Diskursen um Egalität und Exzellenz und deren Einfluss auf verschiedene Inklusionsverständnisse. Die Analyse untersucht, wie diese Diskurse das Verständnis und die Umsetzung von Inklusion in der Praxis beeinflussen.
Schlüsselwörter
Inklusion, Neoliberalismus, Humankapitaltheorie, Egalität, Exzellenz, Individualisierung, Neue Lernkultur, Bildungspolitik, Menschenrechte, Diskursanalyse, Hegemonie, gesellschaftliche Transformation
Häufig gestellte Fragen
Inwiefern wird Inklusion neoliberal begründet?
Neoliberale Argumentationsstrukturen nutzen oft ökonomische Motive, um Inklusion zu rechtfertigen, indem sie Vielfalt als Ressource für den Markt oder zur Steigerung der Effizienz betrachten.
Welche Rolle spielt die Humankapitaltheorie im Inklusionsdiskurs?
Die Humankapitaltheorie sieht Bildung primär als Investition in die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Einzelnen. Inklusion wird hierbei oft als Mittel zur Maximierung des gesellschaftlichen Leistungspotenzials gesehen.
Was versteht man unter dem Spannungsfeld von Egalität und Exzellenz?
Es beschreibt den Konflikt zwischen dem Anspruch auf gleiche Bildungschancen für alle (Egalität) und der gleichzeitigen Förderung von Spitzenleistungen (Exzellenz) in einem wettbewerbsorientierten Bildungssystem.
Wie beeinflusst der Neoliberalismus die „neue Lernkultur“?
Durch Individualisierung wird die Verantwortung für den Lernerfolg zunehmend auf das Individuum übertragen, was an neoliberale Konzepte der Eigenverantwortung und Selbstoptimierung anknüpft.
Was ist das Ziel der Diskursanalyse in dieser Arbeit?
Die Analyse soll offenlegen, welche ideologischen Motivationen hinter bestimmten bildungspolitischen Maßnahmen zur Inklusion stehen, um eine kritische Auseinandersetzung mit deren Ausgestaltung zu ermöglichen.
- Quote paper
- Julius Hüne (Author), 2018, Inwieweit wird der Begriff Inklusion durch neoliberale Argumentationsstrukturen begründet?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937704