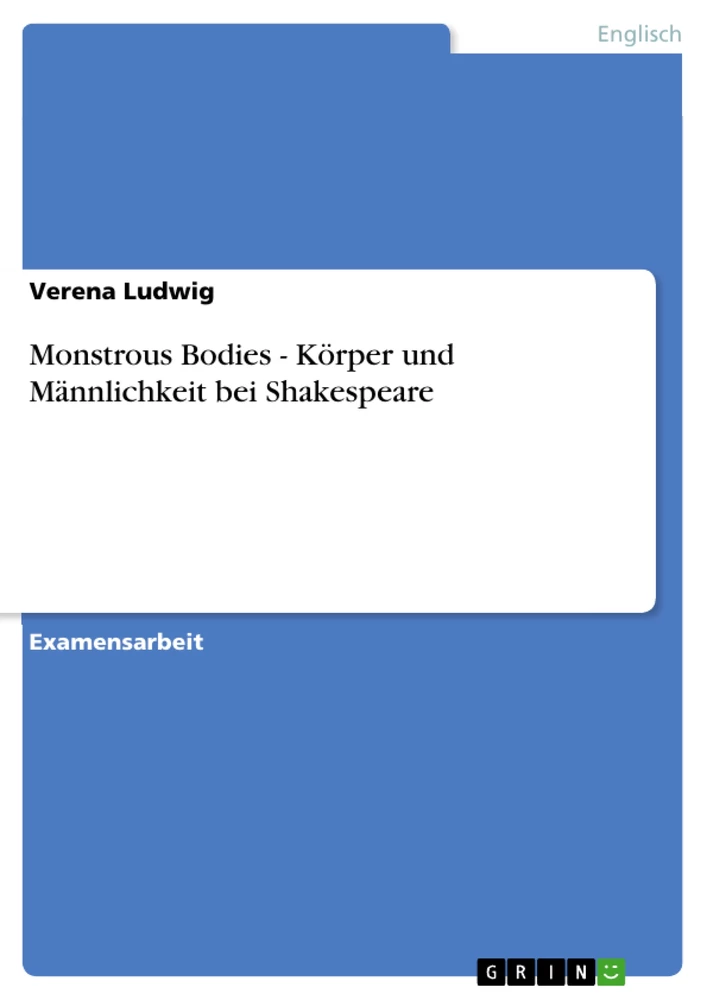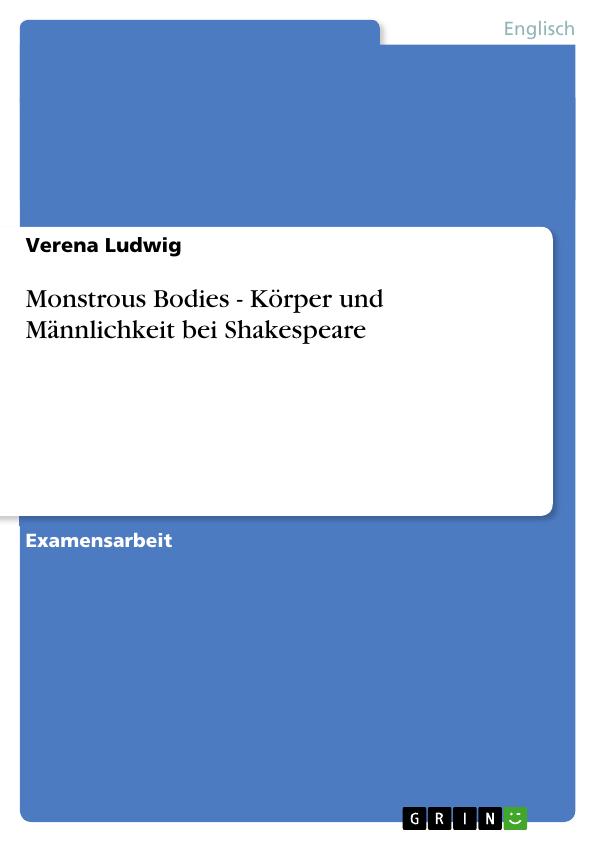Jahrhunderte bevor der Begriff Gender und der dazugehörige wissenschaftliche Diskurs sich entwickelten, verhandelten William Shakespeares Dramen bereits Probleme sexueller Identität, dysfunktionale Familienbeziehungen und Formen des Aufbegehrens gegen traditionelle Geschlechter-Rollen. In der neueren Shakespeare-Forschung wurden diese Themen im Zuge der sich aus der Frauenforschung entwickelnden Gender-Studies vor allem an den weiblichen Charakteren der Dramen behandelt.
Während die Gender-Studies sich anfangs vornehmlich auf das Herrschaftsverhältnis zwischen Männern und Frauen konzentriert haben, rücken nun auch die Machtgefüge unter Männern und verschiedenen „Männlichkeiten“ unter den Bedingungen der patriarchalischen Gesellschaft in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses.
In den folgenden Ausführungen zu Körper und Männlichkeit bei Shakespeare soll es um einen Bereich von „Körperlichkeit“ gehen, der bisher wenig Aufmerksamkeit erhalten hat und im öffentlichen Diskurs noch immer weitgehend tabuisiert wird: der „behinderte“, von der medizinischen und gesellschaftlichen, und hier besonders von der „männlichen“ Norm abweichende Körper.
Innerhalb der gesellschaftlichen Konstruktion von Männlichkeit steht beim Mann seit jeher vor allem die Leistungsfähigkeit seines Körpers im Vordergrund. Nur ein leistungsfähiger Körper ist wirklich „männlich“, denn er erlaubt es dem Mann, seine maskulinen Qualitäten öffentlich zu inszenieren, sich im Wettkampf, etwa im Sport, mit seinen Geschlechtsgenossen zu messen, oder seine Attraktivität auf Frauen als „Trophäen“ seiner Potenz zur Schau zu stellen.
Was ist aber mit den Individuen, die den gesellschaftlichen Forderungen an eine funktionsfähige männliche Identität, sozial und sexuell, von vorneherein nicht entsprechen, die aus dem Patriarchat ausgeschlossen werden müssen, weil sie keine „ganzen Männer“ sein können?
Um einer Antwort auf diese Frage näher zu kommen, sollen in dieser Arbeit drei von Shakespeares zahlreichen außergewöhnlichen Körpern untersucht werden, drei Charaktere, die sich gerade wegen ihrer außergewöhnlichen Korporealität seit ihrem ersten Erscheinen auf einer Bühne besonderer Popularität erfreuen und Gegenstand zahlreicher Interpretationsansätze sind: Richard III., Caliban und Falstaff.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Körper und „Männlichkeit“
- Die Disability Studies als neuer Zweig der Literaturwissenschaft
- I. Wahrnehmung und Signifikanz außergewöhnlicher Körper in der Renaissance-Gesellschaft
- I.1 Wonder books, broadside ballads und fairground monsters
- I.2 Vom „Wunder“ zum „Freak“ zum „Teratum“
- I.3 „Unnatural births“
- II. Konzepte sexueller Identität in der Frühen Neuzeit
- II.1 Sexualität vor dem Hintergrund der Humoralpathologie
- II.2 Zwei Körper - ein Geschlecht
- III. RICHARD III. – „Überhitzte“ Männlichkeit auf dem Thron
- III.1 „Villain king?“ – Der historische Richard
- III.2 Richards Körper in der Diagnose der frühneuzeitlichen Medizin
- III.3 Die Henry VI - Tetralogie als Spiegelung der politischen und gender-ideologischen Situation von Elizabeths Herrschaft
- III.4 Die soziale Signifikanz von Richards Körperlichkeit
- IV. CALIBAN - Das „Tier“ im Mann und die Jungfrau
- IV.1 „What have we here, a man or a fish?“ – Ein Körper, der jeder Beschreibung spottet
- IV.1.1 Interpretations- und Bühnengeschichte
- IV.1.2 „Savage“ oder „Monster“ - Hinweise auf Calibans Körper im Text
- IV.2 Calibans sexuelle Identität(en)
- IV.2.1 Der erste Caliban: Die Bedrohung der Ordnung durch ungezügelte Sexualität
- IV.2.2 Der zweite Caliban: Weibliche Sexualität und tote Mütter
- IV.2.2.1 Sycorax
- IV.2.2.2 Mirandas Mutter
- IV.2.2.3 Miranda
- IV.2.3 Der dritte Caliban: Die Versuchung des Vaters
- IV.1 „What have we here, a man or a fish?“ – Ein Körper, der jeder Beschreibung spottet
- V. FALSTAFF - Die Weiblichkeit des fetten Mannes
- V.1 Fettleibigkeit im Licht der vormodernen Medizin
- V.2 Historisches Vorbild und traditionelle Interpretationen
- V.3 Falstaff und sein Körper
- V.4 Falstaff als Vater
- V.5 Falstaffs sexuelle Identität(en): Kind, Liebhaber, Mutter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Konzepte von Körper und „Männlichkeit“ in Shakespeares Dramen. Die Arbeit untersucht, wie Shakespeare Probleme sexueller Identität, Familienbeziehungen und Geschlechterrollen in seinen Werken behandelt. Dabei steht der Fokus auf den männlichen Figuren und deren Auseinandersetzung mit traditionellen Geschlechtervorstellungen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Körperlichkeit in Shakespeares Werken und wie sie mit Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit verbunden ist. Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte:- Die Wahrnehmung und Signifikanz von außergewöhnlichen Körpern in der Renaissance-Gesellschaft
- Die Verbindung von Körperlichkeit und sexueller Identität in der Frühen Neuzeit
- Die Darstellung „überhitzter“ Männlichkeit am Beispiel von Richard III. und die Bedeutung von Körperlichkeit für seine Macht und soziale Position
- Die Darstellung von Caliban und sein „tierisches“ Wesen im Kontext von Geschlechterrollen und sexueller Identität
- Die Darstellung von Falstaff und die Ambivalenz seiner Körperlichkeit im Zusammenhang mit Geschlechterrollen und Vaterrolle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Körperbildes und der „Männlichkeit“ in Shakespeares Dramen ein und erläutert die Relevanz dieser Thematik im Kontext der Gender-Studies.
- I. Wahrnehmung und Signifikanz außergewöhnlicher Körper in der Renaissance-Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Wahrnehmung von körperlicher Abweichung in der Renaissance. Es beleuchtet „Wonder books“, „broadside ballads“ und „fairground monsters“ als Zeugnisse dieser Zeit und untersucht, wie außergewöhnliche Körper als „Wunder“, „Freak“ oder „Teratum“ wahrgenommen wurden.
- II. Konzepte sexueller Identität in der Frühen Neuzeit: Dieses Kapitel diskutiert die Konzepte sexueller Identität in der Frühen Neuzeit, insbesondere vor dem Hintergrund der Humoralpathologie. Es untersucht, wie Körper und Geschlecht in dieser Zeit miteinander verbunden waren.
- III. RICHARD III. – „Überhitzte“ Männlichkeit auf dem Thron: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Richard III. als „überhitzter“ Männlichkeit. Es untersucht den historischen Hintergrund und die medizinische Diagnose von Richards Körperlichkeit und beleuchtet die Bedeutung seines Körpers für seine politische und soziale Position.
- IV. CALIBAN - Das „Tier“ im Mann und die Jungfrau: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Caliban und seine ambivalenten Merkmale als „Tier“ und Mensch. Es untersucht die Interpretationen seiner Körperlichkeit und seine verschiedenen sexuellen Identitäten im Kontext von Geschlechterrollen und sozialer Ordnung.
- V. FALSTAFF - Die Weiblichkeit des fetten Mannes: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Falstaff und seine ambivalente Körperlichkeit. Es untersucht die medizinischen und historischen Aspekte von Fettleibigkeit und beleuchtet die Interpretationen von Falstaffs Körperlichkeit in Bezug auf seine Geschlechterrollen und Vaterrolle.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselthemen der Körperlichkeit und der „Männlichkeit“ in den Dramen Shakespeares. Dabei werden die Gender-Studies und die Disability Studies als analytische Frameworks genutzt. Im Zentrum stehen die Körperlichkeit und die sexuellen Identitäten von männlichen Figuren wie Richard III., Caliban und Falstaff. Weitere wichtige Themen sind die Wahrnehmung von körperlicher Abweichung in der Renaissance, die Humoralpathologie und die gesellschaftliche Bedeutung von Geschlechterrollen in der Frühen Neuzeit.Häufig gestellte Fragen
Welche Shakespeare-Figuren werden in Bezug auf Körperlichkeit untersucht?
Die Arbeit analysiert Richard III. (Behinderung), Caliban (monströser Körper) und Falstaff (Fettleibigkeit).
Was sind "Disability Studies" in der Literaturwissenschaft?
Ein Forschungszweig, der untersucht, wie körperliche Abweichungen und Behinderungen in Texten dargestellt und gesellschaftlich konstruiert werden.
Wie wurde körperliche Abweichung in der Renaissance wahrgenommen?
Außergewöhnliche Körper wurden oft als "Wunder", "Freaks" oder "Terata" (Mißgeburten) gesehen und in sogenannten "Wonder books" dokumentiert.
Welche Rolle spielt die Humoralpathologie für das Geschlechterbild?
Die Säfte-Lehre bestimmte das Verständnis von Temperament und sexueller Identität, wobei Körperwärme oft mit Männlichkeit assoziiert wurde.
Warum wird Falstaffs Körper als "weiblich" interpretiert?
Seine Fettleibigkeit und weichen Züge wurden im Kontext der Zeit oft als Abweichung von der harten, kriegerischen männlichen Norm und Annäherung an das Weibliche gedeutet.
- Citar trabajo
- Verena Ludwig (Autor), 2008, Monstrous Bodies - Körper und Männlichkeit bei Shakespeare, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93780