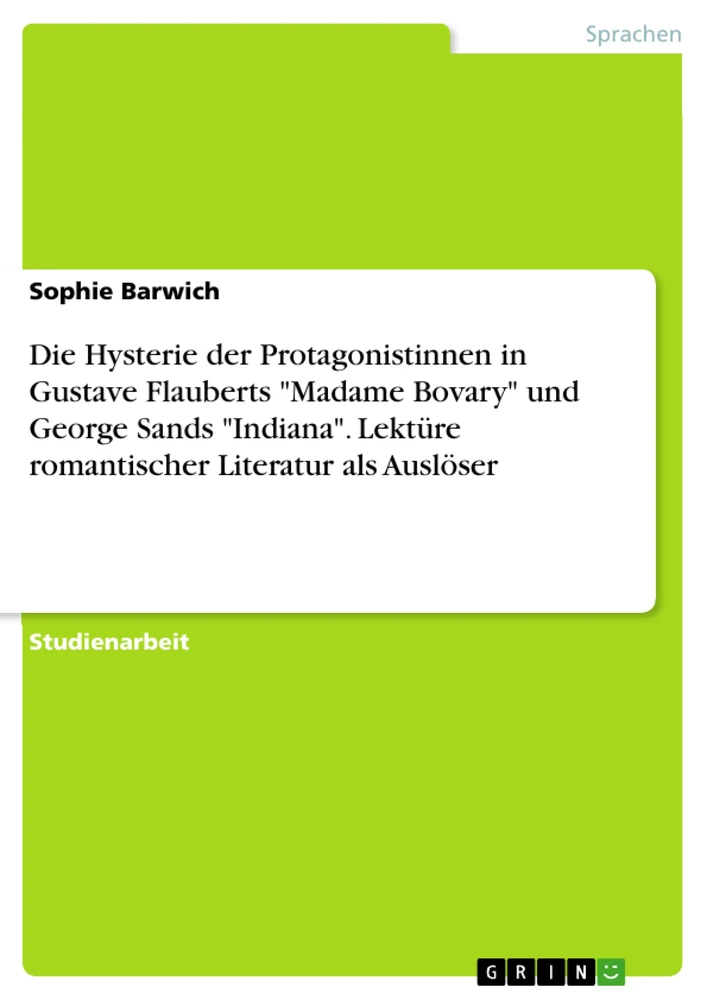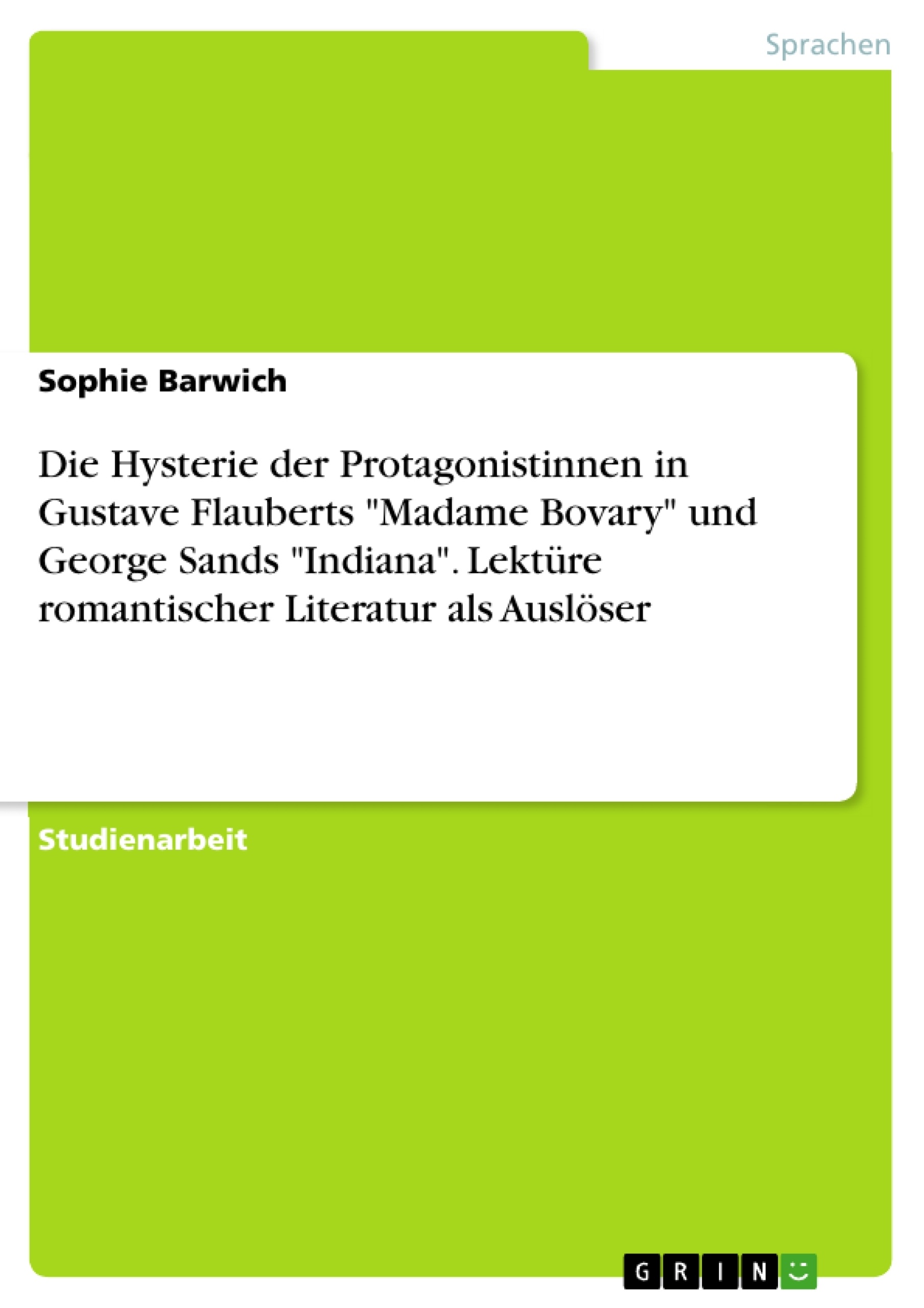In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwiefern Gustave Flaubert und George Sand das Phänomen der Hysterie und die Lektüre als Aufbegehren in ihren Romanen Madame Bovary und Indiana verarbeiten und welche Rolle dabei ihre
eigenen Positionen als privilegierter Mann auf der einen und gegen jede Konventionen verstoßende, das Schicksal der Frau aber aus eigener Erfahrung nachvollziehende Frau auf der anderen Seite spielen. Dazu wird zunächst näher auf die Geschichte der Hysterie und das Krankheitsbild der Hysterie im 19. Jahrhundert eingegangen. Es folgt eine Betrachtung Flauberts und Sands in Verbindung mit dem Phänomen der Hysterie zu ihrer Zeit. Anschließend erfolgt eine vergleichende Analyse der Protagonistinnen Indiana und Emma Bovary in Bezug auf die Hysterie, um herauszuarbeiten, inwiefern Flaubert und Sand dieses Thema unterschiedlich behandeln. Im Mittelpunkt steht dabei der Blick auf die Lektüre romantischer Literatur als Auslöser für die Hysterie bei beiden Romanfiguren. Als Gustave Flaubert 1856 seinen Roman Madame Bovary veröffentlichte, löste er damit einen Skandal aus und musste sich wegen seiner Geschichte über eine ehebrecherische Frau, die er als Autor nicht verurteilte, sogar vor Gericht verantworten. Die Hysterie war groß – und dabei wurde der Protagonistin des Romans
selbst die Hysterie im damaligen Sinne vorgeworfen. Die Hysterie war als reine Frauenkrankheit im 19. Jahrhundert ein Massenphänomen, das die verschiedensten Ursachen umfasste: Frigidität und Nymphomanie, Müßigkeit und auch die Lektüre
allzu romantischer Romane, die die leicht reizbare Frau angeblich auf falsche Ideen bringe. Was der bürgerlichen Frau im Frankreich des 19. Jahrhunderts als Beschäftigung in ihrer Rolle als unmündige Ehefrau und Mutter bleibt, ist den Männern Grund genug für die Diagnostizierung der Hysterie, während die Bedürfnisse der Frau keine Rolle spielen. Flauberts Emma Bovary wurde zum Grundstein für den bovarysme; dem Sinnbild einer gelangweilten und träumerischen, von irreführender
Lektüre beeinflussten bürgerlichen Ehefrau, die nicht nur in Liebesaffären, sondern auch in der Hysterie Aufmerksamkeit und eine Flucht aus dem Alltag sucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hysterie: Entstehung eines Krankheitsbilds
- Die hysterische Frau im Frankreich des 19. Jahrhunderts
- Hysterie bei George Sand und Gustave Flaubert
- George Sand und die Hysterie
- Gustave Flaubert und die Hysterie
- Hysterie in Indiana
- Hysterie in Madame Bovary
- Hysterische Frauen als Leserinnen bei Sand und Flaubert
- Emma Bovary als Leserin
- Indiana als Leserin
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Verarbeitung des Phänomens der Hysterie und der Lektüre als Aufbegehren in Gustave Flauberts Roman Madame Bovary und George Sands Roman Indiana. Dabei wird die Rolle der eigenen Positionen beider Autoren als privilegierter Mann und als Frau, die gegen gesellschaftliche Konventionen rebelliert, aber das Schicksal der Frau aus eigener Erfahrung kennt, berücksichtigt.
- Die Entstehung und die Geschichte der Hysterie als spezifisch weibliches Krankheitsbild im 19. Jahrhundert.
- Die Darstellung der Hysterie in den Werken von George Sand und Gustave Flaubert.
- Die Analyse der Protagonistinnen Indiana und Emma Bovary im Hinblick auf die Hysterie und die Unterschiede in der Behandlung des Themas durch Flaubert und Sand.
- Die Rolle der Lektüre romantischer Literatur als Auslöser für die Hysterie bei beiden Romanfiguren.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit stellt den Kontext des Romans Madame Bovary von Gustave Flaubert und den damit verbundenen Skandal dar, der die Hysterie als ein Massenphänomen in den Vordergrund stellte. Die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert und die Diagnostizierung der Hysterie anhand von Faktoren wie Lektüre romantischer Literatur, Frigidität und Nymphomanie werden erläutert. Die Autorin George Sand und ihre Figur Indiana im Vergleich zu Emma Bovary werden als Kontrast zum Leben der eingeschränkten Hausfrau und Mutter in der Provinz vorgestellt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Verarbeitung der Hysterie und der Lektüre als Aufbegehren in den Romanen Madame Bovary und Indiana zu untersuchen und dabei die jeweiligen Positionen der Autoren als Mann und Frau zu berücksichtigen.
2. Hysterie: Entstehung eines Krankheitsbilds
Die Hysterie als weibliches Leiden wird in der Antike und im Mittelalter in Bezug auf die Frau als Verlockung für sündhafte Sexualität und Hexenverfolgung beleuchtet. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Hysterie zu einer dominierenden Krankheit, die von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit stark beachtet wurde. Jean-Martin Charcots Studien und die ,,grand attaque hystérique“ mit ihren festen Abläufen werden beschrieben. Die Symptome der Hysterie im 19. Jahrhundert, die von apathischen Zuständen bis zu Frigidität und Nymphomanie reichen, und deren Ursachen, die mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft verbunden sind, werden dargestellt. Sigmund Freuds Sicht auf die Hysterie als Ausdruck eines psychischen Traumas wird kurz erwähnt. Das Verschwinden der Hysterie als spezifisch weibliches Krankheitsbild und die Zuordnung der ehemaligen Symptome zu dissoziativen Störungen in der heutigen Medizin werden erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Hysterie, Lektüre, Geschlechterrollen, romantisches Liebesideal, Frankreich im 19. Jahrhundert, Gustave Flaubert, George Sand, Madame Bovary, Indiana.
- Citation du texte
- Sophie Barwich (Auteur), 2020, Die Hysterie der Protagonistinnen in Gustave Flauberts "Madame Bovary" und George Sands "Indiana". Lektüre romantischer Literatur als Auslöser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937903