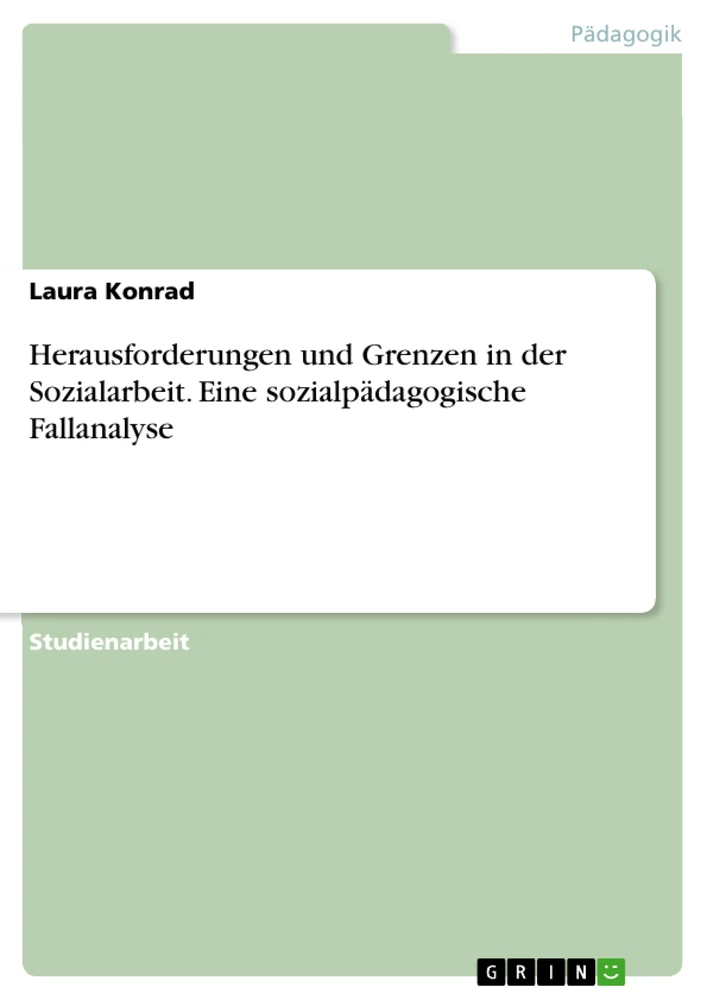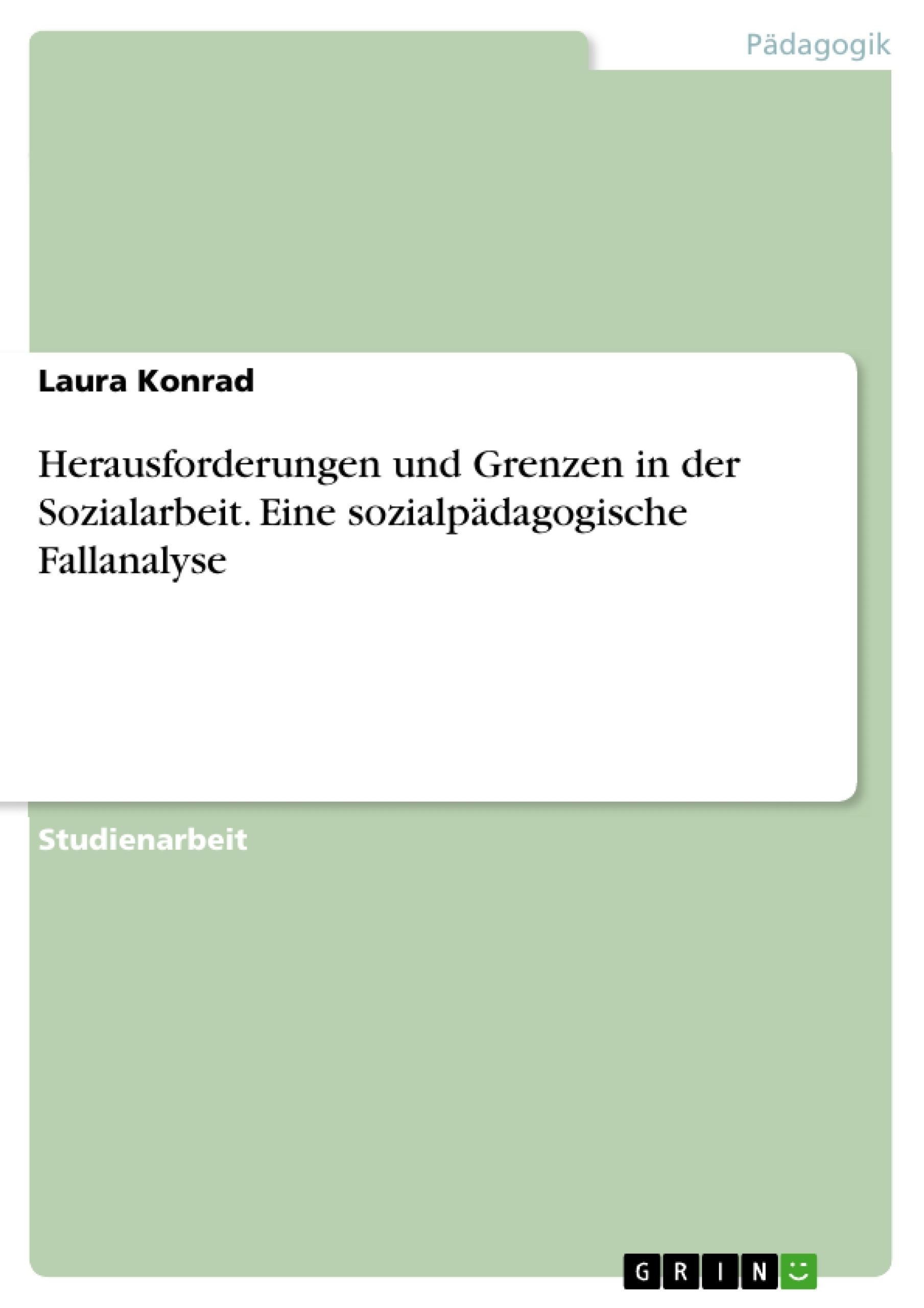Der erste Teil dieser Arbeit befasst sich mit dem im späteren Verlauf zu analysierenden sozialpädagogischen Fall, der dabei aus eigener Perspektive geschildert wird. In Folge dessen werden die Irritationen erläutert, welche der Fall hervorgerufen hat, wobei vor allem auf die möglichen Herausforderungen und Grenzen sozialpädagogischen Handelns eingegangen wird. Die dadurch erzielten Ergebnisse stellen die Grundlage der Hypothese dar, die dann in einem nächsten Schritt erläutert wird. Der Hauptteil der Arbeit besteht aus der Analyse des geschilderten Falles. In einem ersten Schritt wird der Fall anhand des kritisch-emanzipativen Bildungs- und Erziehungsverständnisses und in einem zweiten Schritt anhand des Sozialraums analysiert. Im Gesamtfazit werden die Ergebnisse der Arbeit nochmals aufgegriffen, Herausforderungen für das sozialpädagogische Handeln formuliert und die Hypothese begründet beantwortet. Das Schlusswort bildet in einem letzten Schritt den Abschluss dieser Arbeit. Um diese Forderungen in der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis adäquat umsetzen und Chancen des professionellen Handelns erzielen zu können, bedarf es unter anderem wissenschaftlichen Theorien und Methoden, die im Rahmen des Studiums angeeignet werden. Wichtig erscheint zudem das Bewusstsein darüber, dass in der sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Praxis neben den Chancen auch Grenzen des professionellen Handelns bestehen. In der vorliegenden Arbeit wird eine Fallanalyse durchgeführt, welche genau diese Grenzen - Herausforderungen des sozialpädagogischen und sozialarbeiterischen Handelns - aufzeigt. Der sozialpädagogische Fall, der dieser Fallanalyse zugrunde liegt, wird dabei anhand des kritisch-emanzipativen Bildungs- und Erziehungsverständnisses sowie anhand des Sozialraums analysiert und reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. FALLDARSTELLUNG
- 2. HYPOTHESENBILDUNG
- 3. ANALYSE DES FALLES MIT BEZUG AUF «BILDUNG UND ERZIEHUNG>>
- 3.1 DAS KRITISCH-EMANZIPATIVE BILDUNGSVERSTÄNDNIS DER SOZIALPÄDAGOGIK
- 3.1.1 Fallreflexion aus der Perspektive des kritisch-emanzipativen Bildungsverständnisses
- 3.2 DAS KRITISCH-EMANZIPATIVE ERZIEHUNGSVERSTÄNDNIS DER SOZIALPÄDAGOGIK
- 3.2.1 Fallreflexion aus der Perspektive des kritisch-emanzipativen Erziehungsverständnis
- 3.1 DAS KRITISCH-EMANZIPATIVE BILDUNGSVERSTÄNDNIS DER SOZIALPÄDAGOGIK
- 4. ANALYSE DES FALLES MIT BEZUG AUF «SOZIALRAUM»>
- 4.1 SOZIALRAUM
- 4.1.1 Fallreflexion aus der Perspektive des Sozialraums
- 4.1 SOZIALRAUM
- 5. GESAMTFAZIT
- 6. SCHLUSSWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer Fallanalyse im Bereich der Sozialpädagogik und beleuchtet die Grenzen und Herausforderungen des sozialpädagogischen Handelns. Der Fall wird mit Hilfe des kritisch-emanzipativen Bildungs- und Erziehungsverständnisses sowie des Sozialraums analysiert.
- Analyse der Grenzen des sozialpädagogischen Handelns im Kontext des kritisch-emanzipativen Bildungs- und Erziehungsverständnisses
- Bedeutung des Sozialraums für die sozialpädagogische Praxis und die Fallanalyse
- Reflexion der eigenen Rolle und Handlungsmöglichkeiten als Sozialpädagog*in im beschriebenen Fall
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Lösungsansätzen für die im Fall dargestellten Herausforderungen
- Bedeutung der Dokumentation im sozialpädagogischen Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Kontext des sozialpädagogischen Handelns. In Kapitel 1 wird die Falldarstellung aus eigener Perspektive beschrieben und die Irritationen, die der Fall hervorgerufen hat, werden dargestellt. Kapitel 2 beinhaltet die Hypothese, die im Anschluss an die Falldarstellung formuliert wird. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Analyse des Falles anhand des kritisch-emanzipativen Bildungs- und Erziehungsverständnisses sowie des Sozialraums. Das Gesamtfazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und formuliert Herausforderungen für das sozialpädagogische Handeln. Das Schlusswort beendet die Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Sozialpädagogische Fallanalyse, kritisch-emanzipatives Bildungs- und Erziehungsverständnis, Sozialraum, Grenzen und Herausforderungen des sozialpädagogischen Handelns, Dokumentation im sozialpädagogischen Handeln, Menschen mit Behinderung, Betreutes Wohnen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser sozialpädagogischen Fallanalyse?
Die Arbeit analysiert die Grenzen und Herausforderungen professionellen Handelns in der Sozialarbeit anhand eines konkreten Praxisfalles.
Was bedeutet "kritisch-emanzipatives Bildungsverständnis"?
Es beschreibt einen Ansatz in der Sozialpädagogik, der darauf abzielt, Menschen zur Selbstbestimmung und zur kritischen Reflexion ihrer Lebensumstände zu befähigen.
Welche Rolle spielt der "Sozialraum" in der Analyse?
Die Sozialraumanalyse untersucht, wie das Umfeld und die Lebenswelt des Klienten dessen Entwicklungsmöglichkeiten und das pädagogische Handeln beeinflussen.
Warum ist Dokumentation in der Sozialarbeit wichtig?
Dokumentation dient der Qualitätssicherung, der rechtlichen Absicherung und als Basis für die Reflexion beruflicher Entscheidungen.
In welchem Setting spielt der untersuchte Fall?
Der Fall bezieht sich auf die Arbeit mit Menschen mit Behinderung im Kontext des Betreuten Wohnens.
- Quote paper
- Laura Konrad (Author), 2020, Herausforderungen und Grenzen in der Sozialarbeit. Eine sozialpädagogische Fallanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/937977