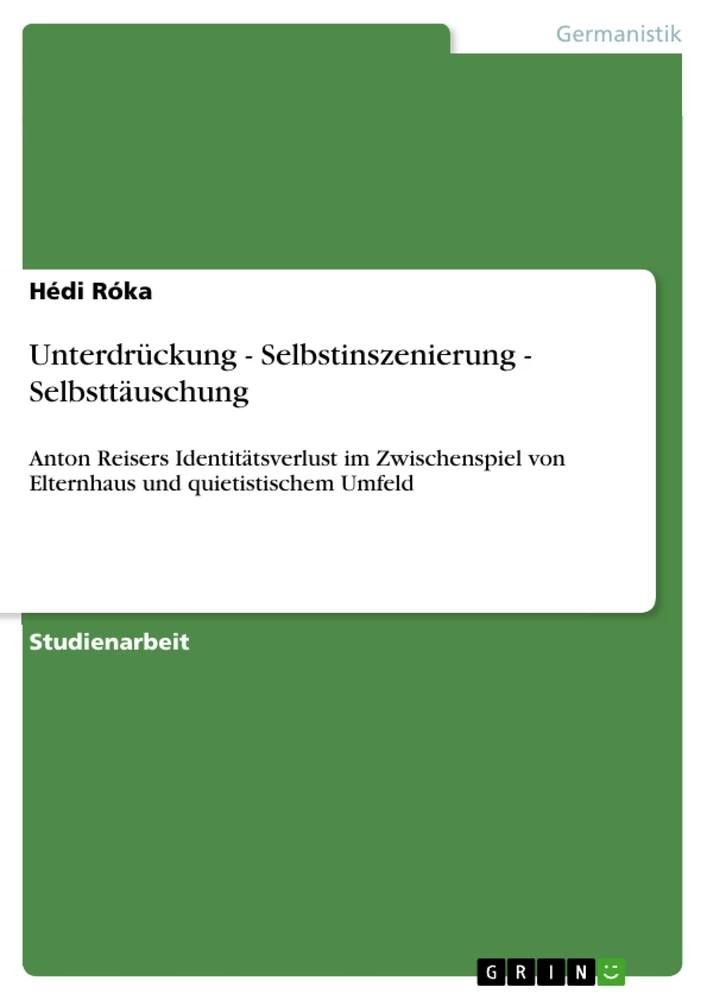Die Mystik ist „ohne festen Grund“, weil sie „über einem Abgrunde schwebt und gaukelt […], woran zu zarte Gemüter sich gern festhalten mögen, weil sie durch das gröbere Irdische sich durchzuarbeiten scheuen; weil sie von der Menschenmasse gedrückt werden, und nun auf einmal ganz isolirt, in einer schönen Einsamkeit sich wieder finden.“
Karl Philipp Moritz (Gnothi Sauton)Bei der Lektüre von Karl Philipp Moritz’ psychologischem Roman ‚Anton Reiser’ scheinen die Erfahrungen, die die Hauptfigur Anton in seiner Kindheits- und Jugendphase macht, als Hauptursache für seine spätere Entwicklung und Lebenshaltung. Mit Moritz’ Worten:
„[…] die Erinnerungen aus Anton Reisers frühesten Kinderjahren waren es vorzüglich, die seinen Charakter und zum Theil auch seine nachherigen Schicksale bestimmt haben.“
Die empirischen Bedingungen in Anton Reisers Milieu und seine Erziehung werden als Folge für die Herausbildung seiner Individualität dargestellt. Die innere Geschichte Antons, wird demnach als Produkt der Umstände geschildert, die seine Persönlichkeit im Laufe seines Lebens prägen und konstituieren.
Zu diesen „Erinnerungen aus Anton Reisers frühesten Kinderjahren“ ist beispielsweise die unglückliche, von häufigen Auseinandersetzungen geprägte, Beziehung von Antons Eltern zu nennen. Da das Ehepaar Reiser zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, kann es ihrem gemeinsamen Kind, die nötige Liebe nicht geben, was wiederum dazu führt, dass Anton sich vernachlässigt und unterdrückt fühlt.
Den Ursprung der Streitigkeiten zwischen Antons Eltern bildet der quietistische Zirkel um einen Herrn von F., zu dessen Anhängern auch Antons Vater gehört.
Die Quietisten werden im ‚Anton Reiser’ als Sekte dargestellt, die seelisch schwache Menschen anzieht und sie wie Marionetten beherrscht. Sie zieht aber nicht nur ‚seelenkranke’ Menschen an, sondern bringt auch solche hervor, wie es weiter unten am Beispiel Anton Reisers ersichtlich werden wird.
Meiner Ansicht nach, sind die bereits aufgeführten Komponenten (Antons Elternhaus und der Quietistenzirkel in Pyrmont) die Wesentlichsten für Antons Persönlichkeitsentwicklung, denn am Ende des Textes erscheint Anton als ‚verlorene Seele’, die vergebens ihren Weg sucht, überall aneckt und Enttäuschungen erleidet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Quietismus - Historischer Hintergrund
- Die Quietistengemeinde im "Anton Reiser"
- Das Entwicklungssystem Unterdrückung – Selbstinszenierung - Selbsttäuschung
- Unterdrückung
- Selbstinszenierung
- Selbsttäuschung
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychologischen Entwicklung der Hauptfigur Anton im Roman "Anton Reiser" von Karl Philipp Moritz. Die Analyse fokussiert auf die Rolle der Quietistengemeinde und die Auswirkungen der Unterdrückung, Selbstinszenierung und Selbsttäuschung auf Antons Identitätsbildung.
- Die Rolle des Quietismus in Antons Kindheit und Jugend
- Die Auswirkungen der Unterdrückung durch Antons Eltern
- Antons Mechanismen der Selbstinszenierung und Selbsttäuschung
- Die Verbindung zwischen Antons Entwicklung und der quietistischen Lehre
- Die Folgen des quietistischen Einflusses auf Antons Persönlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Romans "Anton Reiser" ein und stellt die zentrale Frage nach den Ursachen für Antons spätere Entwicklung und Lebenshaltung.
Kapitel 2 beleuchtet den Begriff des Quietismus und seine historische Entwicklung, von der griechischen Kirche im 14. Jahrhundert bis zur Ausbreitung in Westeuropa durch Miguel de Molinos und Jeanne Marie Guyon.
Kapitel 3 fokussiert auf die Rolle der Quietistengemeinde im Roman "Anton Reiser" und stellt sie als eine Sekte dar, die seelisch schwache Menschen anzieht und sie wie Marionetten beherrscht.
Kapitel 4 behandelt das Entwicklungssystem aus Unterdrückung, Selbstinszenierung und Selbsttäuschung, das sich in Antons Lebensgeschichte zeigt. Die quietistische Lehre der Madame Guyon bildet dabei die Grundlage für Antons Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von "Anton Reiser" im Kontext des Quietismus. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Unterdrückung, Selbstinszenierung, Selbsttäuschung, Identitätsentwicklung, Quietismus, quietistische Gemeinde, Madame Guyon, Anton Reiser, Karl Philipp Moritz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Analyse von „Anton Reiser“?
Die Arbeit untersucht die psychologische Entwicklung der Hauptfigur Anton unter dem Einfluss von Unterdrückung, Selbstinszenierung und Selbsttäuschung.
Welche Rolle spielt der Quietismus im Roman?
Der Quietismus wird als eine religiöse Sekte dargestellt, die Antons Vater angehört und die durch ihre Lehren maßgeblich zur seelischen Deformation Antons beiträgt.
Wie beeinflusst das Elternhaus Antons Persönlichkeit?
Die mangelnde Liebe und ständigen Auseinandersetzungen der Eltern führen dazu, dass Anton sich vernachlässigt fühlt und Mechanismen zur Flucht aus der Realität entwickelt.
Was versteht man unter „Selbstinszenierung“ bei Anton Reiser?
Es beschreibt Antons Versuch, seine innere Leere und Unterdrückung durch das Einnehmen künstlicher Rollen und das Träumen von einer glanzvollen Identität zu kompensieren.
Wer war Madame Guyon im Kontext dieser Arbeit?
Jeanne Marie Guyon war eine Vertreterin des Quietismus, deren Schriften und Lehren als Grundlage für das im Roman beschriebene religiöse Milieu dienen.
Warum wird Anton als „verlorene Seele“ bezeichnet?
Weil er aufgrund seiner traumatischen Kindheit und der religiösen Beeinflussung unfähig ist, eine stabile Identität zu entwickeln und in der Gesellschaft Fuß zu fassen.
- Citation du texte
- Hédi Róka (Auteur), 2007, Unterdrückung - Selbstinszenierung - Selbsttäuschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93832