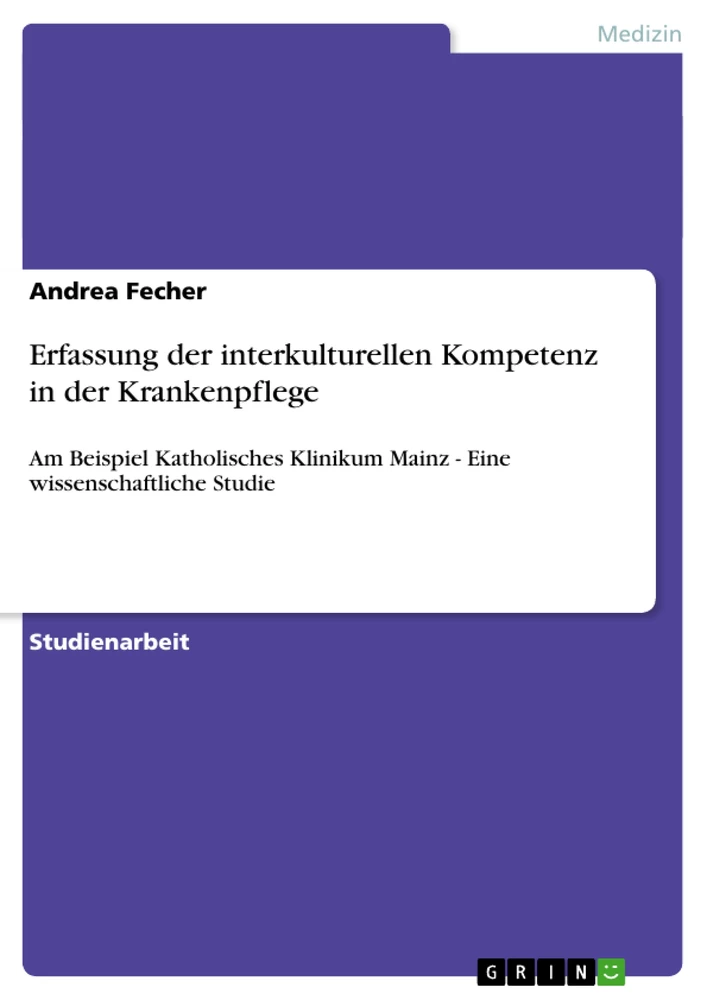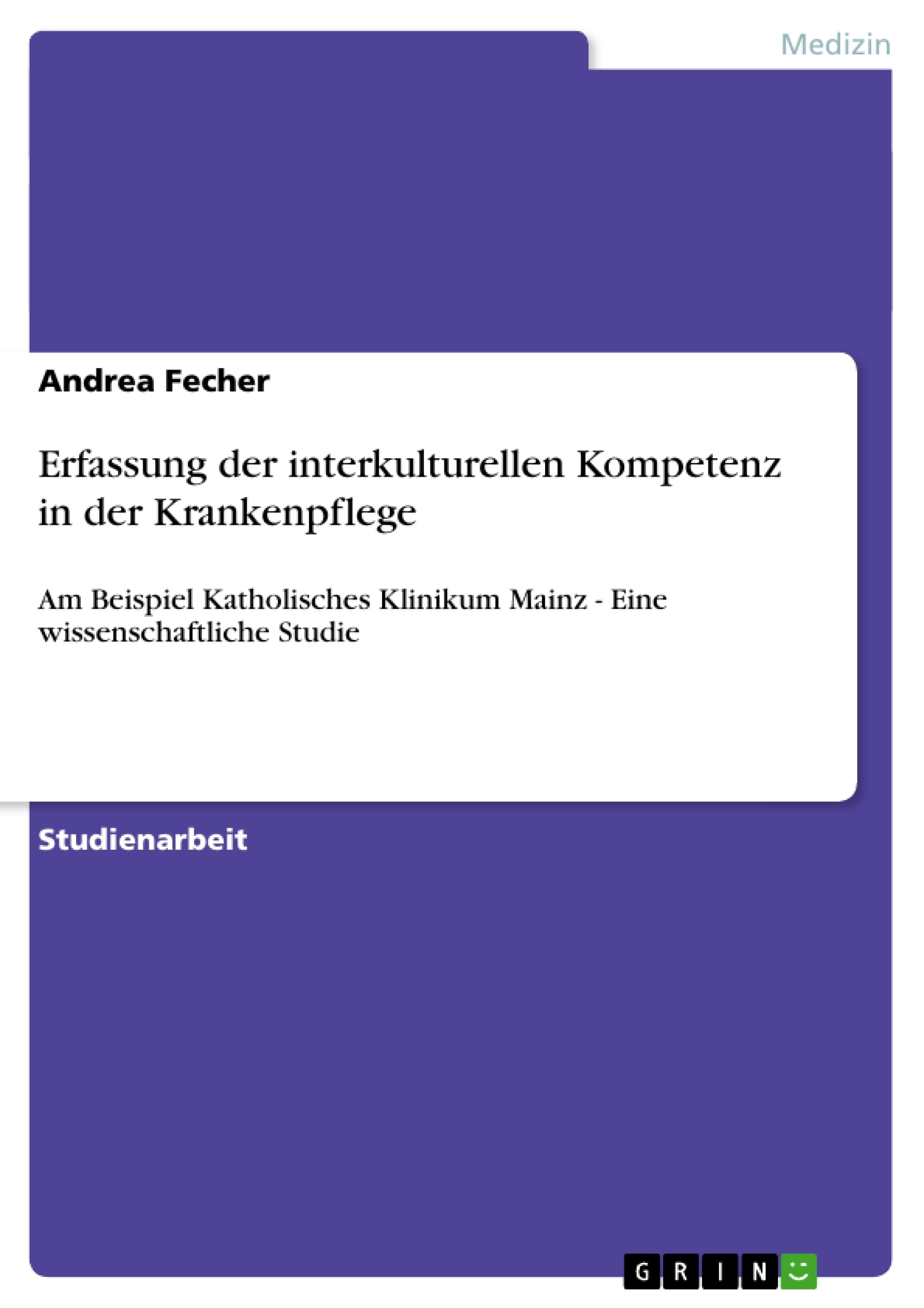Migration und Globalisierung haben seit ca. 1955 eine zunehmend bedeutendere
Zuwanderung ausgelöst. Handelte es sich in den 50er und 60er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts überwiegend um Arbeitsmigration durch angeworbene
Arbeitskräfte, ist das Wanderungsverhalten seit Mitte der 70er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts in der Hauptsache gekennzeichnet durch
Familiennachzug, durch die politische und wirtschaftliche Situation in den
Herkunftsländern – zu nennen sind hier u.a. Asylbewerber, Flüchtlinge und
Aussiedler aus Osteuropa – sowie die Freizügigkeiten innerhalb der Europäischen
Union. Laut Statistischem Bundesamt (2007 a, S. 8)) betrug die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer der in Deutschland lebenden Ausländer und Ausländerinnen
Ende 2005 17,3 Jahre. Ein Drittel von ihnen lebt bereits seit über 20 Jahren hier.
Die im Juni 2006 veröffentlichte kleine Volkszählung (Mikrozensus 2005) fragte
danach, wie viele Bürger mit deutschem Pass geografisch nicht deutscher
Herkunft sind, also selbst eingewandert sind oder von Einwanderern abstammen.
Dem Ergebnis zu Folge leben derzeit in Deutschland 15,3 Mio. Menschen mit
Migrationshintergrund (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT, 2007 a, S. 3).
Deutschland hat sich somit zu einer multikulturellen Gesellschaft entwickelt.
Diese Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung haben Einfluss auf
das Gesundheitssystem. Die Zahl der Migranten und Migrantinnen als Kunden im
Gesundheitswesen nimmt rasch zu. In Zeiten einer zunehmenden Ökonomisierung
und eines zunehmenden Konkurrenzdruckes nehmen Migranten als (potentielle)
Kunden keinen unwesentlichen Platz ein. In Regionen mit einem hohen
Migrantenanteil in der Bevölkerung wird sich eine interkulturelle Orientierung
schon bald als zukunftssichernd erweisen. Der rasante Anstieg ist einerseits
begründet durch die Verschiebung der Altersstrukturen innerhalb der
Migrantenbevölkerung. Laut Prognose des Statistischen Bundesamtes wird die
Zahl der über 60-jährigen Personen mit ausländischer Herkunft bis 2010 auf 1,3
Mio. und bis 2030 auf 2,8 Mio. anwachsen (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT,
2007 a, S. 7). Gerade ältere Ausländer weisen ein, durch jahrelange schwere und
belastende Arbeitsbedingungen hervorgerufenes, erhöhtes Risikoprofil auf.
Dadurch kann eine hohe Hilfs- und Pflegebedürftigkeit vorausgesagt werden.
Andererseits verzeichnen in der klinischen Versorgung die Bereiche Gynäkologie
/ Geburtshilfe, sowie Pädiatrie einen sehr hohen Anteil an Migranten als Kunden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHE KONZEPTE
- KULTUR
- Kulturdefinition
- Kulturstandards
- Kulturdimensionen
- Kulturelle Überschneidungssituationen
- INTERKULTURELLE KOMPETENZ
- AUSGANGSSITUATION UND ZIELE DER BEFRAGUNG
- MIGRANTINNEN IN DER GYNÄKOLOGIE / GEBURTSHILFE
- DAS PFLEGEPERSONAL
- ZIELE DER STUDIE
- FRAGEBOGENKONSTRUKTION
- AUSWAHL DER METHODE
- FRAGEBOGENBESTANDTEILE UND ITEMAUSWAHL
- Demografische Fragen und Selbstauskunft
- Wissensfragen
- Situative Fragen
- FORMULIERUNG DER FRAGEN
- PRETEST
- GÜTEKRITERIEN
- Reliabilität
- Validität
- Objektivität
- DURCHFÜHRUNG DER MITARBEITERBEFRAGUNG
- UNTERSTÜTZUNG DURCH DAS DIREKTE UMFELD
- DAS UNTERSUCHUNGSFELD
- VOLLERHEBUNG
- RÜCKLAUFSTEIGERUNG
- AUSWERTUNG UND AUFBEREITUNG DER DATEN
- DESKRIPTIVE AUSWERTUNG
- GRAFISCHE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE UND INTERPRETATION
- EMPFEHLUNGEN
- KRITISCHE AUSEINANDERSETZUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Studie befasst sich mit der Erfassung der interkulturellen Kompetenz im Pflegepersonal des Katholischen Klinikums Mainz. Der Fokus liegt dabei auf der gynäkologischen / geburtshilflichen Abteilung, wo ein hoher Anteil an Migrantinnen als Patientinnen zu verzeichnen ist. Das Ziel ist es, die aktuelle interkulturelle Kompetenz des Pflegepersonals zu erfassen und damit eine Grundlage für gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen zu schaffen.
- Interkulturelle Kompetenz in der Krankenpflege
- Herausforderungen in der Pflege von Migrantinnen
- Kulturelle Unterschiede in Bezug auf Krankheit, Schmerz und Pflege
- Erarbeitung eines Fragebogens zur Messung der interkulturellen Kompetenz
- Analyse der Ergebnisse und Entwicklung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die aktuelle Situation von Migrantinnen in Deutschland und die Bedeutung von interkultureller Kompetenz in der Gesundheitsversorgung. Kapitel 1 befasst sich mit theoretischen Konzepten von Kultur und interkultureller Kompetenz. In Kapitel 2 werden die Ausgangssituation und die Ziele der Befragung im Katholischen Klinikum Mainz vorgestellt. Kapitel 3 beschreibt die Konstruktion des Fragebogens zur Erfassung der interkulturellen Kompetenz, während Kapitel 4 auf die Durchführung der Mitarbeiterbefragung eingeht. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Auswertung und Aufbereitung der Daten sowie deren grafische Darstellung.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Migrantinnen, Krankenpflege, Gynäkologie, Geburtshilfe, Gesundheitsversorgung, Fragebogen, Quantitative Forschung, Deskriptive Studie, Katholisches Klinikum Mainz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist interkulturelle Kompetenz in der Krankenpflege wichtig?
Aufgrund der multikulturellen Gesellschaft und des hohen Anteils an Migranten im Gesundheitswesen ist sie essenziell für eine qualitativ hochwertige und bedürfnisorientierte Pflege.
Welcher Fachbereich stand im Fokus der Studie im Klinikum Mainz?
Die Untersuchung konzentrierte sich auf das Pflegepersonal in der Gynäkologie und Geburtshilfe, da hier ein besonders hoher Anteil an Migrantinnen als Patientinnen zu verzeichnen ist.
Wie wurde die interkulturelle Kompetenz gemessen?
Es wurde ein Fragebogen entwickelt, der demografische Daten, Selbstauskünfte, Wissensfragen und situative (fallbezogene) Fragen enthielt.
Was sind "Kulturstandards"?
Kulturstandards sind Orientierungshilfen, die das typische Denken und Handeln einer Kulturgruppe beschreiben und dabei helfen, Überschneidungssituationen besser zu verstehen.
Welche Empfehlungen gibt die Studie für Krankenhäuser?
Sie empfiehlt gezielte Personalentwicklungsmaßnahmen, interkulturelle Trainings und eine stärkere interkulturelle Orientierung als Zukunftssicherung im Wettbewerb.
- Citar trabajo
- Andrea Fecher (Autor), 2008, Erfassung der interkulturellen Kompetenz in der Krankenpflege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93856