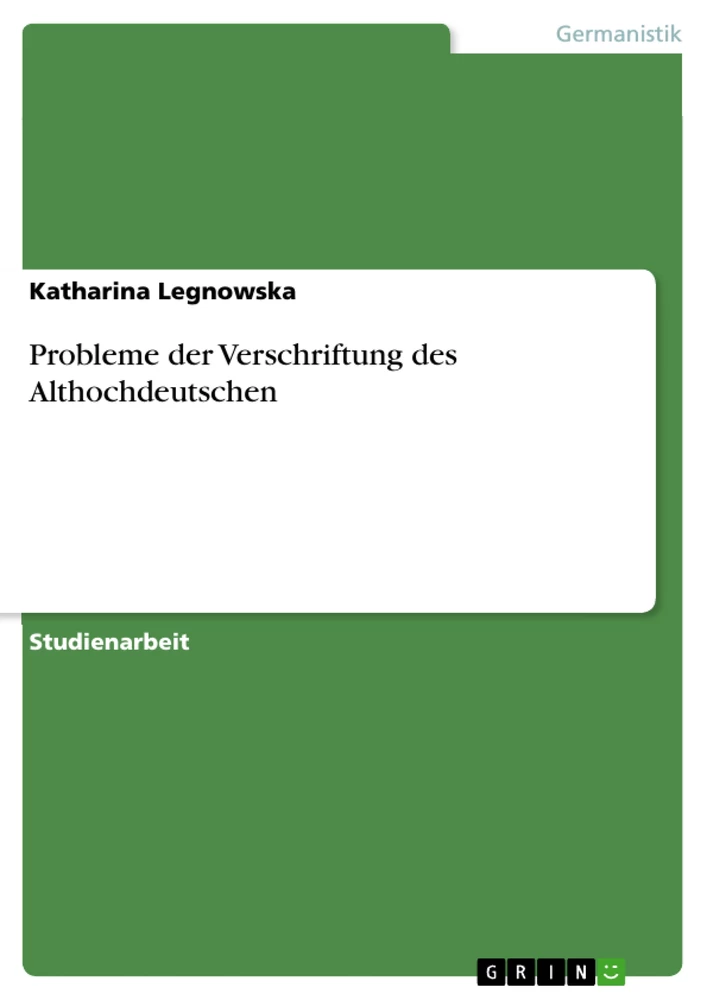Die Arbeit beschäftigt sich mit den Problemen, die im Zuge der Verschriftung des Althochdeutschen auftraten. Die schriftliche Fixierung der deutschen Sprache beginnt im achten Jahrhundert. Erste schriftliche Zeugnisse des Alt-hochdeutschen sind aus der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts überliefert, in ihnen zeigen sich die Problemfelder des Verschriftungsprozesses. Zur Aufzeichnung des Althochdeutschen verwenden die Schreiber das lateinische Alphabet. Althochdeutsch und Latein weisen einen zum Teil unterschiedlichen Phonembestand, woraus sich mannigfaltige Probleme ergeben, die in der Sekundärliteratur ein-gehend erforscht wurden.
Bereits die althochdeutschen Schreiber setzten sich mit den Schwierigkeiten der Verschriftung auseinander und einige versuchten, systematische Lösungen für die Problemfälle zu finden, wie z.B. Notker III. Notkers Anlautregel bezeichnet ein besonderes System der Schreibung, die sich nach dem Endlaut des vorangegangenen Wortes oder Teil eines Kompositums richtet.
Auch Otfrid von Weißenburg hat sich mit den Problemen der Verschriftung des Althochdeutschen explizit auseinandergesetzt und sein Evangelienbuch enthält die erste Reflexion eines althochdeutschen Schreibers über Phonologie und Gra-phematik des Althochdeutschen. Die Problemfelder des Verschriftungsprozesses und mögliche Lösungen aufzuzeigen, ist das Anliegen dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziokulturelle Voraussetzungen der Verschriftung des Althochdeutschen
- Phonologische und graphematische Problemfelder
- Aspekte des althochdeutschen Konsonantismus
- Aspekte des althochdeutschen Vokalismus
- Notkers Anlautregel
- Probleme der Verschriftung in Otfrid von Weißenburgs Evangelienbuch
- Das Evangelienbuch
- „Ad Liutbertum“ – Probleme der Schreibung des Althochdeutschen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Verschriftung des Althochdeutschen im 8. Jahrhundert. Sie beleuchtet die soziokulturellen Hintergründe dieses Prozesses und analysiert die phonologischen und graphematischen Problemfelder, die sich aus den Unterschieden zwischen dem althochdeutschen und dem lateinischen Lautsystem ergaben. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei Notkers Anlautregel und der Verschriftung in Otfrids Evangelienbuch gewidmet.
- Soziokulturelle Einflüsse auf die Verschriftung des Althochdeutschen
- Phonologische und graphematische Schwierigkeiten bei der schriftlichen Fixierung
- Analyse von Notkers Anlautregel als Lösungsansatz
- Untersuchung der Schreibpraktiken in Otfrids Evangelienbuch
- Das Verhältnis von Althochdeutsch und Latein in der Schriftkultur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die Herausforderungen der Verschriftung des Althochdeutschen im Kontext der Unterschiede zwischen dem althochdeutschen und dem lateinischen Sprachsystem. Sie hebt die Bedeutung der Schriftfixierung im 8. Jahrhundert hervor und benennt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit, insbesondere die Untersuchung der Lösungsansätze von althochdeutschen Schreibern wie Notker III. und die Analyse der Schreibpraktiken in Otfrids Evangelienbuch.
Soziokulturelle Voraussetzungen der Verschriftung des Althochdeutschen: Dieses Kapitel untersucht den soziokulturellen Kontext der Verschriftung des Althochdeutschen im Frühmittelalter. Es beleuchtet die Rolle von irischer, angelsächsischer und fränkischer Missionierung, den Aufbau von Klöstern und Domschulen, sowie die Bildungsreform Karls des Großen. Die Bedeutung der Kirche und ihre Rolle im Bildungsmonopol, die enge Verbindung zwischen lateinischer und althochdeutscher Schriftlichkeit, sowie das komplexe Verhältnis zwischen Latein als Bildungssprache und Althochdeutsch als Volkssprache werden ausführlich diskutiert. Es werden geographische Schwerpunkte der schriftlichen Überlieferung nach Dialekten benannt, wobei das Spannungsfeld zwischen lateinischer Kultursprache und der althochdeutschen Volkssprache hervorgehoben wird. Der Text verdeutlicht, wie die althochdeutschen Aufzeichnungen meist in lateinischen Kontexten überliefert wurden und lateinische Elemente in althochdeutschen Texten integriert waren, wie zum Beispiel in Otfrids Evangelienbuch.
Phonologische und graphematische Problemfelder: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den spezifischen phonologischen und graphematischen Herausforderungen bei der Verschriftung des Althochdeutschen. Es werden die Unterschiede zwischen dem althochdeutschen und dem lateinischen Phonemsystem analysiert und die daraus resultierenden Probleme bei der Darstellung der althochdeutschen Laute mit dem lateinischen Alphabet dargestellt. Die Kapitel behandeln sowohl den Konsonantismus als auch den Vokalismus und beleuchten die verschiedenen Lösungsansätze, die von den Schreibern angewendet wurden. Notkers Anlautregel wird als ein Beispiel für ein systematisches Verfahren der Schrift-Vereinheitlichung erläutert und in seinen Details analysiert.
Probleme der Verschriftung in Otfrid von Weißenburgs Evangelienbuch: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Probleme der Verschriftung, die in Otfrids Evangelienbuch, dem ersten umfangreichen althochdeutschen Text, auftreten. Es betrachtet das Evangelienbuch als einen wichtigen Beleg für die Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten der Verschriftung im Althochdeutschen. Die Analyse konzentriert sich auf die Besonderheiten der Schreibweise und die Art und Weise, wie Otfrid mit den phonologischen und graphematischen Herausforderungen umgeht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Abschnitt "Ad Liutbertum", der als Beispiel für die Schwierigkeiten der Schreibung des Althochdeutschen dient. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung dieses Textes als frühe Reflexion über Phonologie und Graphematik im Althochdeutschen.
Schlüsselwörter
Althochdeutsch, Verschriftung, Phonologie, Graphematik, Latein, Schriftlichkeit, Frühmittelalter, Kirche, Missionierung, Karl der Große, Notker III., Anlautregel, Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, Dialekte, Soziokulturelle Voraussetzungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Untersuchung der Herausforderungen bei der Verschriftung des Althochdeutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Verschriftung des Althochdeutschen im 8. Jahrhundert. Sie beleuchtet die soziokulturellen Hintergründe, analysiert phonologische und graphematische Problemfelder aufgrund der Unterschiede zwischen althochdeutschem und lateinischem Lautsystem, und widmet besondere Aufmerksamkeit Notkers Anlautregel und der Verschriftung in Otfrids Evangelienbuch.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt soziokulturelle Einflüsse auf die Verschriftung, phonologische und graphematische Schwierigkeiten, Notkers Anlautregel als Lösungsansatz, Schreibpraktiken in Otfrids Evangelienbuch und das Verhältnis von Althochdeutsch und Latein in der Schriftkultur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den soziokulturellen Voraussetzungen der Verschriftung, ein Kapitel zu phonologischen und graphematischen Problemfeldern, ein Kapitel zu den Problemen der Verschriftung in Otfrids Evangelienbuch und eine Schlussbetrachtung.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die Herausforderungen der Verschriftung im Kontext der sprachlichen Unterschiede und benennt die zentralen Forschungsfragen, insbesondere die Untersuchung der Lösungsansätze von Schreibern wie Notker III. und die Analyse der Schreibpraktiken in Otfrids Evangelienbuch.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zu den soziokulturellen Voraussetzungen?
Dieses Kapitel untersucht den soziokulturellen Kontext im Frühmittelalter, die Rolle der Missionierung, den Aufbau von Klöstern und Domschulen, die Bildungsreform Karls des Großen, die Bedeutung der Kirche, das Verhältnis von Latein und Althochdeutsch, geographische Schwerpunkte der schriftlichen Überlieferung und die Integration lateinischer Elemente in althochdeutschen Texten.
Was wird im Kapitel zu den phonologischen und graphematischen Problemfeldern behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen althochdeutschem und lateinischem Phonemsystem und die daraus resultierenden Probleme bei der Darstellung althochdeutscher Laute mit dem lateinischen Alphabet. Es behandelt Konsonantismus und Vokalismus und beleuchtet verschiedene Lösungsansätze der Schreiber, inklusive einer detaillierten Analyse von Notkers Anlautregel.
Wie wird Otfrids Evangelienbuch in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zu Otfrids Evangelienbuch analysiert die spezifischen Probleme der Verschriftung in diesem ersten umfangreichen althochdeutschen Text. Es betrachtet Schreibweisen und den Umgang Otfrids mit phonologischen und graphematischen Herausforderungen, mit besonderem Augenmerk auf den Abschnitt „Ad Liutbertum“ als Beispiel für Schreibschwierigkeiten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen Althochdeutsch, Verschriftung, Phonologie, Graphematik, Latein, Schriftlichkeit, Frühmittelalter, Kirche, Missionierung, Karl der Große, Notker III., Anlautregel, Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, Dialekte und soziokulturelle Voraussetzungen.
- Citation du texte
- M.A. Katharina Legnowska (Auteur), 2005, Probleme der Verschriftung des Althochdeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/93901