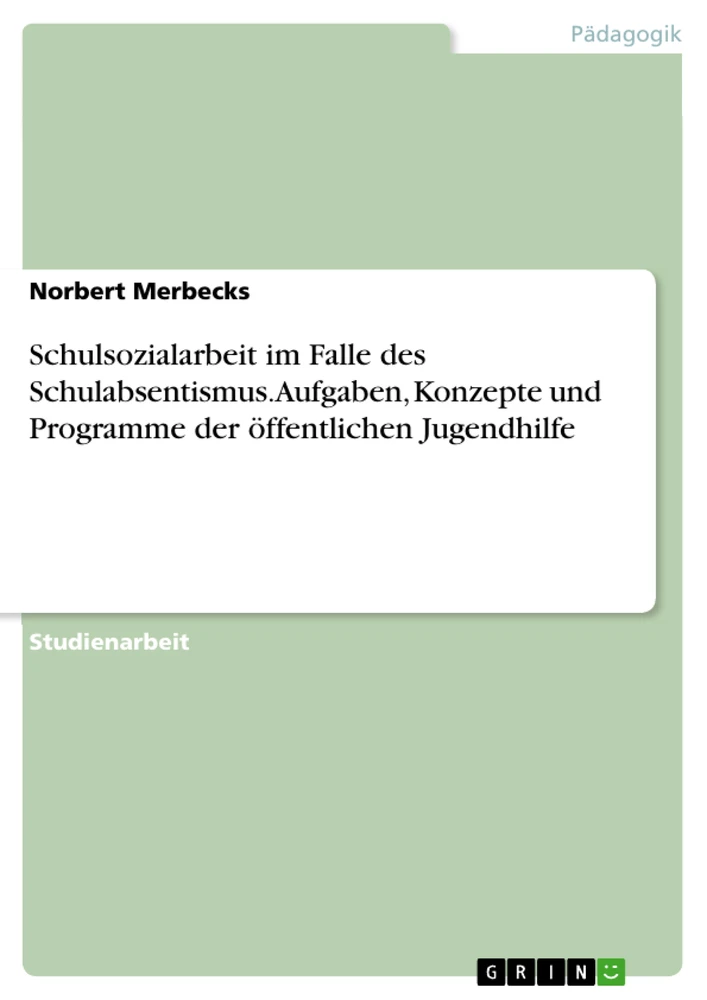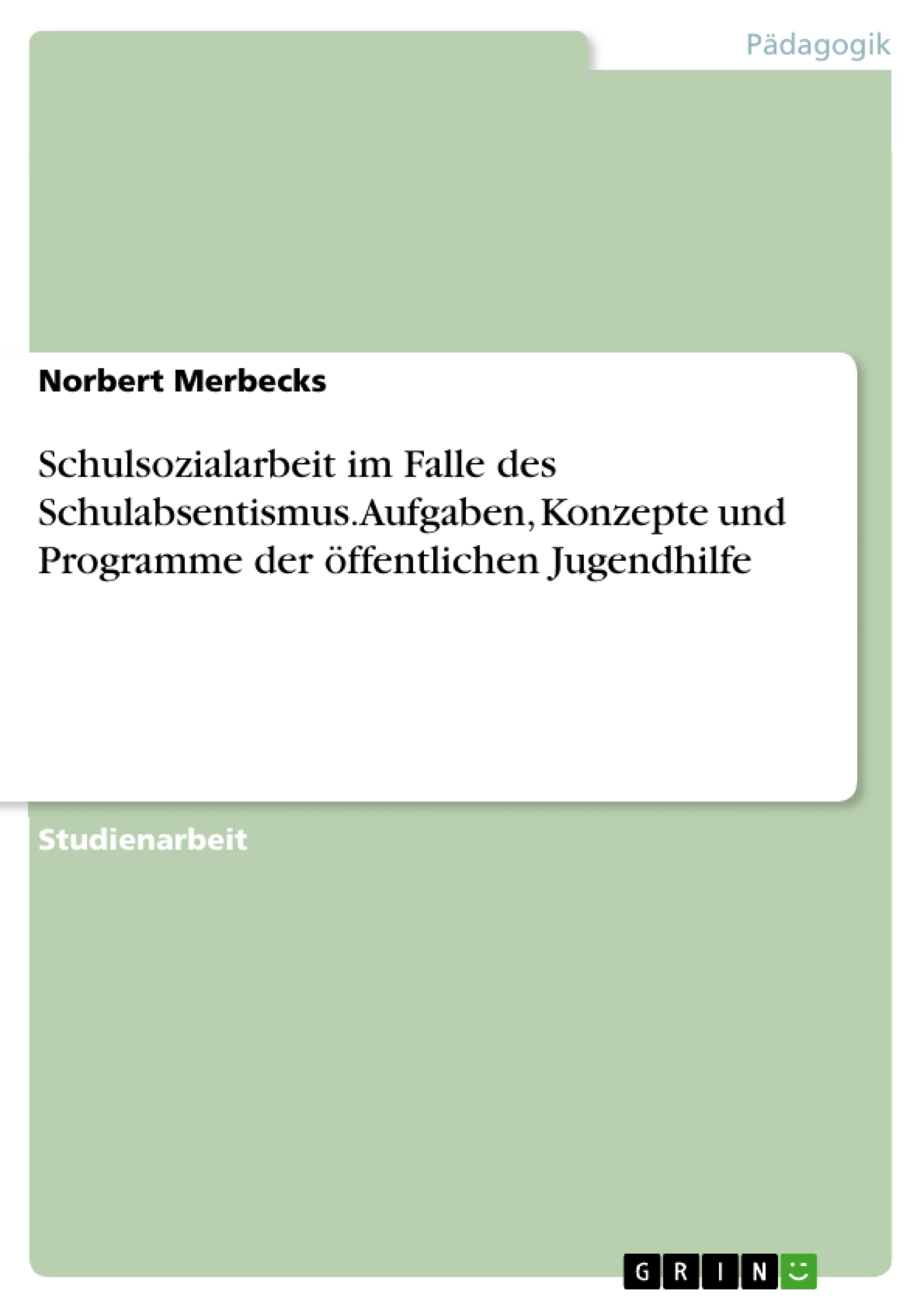Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der Schulabstinenz bei Jugendlichen. Die Schulsozialarbeit entwickelte sich maßgeblich erst nach den 1970er Jahren und erfuhr nicht erst auf Grund der Befunde der PISA Studien einen erneuten Aufschwung Mitte der 1990er Jahre.
Neben mehreren gängigen Definitionen der Schulsozialarbeit definiert Drilling die Schulsozialarbeit als „ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert.“ Hierbei wer- den Methoden der Sozialen Arbeit auf das Schulsystem übertragen. Ziel der Schulsozialarbeit ist die Begleitung des Kindes bzw. Jugendlichen im Prozess des Erwachsenwerdens. Sie soll Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, persönliche und soziale Probleme zu lösen und dazu beitragen, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
Zielgruppe der Schulsozialarbeit sind jedoch nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Lehrkräfte und Eltern, die in pädagogischen Fragen unterstützt werden sollen.
Neben der Beratung in erzieherischen Fragen, der Vermittlung zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülern, der Beratung rund um die Fragen des Kinder - und Jugendschutzes sind Schulsozialarbeiter auch damit beauftragt, dem wachsenden Schulabsentismus entgegenzuwirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung / Ausgangssituation
- Gesetzliche und strukturelle Rahmung
- Konzeptionelle und programmatische Ausrichtung der Schulsozialarbeit im Falle des Schulabsentismus
- Formen und Bedingungen des Schulabsentismus
- Schulschwänzen
- Angstbedingte Schulvermeidung/Schulverweigerung
- Bewusstes Zurückhalten durch die Eltern
- Gelegentlicher Schulabsentismus
- Massive Schulschwänzer
- (Keine) Handlungskonzepte der Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus
- Projektbeschreibung
- Zielgruppe des Projekts
- Ziele des Projekts
- Fachliche Einschätzung und kritische Würdigung
- Schlussfolgerung / Handlungsansätze
- Resümee / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Schulsozialarbeit im Kontext des Schulabsentismus. Sie analysiert die gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Jugendhilfe und beleuchtet die konzeptionelle und programmatische Ausrichtung der Schulsozialarbeit im Umgang mit Schulabsentismus. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Formen und Bedingungen des Schulabsentismus sowie die Handlungskonzepte der Schulsozialarbeit in diesem Bereich. Abschließend werden die Ergebnisse kritisch gewürdigt und Handlungsansätze für eine effektivere Intervention bei Schulabsentismus aufgezeigt.
- Gesetzliche und strukturelle Rahmenbedingungen der öffentlichen Jugendhilfe
- Konzeptionelle und programmatische Ausrichtung der Schulsozialarbeit
- Formen und Bedingungen des Schulabsentismus
- Handlungskonzepte der Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus
- Kritische Würdigung und Handlungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation dar und erläutert die Bedeutung der Schulsozialarbeit im Kontext des Schulabsentismus. Kapitel 2 beleuchtet die gesetzlichen und strukturellen Rahmenbedingungen der öffentlichen Jugendhilfe. In Kapitel 3 wird die konzeptionelle und programmatische Ausrichtung der Schulsozialarbeit im Falle des Schulabsentismus analysiert, wobei verschiedene Formen und Bedingungen des Schulabsentismus beleuchtet werden. Kapitel 4 untersucht die bestehenden Handlungskonzepte der Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus. Schlussfolgerungen und Handlungsansätze für eine effektivere Intervention bei Schulabsentismus werden in Kapitel 5 dargestellt.
Schlüsselwörter
Schulabsentismus, Schulsozialarbeit, öffentliche Jugendhilfe, Handlungskonzepte, Formen des Schulabsentismus, gesetzliche Rahmenbedingungen, kritische Würdigung, Handlungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Schulsozialarbeit bei Schulabsentismus?
Ziel ist es, Bildungsbenachteiligungen zu vermeiden, Schüler im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten und Lösungen für persönliche oder soziale Probleme zu finden.
Welche Formen von Schulabsentismus gibt es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Schulschwänzen, angstbedingter Schulverweigerung, Zurückhalten durch Eltern und gelegentlichem Absentismus.
Wer ist die Zielgruppe der Schulsozialarbeit?
Primär sind es Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrkräfte und Eltern werden in pädagogischen und erzieherischen Fragen unterstützt.
Wie kooperiert Schulsozialarbeit mit der Schule?
Sie ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das in formalisierter und institutionalisierter Form direkt im Schulsystem mitarbeitet.
Gibt es wirksame Handlungskonzepte gegen Schulverweigerung?
Die Hausarbeit analysiert bestehende Programme der öffentlichen Jugendhilfe und gibt eine fachliche Einschätzung zu deren Wirksamkeit und Schwachstellen ab.
- Citation du texte
- Norbert Merbecks (Auteur), 2020, Schulsozialarbeit im Falle des Schulabsentismus. Aufgaben, Konzepte und Programme der öffentlichen Jugendhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940581