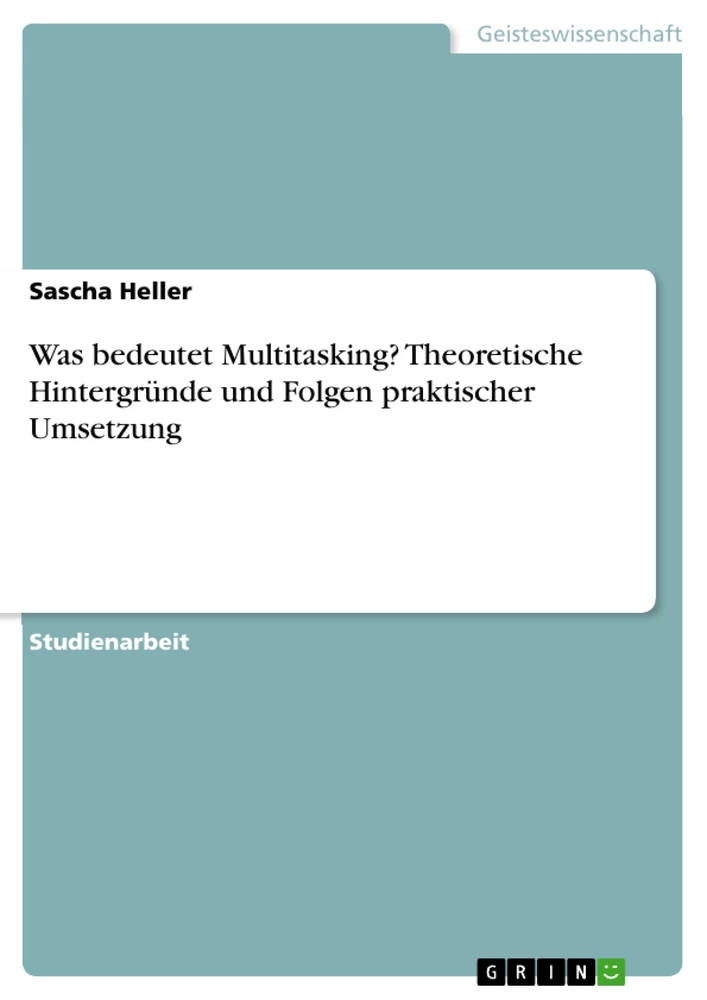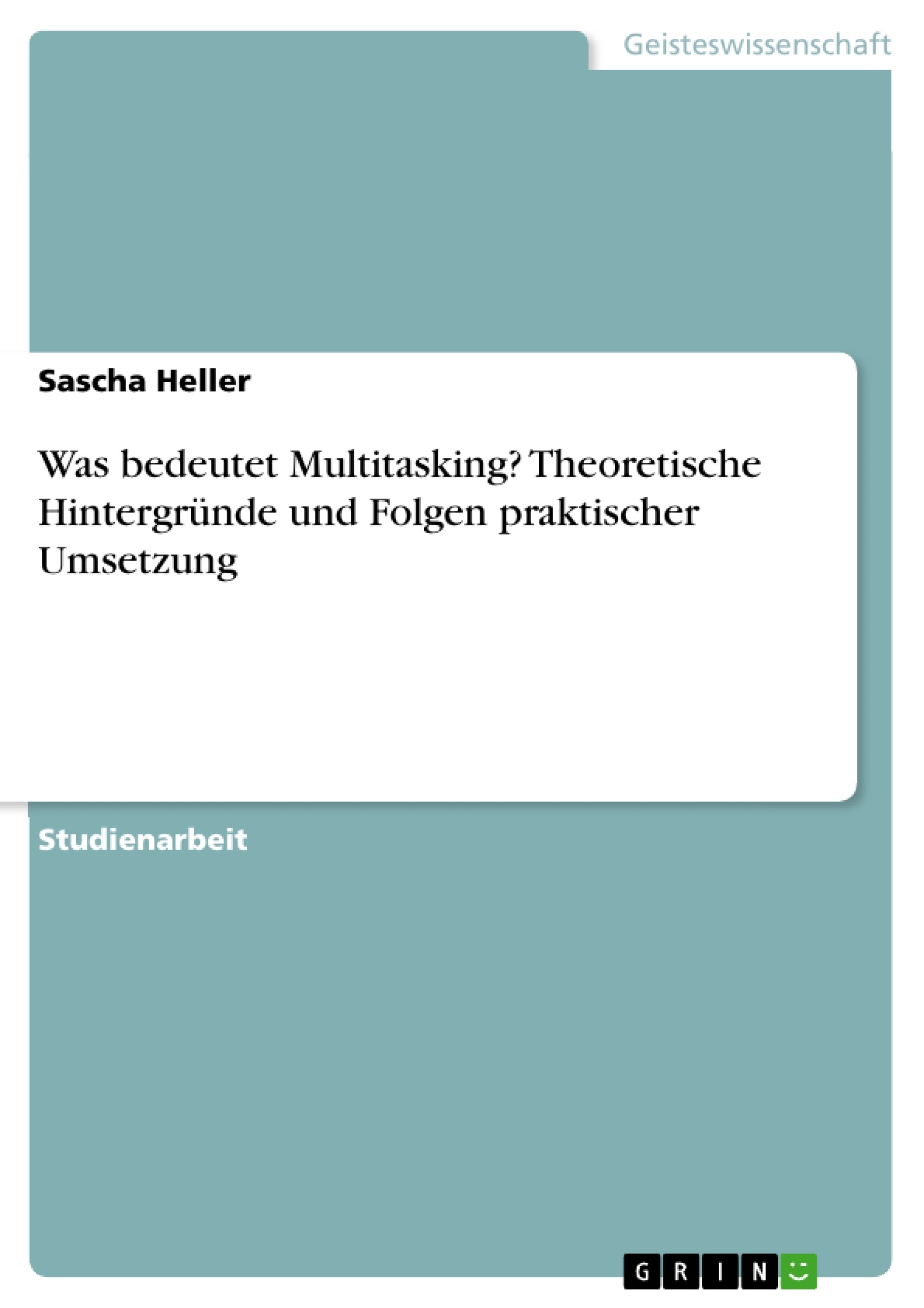Multitasking, dieser Begriff wird häufig gehört, jedoch selten verstanden. Beim Multitasking werden zwei Aufgaben gleichzeitig bearbeitet. Aber geht dies wirklich gleichzeitig vonstatten? Ist das Multitasking effizient? Diese Fragen geht die folgende Arbeit nach.
Der Begriff des Multitaskings kommt aus der IT. Jedoch springen selbst Computer zwischen mehreren Tasks (Aufgaben) hin und her. Sie erzeugen nur den Eindruck der zeit-gleichen Verarbeitung. Betrachtet man das Thema Multitasking gibt es einige interessante Aspekte zu beachten. Multitasking betrifft sowohl wirtschaftliche sowie soziale und gesundheitliche Aspekte. Somit geht Multitasking fast jeden etwas an. Diese Hausarbeit soll Klarheit über die theoretischen Hintergründe schaffen, empirische Befunde darlegen und somit auch die Relevanz des Themas aufzeigen.
Ziel der Arbeit ist zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Thema Multitasking, im weiteren Verlauf eine Darstellung des Status Quo, sowie eine Generierung von Handlungsempfehlungen. Wie erwähnt werden zunächst die theoretischen Hintergründe zum Thema Multitasking näher erläutert. Diese werden im weiteren Verlauf in die Praxis umgesetzt und mit empirischen Befunden untermauert. Um des Weiteren die Frage zu klären, was man persönlich tun kann, um sich den Folgen des Multitasking zu entziehen, werden Handlungsempfehlungen generiert. Im Diskussionsteil wird die Vorgehensweise der Arbeit kritisch hinterfragt und ein Fazit zum Thema Multitasking erstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen relevanter Begriffe
- Aufmerksamkeit
- Multitasking (Mehrfachaufgabenperformanz)
- Multitasking (Mehrfachaufgabenperformanz)
- Theoretische Modelle zum Multitasking
- Einflussfaktoren auf das Multitasking
- Theoretische Ansätze zum Multitasking
- Empirische Befunde zum Multitasking
- Theoretische Modelle zum Multitasking
- Methoden innerhalb des Praxis-Transfers
- Status Quo Studie zum Multitasking
- Studie über negative Emotionen bei Multitasking
- Abgrenzung des Themas Multitasking
- Folgen von Multitasking in der praktischen Anwendung
- Folgen des Multitasking für Personen
- Wirtschaftliche Folgen des Multitaskings
- Handlungsempfehlungen - Was tun gegen Multitasking?
- Diskussion
- Erkenntnisse aus der Multitasking Forschung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die theoretischen Grundlagen des Multitaskings, präsentiert empirische Befunde und leitet daraus Handlungsempfehlungen ab. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu schaffen und dessen Relevanz für Wirtschaft, Gesellschaft und Gesundheit aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand, beleuchtet die praktischen Folgen von Multitasking und bietet Lösungsansätze zur Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen.
- Definition und theoretische Modelle des Multitaskings
- Einflussfaktoren auf die Multitasking-Performanz
- Empirische Befunde zu den Auswirkungen von Multitasking
- Praktische Folgen von Multitasking (individuell und wirtschaftlich)
- Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Multitasking ein und stellt die Forschungsfrage nach den theoretischen Hintergründen, empirischen Befunden und praktischen Folgen von Multitasking. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die Zielsetzung: die Klärung der theoretischen Grundlagen, die Darstellung des Status Quo und die Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Folgen von Multitasking.
Definitionen relevanter Begriffe: Dieses Kapitel legt die Definitionen der zentralen Begriffe "Aufmerksamkeit" und "Multitasking" dar, bildet die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel und schafft eine gemeinsame terminologische Basis für die gesamte Arbeit. Die präzise Definition dieser Begriffe ist essenziell für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Multitasking (Mehrfachaufgabenperformanz): Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den theoretischen Modellen und empirischen Befunden zum Multitasking. Es analysiert verschiedene theoretische Ansätze, wie die Ein-Kanal-Theorie, Theorien zentraler Kapazitäten und modulare Theorien, um das Phänomen zu erklären. Die empirischen Befunde beleuchten die Auswirkungen von Multitasking auf kognitive Funktionen wie das Kurzzeitgedächtnis, das logische Denken und die Stressbelastung. Der Vergleich der theoretischen Modelle mit den empirischen Daten ist entscheidend für ein ganzheitliches Verständnis.
Methoden innerhalb des Praxis-Transfers: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Studien zum Multitasking. Es werden sowohl der Aufbau als auch die Ergebnisse von Studien zum Status Quo des Multitaskings und zu den negativen Emotionen im Zusammenhang mit Multitasking präsentiert. Die Kapitel gliedert sich in eine Status-Quo-Studie zum Multitasking, eine Studie über negative Emotionen bei Multitasking und schließlich in Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Folgen von Multitasking. Die Ergebnisse der Studien werden analysiert und ihre Bedeutung für die Ableitung von Handlungsempfehlungen herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Multitasking, Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung, kognitive Kontrolle, Stress, Handlungsempfehlungen, empirische Befunde, theoretische Modelle, Ein-Kanal-Theorie, kognitiven Ressourcen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Multitasking
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend das Phänomen des Multitaskings. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, präsentiert empirische Befunde und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Der Fokus liegt auf dem Verständnis des Multitaskings, seiner Auswirkungen auf Individuen und Wirtschaft sowie der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung negativer Folgen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende zentrale Themen: Definition und theoretische Modelle des Multitaskings, Einflussfaktoren auf die Multitasking-Performanz, empirische Befunde zu den Auswirkungen von Multitasking, praktische Folgen von Multitasking (individuell und wirtschaftlich) und Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Folgen. Die Arbeit beinhaltet auch eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Begriffen Aufmerksamkeit und Multitasking.
Welche theoretischen Modelle werden betrachtet?
Die Hausarbeit analysiert verschiedene theoretische Ansätze zum Multitasking, unter anderem die Ein-Kanal-Theorie, Theorien zentraler Kapazitäten und modulare Theorien. Diese Modelle werden im Kontext der empirischen Befunde diskutiert, um ein umfassendes Verständnis des Phänomens zu ermöglichen.
Welche empirischen Befunde werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert empirische Befunde zu den Auswirkungen von Multitasking auf kognitive Funktionen wie das Kurzzeitgedächtnis, das logische Denken und die Stressbelastung. Die Ergebnisse von Studien zum Status Quo des Multitaskings und zu den negativen Emotionen im Zusammenhang mit Multitasking werden detailliert dargestellt und analysiert.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Hausarbeit leitet aus den theoretischen und empirischen Ergebnissen konkrete Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Folgen von Multitasking ab. Diese Empfehlungen zielen darauf ab, sowohl individuelle als auch wirtschaftliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Multitasking zu bewältigen.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Definitionen relevanter Begriffe (Aufmerksamkeit und Multitasking), ein Kapitel zu theoretischen Modellen und empirischen Befunden zum Multitasking, ein Kapitel zu Methoden und Studien im Praxis-Transfer (inkl. Status Quo Studie und Studie zu negativen Emotionen), eine Diskussion der Ergebnisse und ein Fazit mit Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: Multitasking, Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung, kognitive Kontrolle, Stress, Handlungsempfehlungen, empirische Befunde, theoretische Modelle, Ein-Kanal-Theorie, kognitive Ressourcen.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für alle, die sich wissenschaftlich mit dem Thema Multitasking auseinandersetzen, sowie für Personen, die an der Optimierung von Arbeitsabläufen und der Verbesserung der individuellen Leistungsfähigkeit interessiert sind. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen sind sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft von Bedeutung.
- Quote paper
- Sascha Heller (Author), 2020, Was bedeutet Multitasking? Theoretische Hintergründe und Folgen praktischer Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/940676