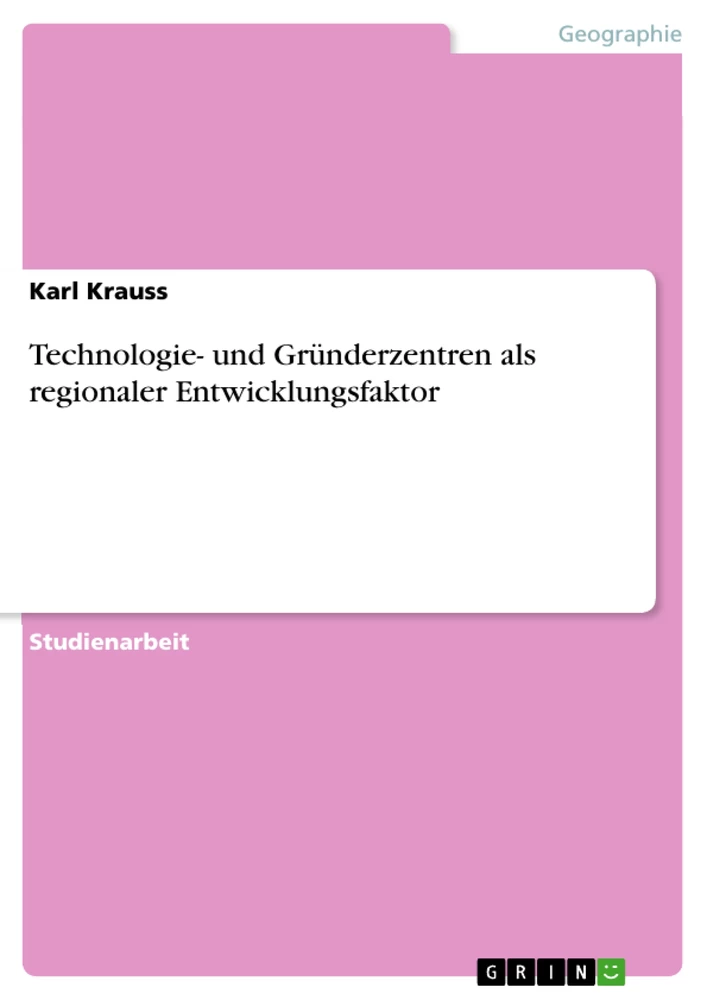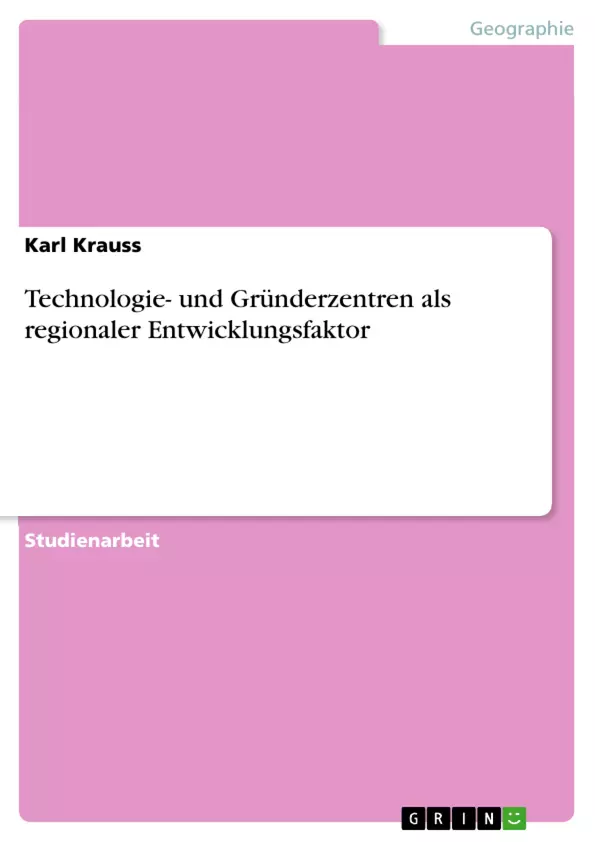Die späten siebziger und frühen achtziger Jahre des letzen Jahrhunderts sind in der BRD durch auftretende ökonomische Krisen gekennzeichnet, die eine wirtschaftliche Umorientierung der Politik auslösten. Zu den Krisenauslösern zählten vor allem die Ölpreisschocks 1973 und 1979/80 sowie die zunehmende internationale Konkurrenz amerikanischer und speziell japanischer Produkte, die in der deutschen Industrie Angst vor technologischem Rückstand verursachten (vgl. KADEN, 1991, S.79).
Die Erfolge die sich in dieser Zeit im kalifornischen „Silicon Valley“ abzeichneten führten in der BRD zu der Einsicht, dass die Entwicklung der (Hoch-) Technologiebranche zukünftig hohe Bedeutung für das gesamtwirtschaftliche Wachstum haben wird. Als Instrument der Innovations- und Gründerförderung im technologischen Bereich wurde das Konzept der „Technologie- und Gründerzentren (TGZ) „ entwickelt. Im Jahr 1983 wurde das Berliner Innovations- und Gründerzentrum (BIG)“ als erstes Technologie- und Gründerzentrum in der damaligen Bundesrepublik eröffnet. In den folgenden Jahren kam es zu einem Boom der Neueröffnungen von TGZ insbesondere in Nordrhein-Westfalen, das mit Hilfe dieses wirtschaftspolitischen Instruments versuchte auf die strukturelle Krise bzw den nahezu vollständigen Wegfall der Kohle- und Stahlindustrie zu reagieren (vgl. www.tat-zentrum.de). Ein ähnliches Konzept wurde in den neuen Bundesländern nach der Wende verfolgt. Dabei wurden der Neubau von Technologie- und Gründerzentren vom damaligen Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) im Rahmen des Modellversuches „Technologieorientierte Unternehmensgründungen in den neuen Bundesländern (TOU-NBL)“ gefördert (vgl. PLESCHAK, 1995, S.1 & FRANZ, 1996, S.26). Die Eröffnung von Technologie- und Gründerzentren ist von Seiten der Kommunen mit hohen Erwartungen und Hoffnungen, vor allem hinsichtlich wirtschaftlicher Prosperität und einem Zuwachs an Arbeitsplätzen, verbunden. Ob Technologie- und Gründerzentren tatsächlich einen Einfluss auf die regionale Wirtschaftsentwicklung haben, woran sich dieser messen lässt und welche Rolle der jeweilige Standort dabei spielt, soll in der vorliegenden Arbeit dargestellt werden.
Im folgenden Kapitel soll dabei die Konzeption der Technologie und Gründerzentren sowie deren Organisationsstruktur und Leistungsangebot aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Konzeption von Technologie- und Gründerzentren
- Grundgedanken
- Konzeption der TGZ
- Organisationsstruktur der Technologie- und Gründerzentren
- Leistungsangebot der Technologie- und Gründerzentren
- Ziele und Erwartungen hinsichtlich der Technologie- und Gründerzentren
- Ziele der Technologie- und Gründerzentren
- Erwartungen an Technologie- und Gründerzentren
- Räumliche Verteilung und quantitative Erfassung der Technologie- und Gründerzentren
- Technologie und Gründerzentren als regionaler Entwicklungsfaktor
- Förderung der Unternehmensgründungen
- Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze
- Intensivierung des Wissens- und Technologietransfers, Unterstützung der innovativen Entwicklung der Region und Verringerung räumlicher Disparitäten
- Schwächen des Konzeptes der Technologie- und Gründerzentren und dessen Umsetzung
- Das Technologie- und Gründerzentrum in Halle (Saale)
- Lage und Entstehung
- Entwicklung des Technologie- und Gründerzentrums sowie der in ihm angesiedelten Unternehmen
- Fazit und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Technologie- und Gründerzentren als regionalen Entwicklungsfaktor. Sie analysiert die Konzeption, die Ziele und die Erwartungen an diese Einrichtungen und beleuchtet deren Bedeutung für die Förderung von Unternehmensgründungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Stärkung der regionalen Innovation.
- Konzeption und Organisationsstruktur von Technologie- und Gründerzentren
- Ziele und Erwartungen an Technologie- und Gründerzentren
- Rolle von Technologie- und Gründerzentren bei der Förderung von Unternehmensgründungen
- Einfluss von Technologie- und Gründerzentren auf die regionale Entwicklung und den Technologietransfer
- Potenzielle Schwächen und Herausforderungen im Zusammenhang mit Technologie- und Gründerzentren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Problemstellung und die Relevanz des Themas Technologie- und Gründerzentren. Die Zielsetzung der Arbeit und der Aufbau werden dargelegt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Konzeption von Technologie- und Gründerzentren, einschließlich der Grundgedanken, der Organisationsstruktur und des Leistungsangebots. Im dritten Kapitel werden die Ziele und Erwartungen, die an Technologie- und Gründerzentren geknüpft sind, analysiert. Die räumliche Verteilung und die quantitative Erfassung von Technologie- und Gründerzentren werden im vierten Kapitel behandelt. Das fünfte Kapitel untersucht die Rolle von Technologie- und Gründerzentren als regionaler Entwicklungsfaktor, insbesondere ihre Bedeutung für die Förderung von Unternehmensgründungen, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und den Technologietransfer. Das sechste Kapitel beleuchtet potenzielle Schwächen des Konzeptes der Technologie- und Gründerzentren und seiner Umsetzung. Das siebte Kapitel untersucht das Technologie- und Gründerzentrum in Halle (Saale) im Hinblick auf seine Lage, Entstehung und Entwicklung. Das Fazit und die Perspektiven werden im achten Kapitel dargestellt.
Schlüsselwörter
Technologie- und Gründerzentren, Regionalentwicklung, Unternehmensgründungen, Arbeitsplatz Schaffung, Technologietransfer, Innovation, Wissensmanagement, Standortfaktoren, ökonomische Entwicklung, regionale Disparitäten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Technologie- und Gründerzentren (TGZ)?
TGZ sind Instrumente der Wirtschaftsförderung, die darauf abzielen, technologieorientierte Unternehmensgründungen durch Infrastruktur und Beratungsangebote zu unterstützen.
Wann entstand das erste TGZ in Deutschland?
Das Berliner Innovations- und Gründerzentrum (BIG) wurde 1983 als erstes Technologie- und Gründerzentrum in der damaligen Bundesrepublik Deutschland eröffnet.
Welche Ziele verfolgen Kommunen mit der Eröffnung eines TGZ?
Kommunen erhoffen sich durch TGZ wirtschaftliche Prosperität, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und eine Intensivierung des regionalen Technologietransfers.
Welche Rolle spielt der Standort für den Erfolg eines TGZ?
Der Standort ist ein entscheidender Faktor für die regionale Wirtschaftsentwicklung und beeinflusst maßgeblich, wie effektiv das Zentrum Innovationen fördern kann.
Gibt es Kritik am Konzept der Technologie- und Gründerzentren?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch potenzielle Schwächen des Konzepts und Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung in den Regionen.
- Citation du texte
- Karl Krauss (Auteur), 2007, Technologie- und Gründerzentren als regionaler Entwicklungsfaktor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94079