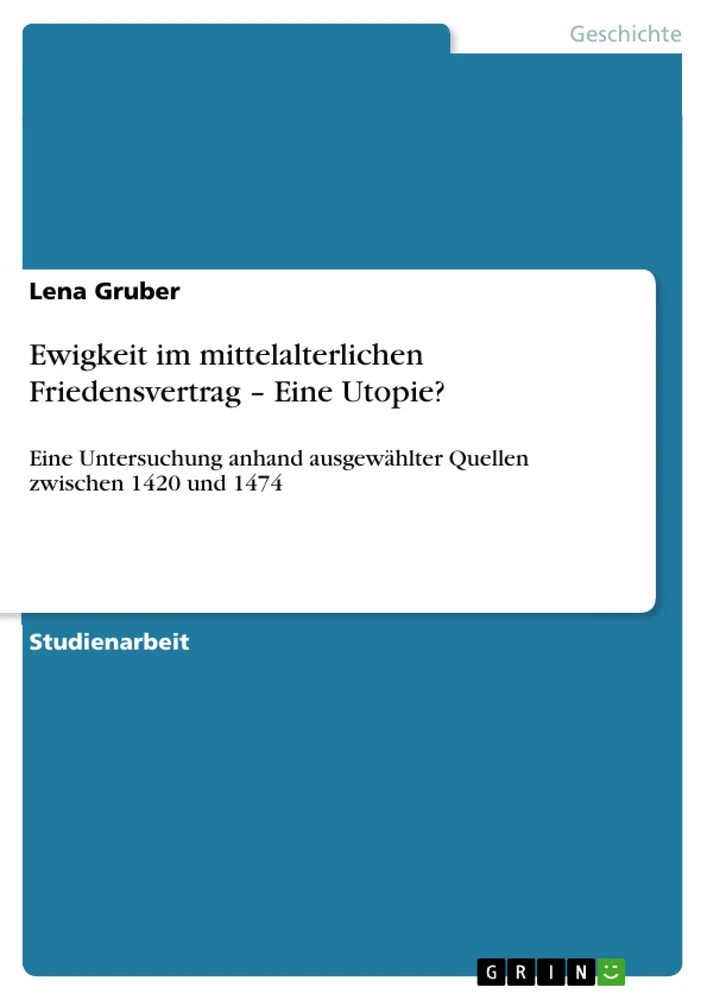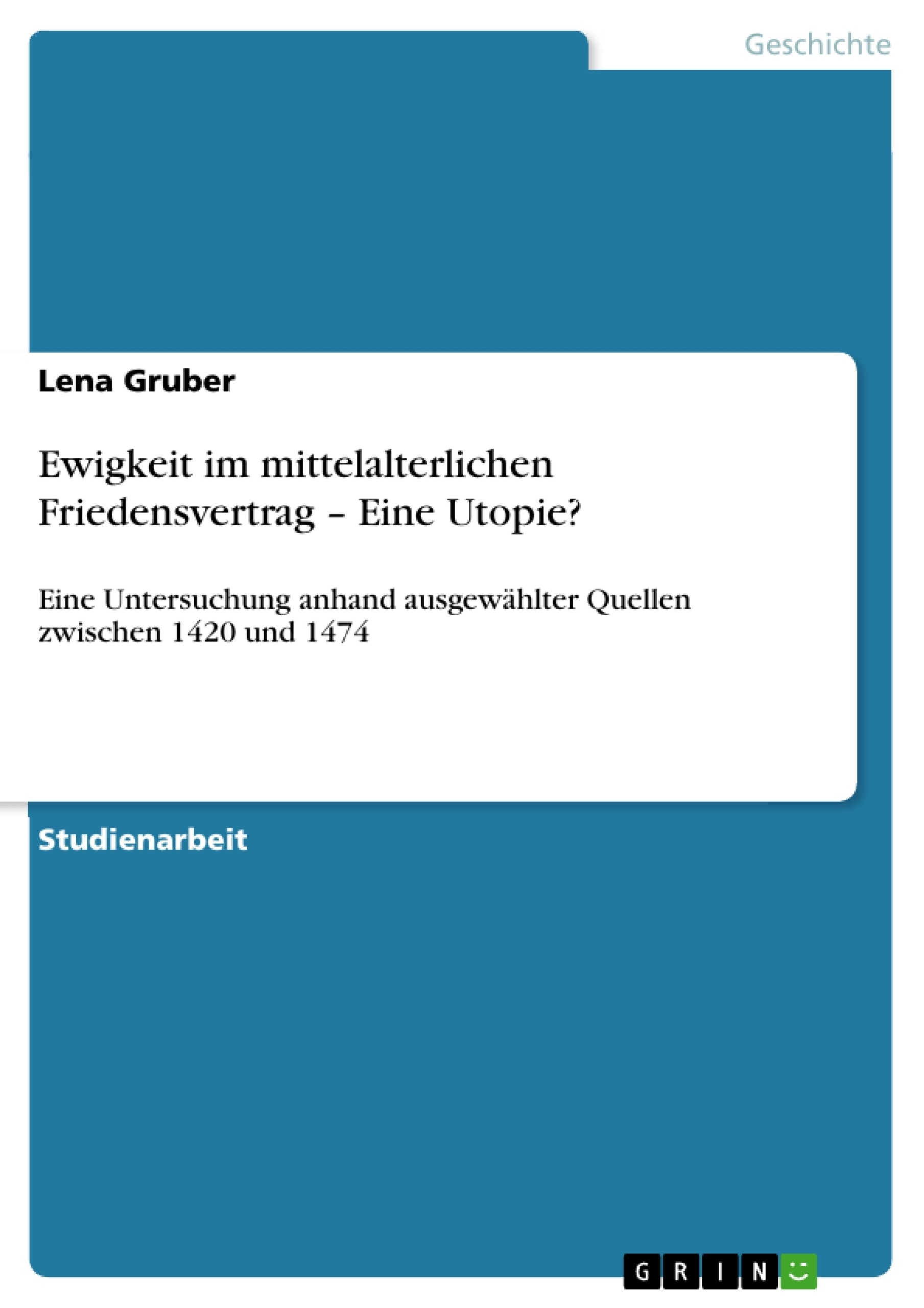Krieg und Frieden begleiten die Menschheit schon seit Anbeginn unserer Aufzeichnungen. Beides sind Zustände, wobei Krieg als eine länger andauernde, mit Waffengewalt geführte Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Parteien definiert wird. Frieden hingegen zeichnet sich durch die Abwesenheit von Gewalt aus. Zumeist wird dieser nach einer kriegerischen Handlung zwischen politischen Einheiten beschlossen und vertraglich aufgezeichnet. Bereits in der durch kriegerische Handlungen geprägten Antike wurde der Wunsch nach Frieden deutlich.
Forscher der Universität Münster legen dieser Behauptung den ältesten Friedensvertrag unserer Aufzeichnungen zugrunde. Der mehr als 3200 Jahre alte Vertrag zwischen Ägypten und Hethitern zeigt „umfangreiche Korrespondenzen zwischen den Herrschern“. An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass es sich dabei wohl um eine Ausnahme handelt, denn üblicherweise bestand die Antike aus „Siegfrieden“. Dennoch war den Menschen bereits zu dieser Zeit klar: „magnum beneficium est pax“. Die Wahrung des Friedens war von enormer Wichtigkeit, daher wurden mit dessen Ausführung Herrscher beauftragt. Im Frühmittelalter wurden Konflikte oft selbstständig gelöst, indem die beteiligten Parteien i. d. R. Gewalt anwandten. Diesem Vorgehen lag ein schwaches System der Judikative zugrunde, weshalb es oftmals zu einer Selbstjustiz kam.
Im Mittelalter wurden zunehmend Verträge zwischen den Parteien verfasst - nicht zuletzt da die Gewalt des Öfteren für die eigenen Vorteile genutzt wurde. Dabei wurden zeitliche Beschränkungen in den Vertrag integriert. Die sich im Mittelalter etablierten Veränderungen im politischen Denken haben die Friedensverträge gegenüber der Antike stark verändert. Seit dem späten Mittelalter wurde oftmals die Klausel des ewigen Friedens verwendet. Zeitliche Limitierungen waren zunehmend seltener vorzufinden. Demnach müsste das Mittelalter eine Zeit des zunehmenden Friedens gewesen sein – doch auch gab es enorm viele Kriegshandlungen. In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwiefern und ob die Ewigkeitsklausel bestand hatte und tatsächlich dazu beitrug, den Frieden zu wahren.
Inhaltsverzeichnis
- Die Entwicklung des Friedensvertrags
- Die Ewigkeitsklausel in Friedensverträgen
- Die Auswahl der untersuchten Friedensverträge
- Friede auf ewig? Die Termini perpetuus und aeternus
- Die Friedensverträge
- 1420 Mai 21, Vertrag von Troyes
- 1444 Juni 27, Vertrag zwischen England und Frankreich
- 1444 Oktober 28, Vertrag von Ensisheim
- 1474 Februar 18, Vertrag von Utrecht
- Ein Vergleich der Verträge
- Ewigkeit im mittelalterlichen Friedensvertrag – Eine Utopie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die im Spätmittelalter häufig verwendete Klausel des ewigen Friedens tatsächlich zu einem dauerhaften Frieden führte. Die Untersuchung konzentriert sich auf vier ausgewählte Friedensverträge aus dem lateinischen Kulturkreis Europas, die zwischen 1420 und 1474 geschlossen wurden. Dabei wird die Ewigkeitsklausel in ihren historischen, sprachlichen und juristischen Kontexten analysiert.
- Die Bedeutung der Ewigkeitsklausel in mittelalterlichen Friedensverträgen
- Die sprachliche Analyse der Termini "perpetuus" und "aeternus" im Kontext des Friedens
- Die historischen und politischen Hintergründe der untersuchten Verträge
- Der Vergleich der einzelnen Vertragsklauseln und deren tatsächliche Wirkung
- Die Rolle des mittelalterlichen Völkerrechts (ius gentium) im Kontext der Friedensverträge
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Entwicklung des Friedensvertrags: Dieses Kapitel stellt die historische Entwicklung des Friedensvertrags dar, ausgehend von der Antike bis hin zum Mittelalter. Es wird erläutert, wie der Wunsch nach Frieden sich im Laufe der Zeit gewandelt hat und welche Faktoren die Entstehung der Ewigkeitsklausel im Spätmittelalter beeinflusst haben.
- Kapitel 1.1: Die Ewigkeitsklausel in Friedensverträgen: Hier wird die Frage nach der Bedeutung der Ewigkeitsklausel im Kontext mittelalterlicher Friedensverträge gestellt. Es wird analysiert, ob die Klausel tatsächlich einen dauerhaften Frieden garantierte oder lediglich ein politisches Instrument zur Stabilisierung der Machtverhältnisse darstellte.
- Kapitel 1.2: Die Auswahl der untersuchten Friedensverträge: In diesem Kapitel werden die Kriterien für die Auswahl der vier untersuchten Verträge vorgestellt. Es werden der zeitliche Rahmen, die sprachliche Besonderheit der lateinischen Verträge und die räumliche Einschränkung auf den lateinischen Kulturkreis Europas erläutert.
- Kapitel 2: Friede auf ewig? Die Termini perpetuus und aeternus: Dieses Kapitel beleuchtet die sprachliche Bedeutung der Termini "perpetuus" und "aeternus" im Kontext der Ewigkeitsklausel. Es wird gezeigt, dass die deutschen Übersetzungen von "ewig" nicht immer mit den ursprünglichen lateinischen Begriffen übereinstimmen und die genaue Bedeutung der Klausel im jeweiligen Vertragskontext untersucht werden muss.
- Kapitel 3: Die Friedensverträge: In diesem Kapitel werden die vier ausgewählten Verträge (Troyes, Ensisheim, Vertrag zwischen England und Frankreich, Utrecht) vorgestellt. Die Analyse konzentriert sich auf die jeweiligen Vertragsbedingungen, die historischen Hintergründe und die Bedeutung der Ewigkeitsklausel im jeweiligen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Friedensvertrag, Ewigkeitsklausel, perpetuus, aeternus, mittelalterliches Völkerrecht, ius gentium, Spätmittelalter, lateinischer Kulturkreis, historische Analyse, sprachliche Analyse, Vertragsinterpretation und die historische Entwicklung des Friedensgedankens im europäischen Kontext.
- Quote paper
- Lena Gruber (Author), 2019, Ewigkeit im mittelalterlichen Friedensvertrag – Eine Utopie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941359