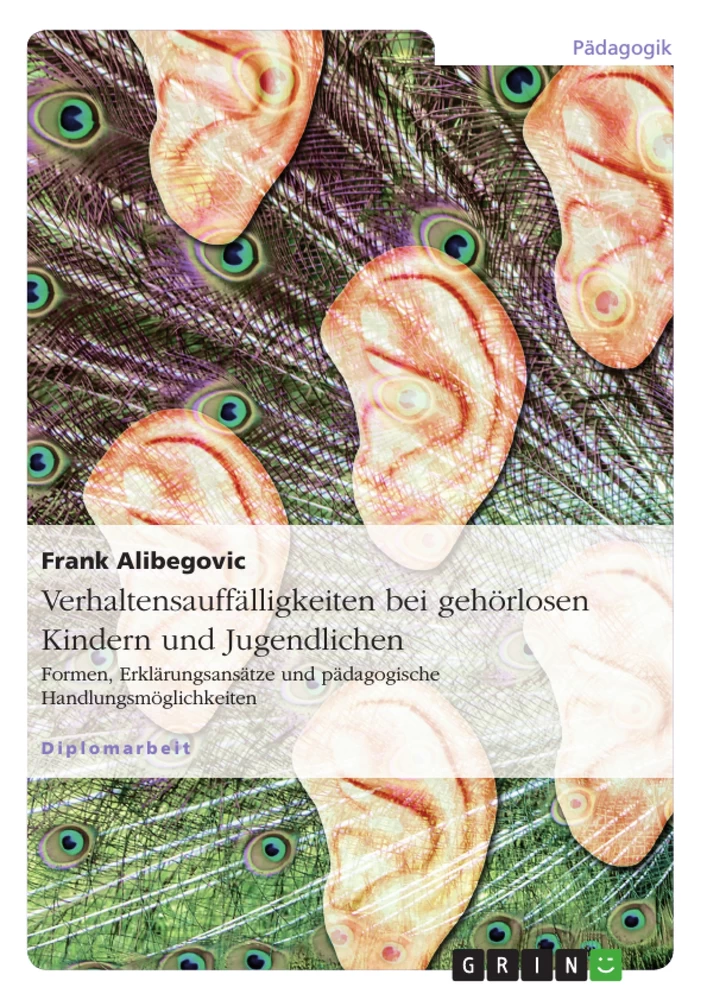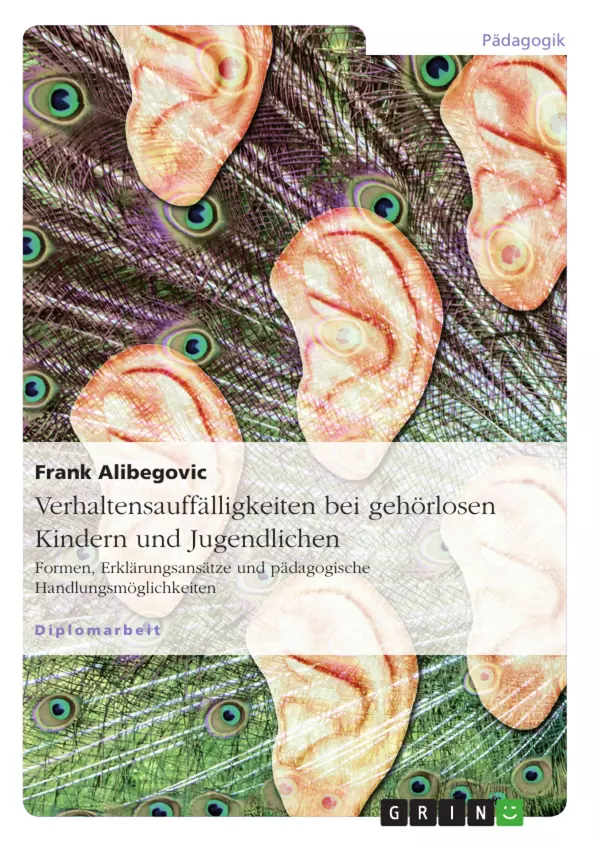Wissenschaftler und Praktiker der Hörgeschädigtenpädagogik stellen fest, dass gehörlose Kinder und Jugendliche immer häufiger zusätzliche Schwierigkeiten haben - im Besonderen Verhaltensauffälligkeiten. Dieser Umstand tritt bei Gehörlosen anscheinend häufiger auf als in einer vergleichbaren Gruppe mit Kindern ohne Hörschädigung.
Durch die veränderten Bedingungen entsteht für Lehrer, Erzieher und andere Personen, die in diesem Bereich tätig sind, notwendigerweise auch eine veränderte Anforderung an das Arbeiten mit diesen Kindern und Jugendlichen. Für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit ist es hierbei notwendig, dass sich der Praktiker sowohl mit der Hörgeschädigten- als auch mit der Verhaltensgestörtenpädagogik beschäftigt und die jeweiligen Ansätze und Vorgehensweisen miteinander abgleicht.
Die vorliegende Arbeit möchte sich bei dem „Methodenstreit“ über die richtige Förderung von gehörlosen Kindern und Jugendlichen innerhalb der Hörgeschädigtenpädagogik weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen. Weder die Förderung mit Lautsprache noch die mit Gebärdensprache kann für den gesamten Bereich der Hörgeschädigtenpädagogik als „der“ richtige Weg bezeichnet und gefordert werden.
Vielmehr ist es angebracht, genau diejenige Vorgehensweise zu favorisieren, die für das jeweilige Kind die optimale Ausnutzung seiner Möglichkeiten darstellt. Anders formuliert: Ressourcenorientiertes Denken und Handeln ist angebracht.
In Kapitel 2 werden zunächst die elementaren Begriffe Verhaltensauffälligkeit und Gehörlosigkeit differenziert erläutert, bevor in Kapitel 3 die erwähnte Beobachtung zur (steigenden) Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen auf seine Richtigkeit überprüft wird. Hierzu werden die Ergebnisse einiger empirischer Studien zusammenfassend dargestellt. Außerdem wird gezeigt, ob es bestimmte gehörlosentypische Verhaltensauffälligkeiten gibt. Danach wird in Kapitel 4 analysiert, welche Erklärungen es für die Auffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen gibt. Es werden dabei sowohl Risikofaktoren auf der Seite des Kindes, Ursachen, die sich eher den Eltern zuordnen lassen, als auch Bedingungen, auf Seiten von Fachleuten berücksichtigt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Begriffe
- 2.1 Verhaltensauffälligkeit
- 2.1.1 Einteilungen
- 2.1.2 Häufigkeit
- 2.1.3 Ursachen und Handlungsmöglichkeiten
- 2.2 Gehörlosigkeit
- 2.2.1 Einteilungen
- 2.2.1.1 Nach Ausmaß
- 2.2.1.2 Nach Art
- 2.2.1.3 Nach Kulturzugehörigkeit
- 2.2.2 Häufigkeit
- 2.2.3 Ursachen
- 2.2.4 Förderungsmöglichkeiten
- 2.2.4.1 Medizinisch-technische Förderung
- 2.2.4.2 Auditiv-verbale Förderung
- 2.2.4.3 Bilinguale Förderung
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. Formen
- 3.1 Häufigkeit von Auffälligkeiten bei Gehörlosen
- 3.1.1 Gehörlose mit Mehrfachbehinderungen
- 3.1.2 Gehörlose mit Verhaltensauffälligkeiten
- 3.2 Arten der Verhaltensauffälligkeiten
- 3.3 Zusammenfassung
- 4. Erklärungsansätze
- 4.1 Ansatzpunkt Kind
- 4.1.1 Was ist Sprache?
- 4.1.1.1 Die Bedeutung von Sprache
- 4.1.1.2 Der Aufbau von Sprache
- 4.1.2 Gehörlose Kinder und Lautsprache
- 4.1.2.1 Der Lautspracherwerb in seinem zeitlichen Verlauf
- 4.1.2.2 Schwierigkeiten des Lautspracherwerbs für das gehörlose Kind
- 4.1.3 Folgen der reduzierten Kommunikationsfähigkeit
- 4.2 Ansatzpunkt Eltern
- 4.2.1 Beziehungsstörung und mangelnde Akzeptanz
- 4.2.2 Ungünstiges Erziehungsverhalten
- 4.3 Ansatzpunkt Fachleute
- 4.3.1 Reduktion auf Kommunikation und Identität
- 4.3.2 Falsche Zuschreibung wegen ungenügender Kulturkenntnis
- 4.4 Zusammenfassung
- 5. Pädagogische Handlungsmöglichkeiten
- 5.1 Ansatzpunkt Kind
- 5.1.1 Adäquate Möglichkeiten der Kommunikation eröffnen
- 5.1.2 Training sozialer Kompetenzen
- 5.1.2.1 Konstruktiver Umgang mit der Gehörlosigkeit
- 5.1.2.2 Kiosk-Projekt
- 5.1.3 Gehörlose Personen in den Erfahrungskontext einbeziehen
- 5.2 Ansatzpunkt Eltern
- 5.2.1 Akzeptanz fördern
- 5.2.2 Netzwerke bilden und Belastbarkeit stärken
- 5.2.2.1 Erfahrungsaustausch unter betroffenen Eltern
- 5.2.2.2 Familienentlastende Dienste (FED)
- 5.2.2.3 Kontakt zu gehörlosen Bezugspersonen herstellen
- 5.3 Ansatzpunkt Fachleute
- 5.3.1 Leiblichkeit er- und anerkennen
- 5.3.2 Interkulturalität als Norm des pädagogischen Handelns
- 5.4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, die Formen dieser Auffälligkeiten zu beschreiben, mögliche Erklärungsansätze zu beleuchten und pädagogische Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt dabei die verschiedenen Perspektiven des Kindes, der Eltern und der Fachkräfte.
- Formen von Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern
- Erklärungsansätze für diese Verhaltensauffälligkeiten aus verschiedenen Perspektiven
- Pädagogische Interventionen und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Eltern und Fachkräfte
- Bedeutung der Kommunikation und der kulturellen Zugehörigkeit
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung begründet die Relevanz der Untersuchung von Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen aus der Perspektive der Hörgeschädigtenpädagogik und der Verhaltensgestörtenpädagogik. Sie hebt die steigende Anzahl gehörloser Kinder mit Mehrfachbehinderungen hervor und die daraus resultierenden Herausforderungen für Pädagogen und Therapeuten. Die Schwierigkeit, mit herkömmlichen Methoden bei gehörlosen Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten erfolgreich zu sein, wird ebenfalls betont, da die Kommunikationsschwierigkeiten einen Zugang erschweren.
2. Grundlegende Begriffe: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe "Verhaltensauffälligkeit" und "Gehörlosigkeit". Es beinhaltet verschiedene Einteilungen von Verhaltensauffälligkeiten und Gehörlosigkeit (nach Ausmaß, Art und Kulturzugehörigkeit), beleuchtet deren Häufigkeit, sowie Ursachen und mögliche Fördermöglichkeiten (medizinisch-technisch, auditiv-verbal, bilingual). Die Zusammenfassung der verschiedenen Unterkapitel liefert eine fundierte Grundlage für das Verständnis der Thematik.
3. Formen: Dieses Kapitel beschreibt die Häufigkeit von Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern, unterscheidet zwischen gehörlosen Kindern mit Mehrfachbehinderungen und solchen mit isolierten Verhaltensauffälligkeiten, und analysiert verschiedene Arten von Verhaltensauffälligkeiten. Es stellt Zusammenhänge zwischen Gehörlosigkeit und der Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten dar und liefert eine umfassende Übersicht über die verschiedenen Erscheinungsformen.
4. Erklärungsansätze: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern aus den Perspektiven des Kindes, der Eltern und der Fachkräfte. Es analysiert die Rolle der Sprache, die Schwierigkeiten beim Lautspracherwerb und die Folgen einer reduzierten Kommunikationsfähigkeit. Ferner werden ungünstige Erziehungsweisen und falsche Zuschreibungen aufgrund ungenügender Kulturkenntnisse der Fachkräfte als mögliche Ursachen diskutiert.
5. Pädagogische Handlungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt verschiedene pädagogische Handlungsmöglichkeiten vor, um Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern zu begegnen. Es werden Ansätze für Kinder (Verbesserung der Kommunikation, Training sozialer Kompetenzen), Eltern (Förderung der Akzeptanz, Aufbau von Netzwerken) und Fachkräfte (Anerkennung der Leiblichkeit, Interkulturalität im pädagogischen Handeln) vorgestellt. Die Kapitelteil beschreibt konkrete Beispiele wie das "Kiosk-Projekt" und die Bedeutung von Familienentlastenden Diensten (FED).
Schlüsselwörter
Verhaltensauffälligkeiten, Gehörlosigkeit, Mehrfachbehinderung, Kommunikation, Sprache, Inklusion, Pädagogik, Elternarbeit, Interkulturalität, Förderung, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen Kindern und Jugendlichen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen. Sie beschreibt die Formen dieser Auffälligkeiten, beleuchtet mögliche Erklärungsansätze aus verschiedenen Perspektiven (Kind, Eltern, Fachkräfte) und zeigt pädagogische Handlungsmöglichkeiten auf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bedeutung der Kommunikation und der kulturellen Zugehörigkeit.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Formen von Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern, Erklärungsansätze aus verschiedenen Perspektiven, pädagogische Interventionen und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, Eltern und Fachkräfte, die Bedeutung der Kommunikation und der kulturellen Zugehörigkeit sowie Herausforderungen und Chancen der Inklusion.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlegende Begriffe (Definition von Verhaltensauffälligkeit und Gehörlosigkeit, Häufigkeit, Ursachen und Fördermöglichkeiten), Formen von Verhaltensauffälligkeiten bei Gehörlosen, Erklärungsansätze aus verschiedenen Perspektiven (Kind, Eltern, Fachkräfte) und Pädagogische Handlungsmöglichkeiten (Ansätze für Kinder, Eltern und Fachkräfte).
Was sind die zentralen Begriffe und deren Definitionen?
Zentrale Begriffe sind "Verhaltensauffälligkeit" und "Gehörlosigkeit". "Verhaltensauffälligkeit" wird im Kontext verschiedener Einteilungen und Häufigkeiten erläutert. "Gehörlosigkeit" wird differenziert nach Ausmaß, Art und kultureller Zugehörigkeit definiert, inklusive Ursachen und Fördermöglichkeiten (medizinisch-technisch, auditiv-verbal, bilingual).
Welche Formen von Verhaltensauffälligkeiten werden beschrieben?
Die Arbeit unterscheidet zwischen gehörlosen Kindern mit Mehrfachbehinderungen und solchen mit isolierten Verhaltensauffälligkeiten. Sie analysiert verschiedene Arten von Verhaltensauffälligkeiten und stellt Zusammenhänge zwischen Gehörlosigkeit und der Ausprägung von Verhaltensauffälligkeiten dar.
Welche Erklärungsansätze für Verhaltensauffälligkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet Erklärungsansätze aus den Perspektiven des Kindes (Rolle der Sprache, Schwierigkeiten beim Lautspracherwerb, Folgen reduzierter Kommunikationsfähigkeit), der Eltern (Beziehungsstörungen, mangelnde Akzeptanz, ungünstiges Erziehungsverhalten) und der Fachkräfte (Reduktion auf Kommunikation und Identität, falsche Zuschreibungen aufgrund ungenügender Kulturkenntnis).
Welche pädagogischen Handlungsmöglichkeiten werden vorgeschlagen?
Die Arbeit präsentiert pädagogische Handlungsmöglichkeiten für Kinder (Verbesserung der Kommunikation, Training sozialer Kompetenzen, Einbeziehung gehörloser Personen), Eltern (Förderung der Akzeptanz, Aufbau von Netzwerken, z.B. über Familienentlastende Dienste (FED)) und Fachkräfte (Anerkennung der Leiblichkeit, Interkulturalität im pädagogischen Handeln). Konkrete Beispiele wie das "Kiosk-Projekt" werden genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verhaltensauffälligkeiten, Gehörlosigkeit, Mehrfachbehinderung, Kommunikation, Sprache, Inklusion, Pädagogik, Elternarbeit, Interkulturalität, Förderung, Identität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Formen von Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern zu beschreiben, mögliche Erklärungsansätze zu beleuchten und pädagogische Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Sie berücksichtigt die Perspektiven des Kindes, der Eltern und der Fachkräfte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Therapeuten, Eltern gehörloser Kinder und alle, die sich mit der Thematik von Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Frank Alibegovic (Autor), 2008, Verhaltensauffälligkeiten bei gehörlosen Kindern und Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94140