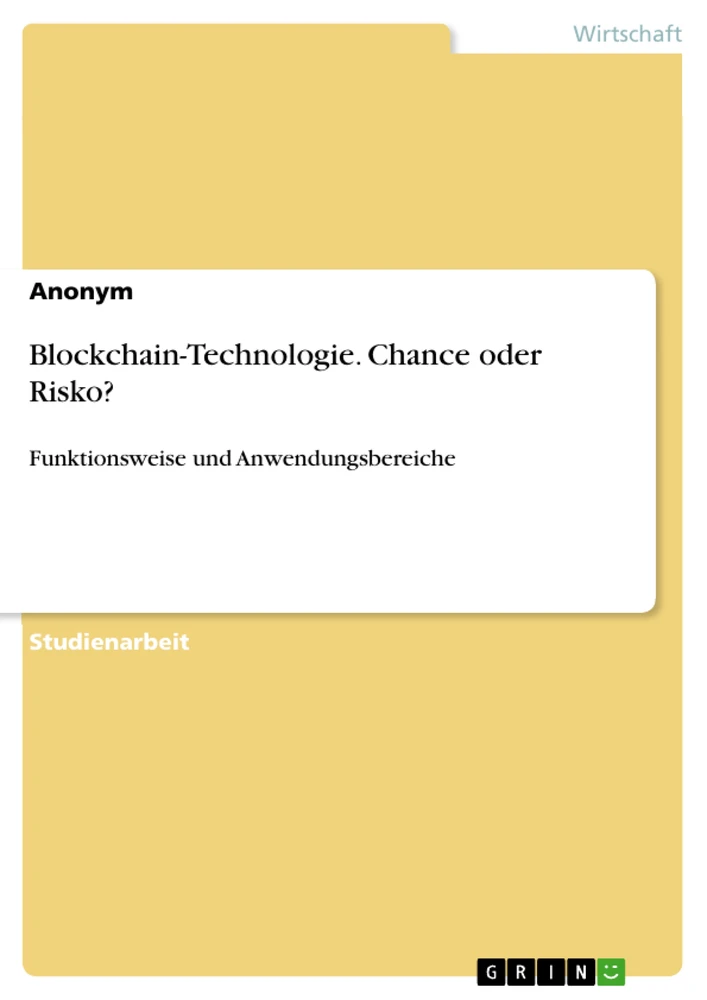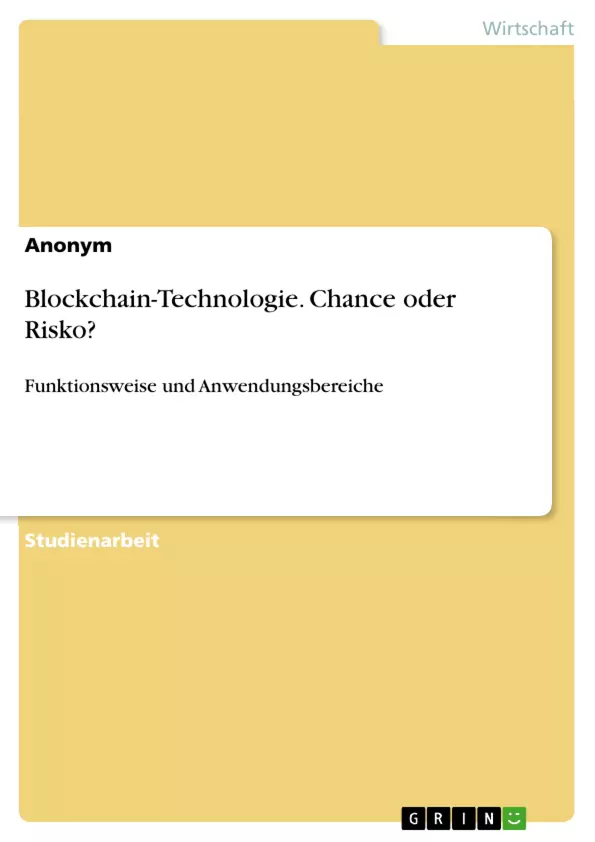Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, ob es sich bei der Blockchain-Technologie um eine zukunftsweisende Innovation oder lediglich um einen Hype handelt, der derzeit in den Medien präsent ist. Dabei soll zunächst die Entstehungsgeschichte und die grundlegende Funktionsweise der Blockchain vorgestellt werden. Des Weiteren werden Anwendungsbereiche aus der Praxis behandelt. Hierbei wird die Bedeutung der Blockchain-Technologie im Bereich der Smart Contracts erläutert. Dabei liegt der Schwerpunkt insbesondere auf deren Anwendungsmöglichkeiten in der Versicherungsbranche und im Finanzmanagement untersucht.
Darauf folgt die Analyse der auf Blockchain-Technologie basierenden Kryptowährungen. Diesen digitalen Währungen wird eine zunehmende Bedeutung für zukünftige Zahlungssysteme zugeschrieben. Dabei wird auch auf ihre Funktion als spezielle Form der Unternehmensfinanzierung eingegangen. Nach einer Gegenüberstellung von Risiken und Chancen, die der Einsatz von Blockchain-Technologie nach sich zieht, folgt ein Fazit und ein Zukunftsausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Entstehung und Funktionsweise der Blockchain-Technologie
- Entstehungsgeschichte und Intention
- Funktionsweise
- Anwendungsbereiche der Blockchain in der Praxis
- Smart Contracts
- Grundidee und technische Einordnung
- Anwendung in der Versicherungsbranche
- Anwendung in der Unternehmensfinanzierung
- Kryptowährungen und Initial Coin Offerings
- Einführung in die Kryptowährungen
- Initial Coin Offerings als Unternehmensfinanzierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Blockchain-Technologie und beleuchtet, ob sie eine zukunftsweisende Innovation oder lediglich ein Hype darstellt. Neben einer Darstellung der Entstehungsgeschichte und Funktionsweise der Blockchain werden Anwendungsbereiche in der Praxis behandelt, insbesondere im Bereich der Smart Contracts und Kryptowährungen.
- Entstehung und Funktionsweise der Blockchain-Technologie
- Anwendungsbereiche der Blockchain in der Praxis
- Smart Contracts in der Versicherungsbranche und Unternehmensfinanzierung
- Kryptowährungen als Zahlungsmittel und Finanzierungsinstrument
- Initial Coin Offerings als neue Finanzierungsform
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Seminararbeit stellt die Problemstellung der Blockchain-Technologie als Innovation oder Hype dar und erläutert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Entstehung und Funktionsweise der Blockchain-Technologie: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte und Intention der Blockchain-Technologie und beleuchtet die Funktionsweise der Blockchain anhand von Blöcken, der Unveränderlichkeit von Daten und der dezentralen Verwaltung.
- Anwendungsbereiche der Blockchain in der Praxis: Das Kapitel beleuchtet Smart Contracts, ihre Grundidee und Einordnung sowie die Anwendungsbeispiele in der Versicherungsbranche (Flugausfallversicherung, Ernteversicherungen) und der Unternehmensfinanzierung (Schuldscheindarlehen, Konsortialkredit, ABS-Finanzierung, Exportfinanzierung).
- Kryptowährungen und Initial Coin Offerings: Dieses Kapitel stellt Kryptowährungen vor, ihre Bedeutung für zukünftige Zahlungssysteme und erläutert den Zusammenhang mit der Blockchain-Technologie. Zudem wird das Initial Coin Offering (ICO) als neue Finanzierungsform für Unternehmen, insbesondere Start-ups, vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit fokussiert auf die Blockchain-Technologie, Smart Contracts, Kryptowährungen und Initial Coin Offerings. Dabei werden Themen wie dezentrale Datenspeicherung, digitale Validierung, Transaktionsabwicklung, Unternehmensfinanzierung, Versicherungsbranche, digitale Währungen und innovative Finanzierungsformen behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Ist Blockchain nur ein Hype oder eine echte Innovation?
Die Arbeit untersucht, ob Blockchain eine zukunftsweisende Technologie ist. Sie kommt zu dem Schluss, dass sie durch Dezentralität und Unveränderlichkeit hohes Potenzial für die Praxis bietet.
Wie funktioniert die Blockchain-Technologie grundsätzlich?
Daten werden in chronologischen Blöcken gespeichert, die kryptografisch miteinander verkettet sind. Dies geschieht dezentral auf vielen Rechnern, was Manipulationen nahezu ausschließt.
Was sind Smart Contracts?
Smart Contracts sind digitale Verträge, die auf der Blockchain gespeichert werden und sich automatisch ausführen, sobald vordefinierte Bedingungen erfüllt sind (z. B. Flugausfallversicherungen).
Welche Rolle spielen Kryptowährungen bei dieser Technologie?
Kryptowährungen sind die bekannteste Anwendung der Blockchain. Sie dienen als digitales Zahlungsmittel und ermöglichen neue Finanzierungsformen wie Initial Coin Offerings (ICOs).
In welchen Branchen wird Blockchain bereits eingesetzt?
Besonders im Finanzmanagement (Schuldscheindarlehen) und in der Versicherungsbranche (Ernte- oder Reiseversicherungen) findet die Technologie praktische Anwendung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Blockchain-Technologie. Chance oder Risko?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/941713