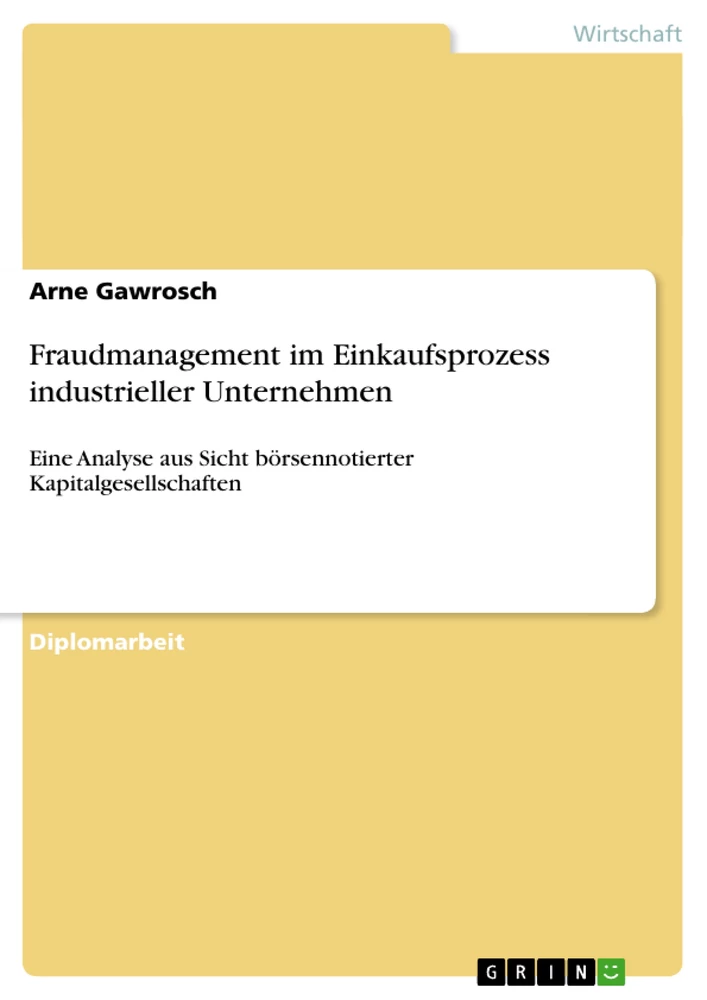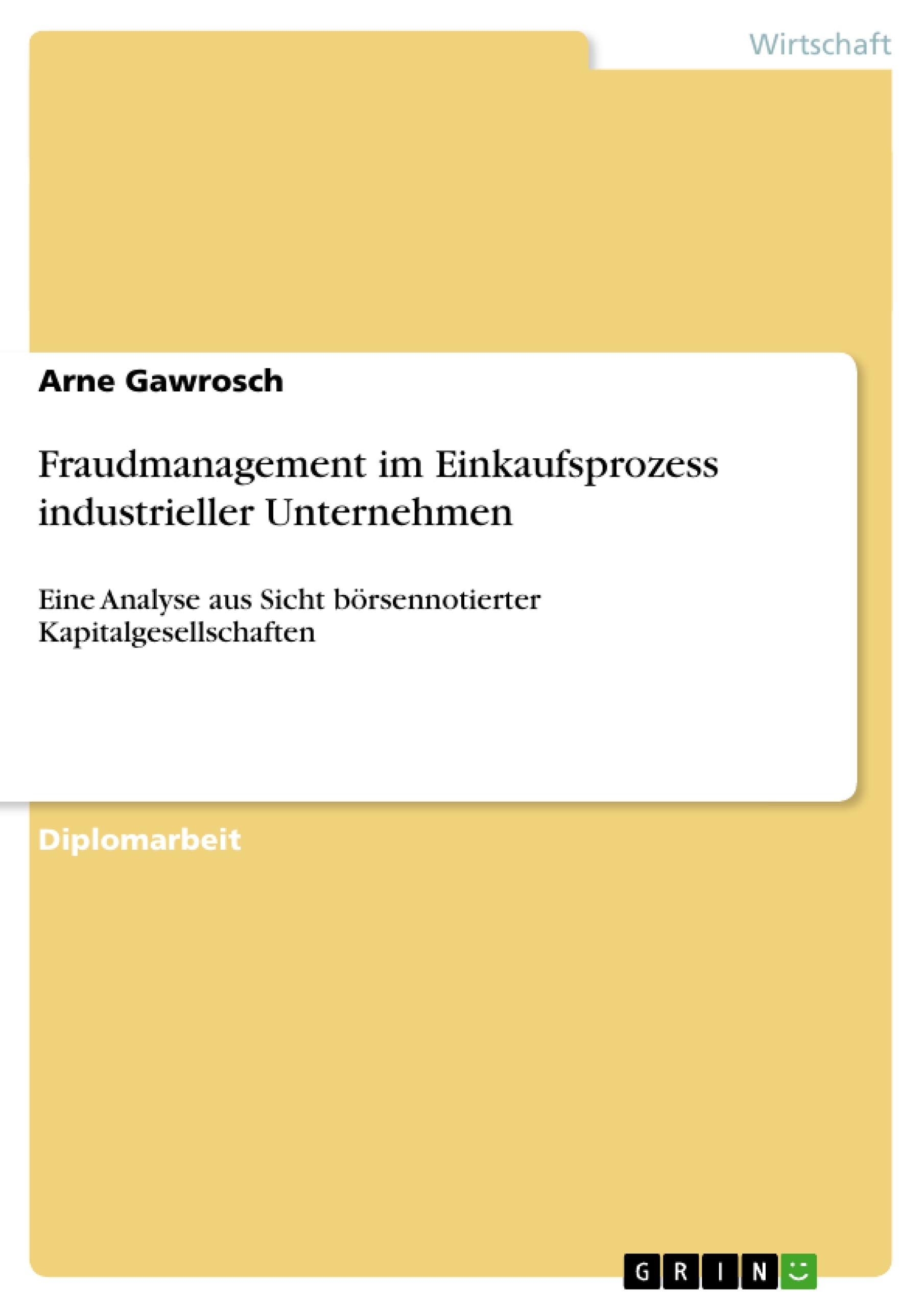Noch vor wenigen Jahren war Wirtschaftskriminalität ein Thema, das in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wurde. Falls es Vorfälle in einzelnen Unternehmen gab, wurden sie meist mit maximaler Diskretion aufgeklärt. Die teilweise spektakulären Fälle in der jüngeren Vergangenheit haben dies radikal verändert und zu Gesetzesentwürfen geführt, die alle zum Ziel haben die Transparenz im Unternehmen zu verbessern und durch Überwachungssysteme das Unternehmen als Ganzes bestmöglich zu schützen.
Nichtsdestotrotz ist Wirtschaftskriminalität auch heute allgegenwärtig, und ihre verursachten Schäden sind immens. Bspw. berichtet das BKA von Schäden im Jahre 2006 in Höhe von 4,3 Mrd. €.
Damit nimmt die durch Wirtschaftskriminalität verursachte Schadenshöhe über die Hälfte aller registrierten Schäden ein, während der Anteil an allen registrierten Delikten gerade 2,3% beträgt.
Eine von der KPMG durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2003 hat gezeigt, dass 64% der in Deutschland ansässigen Unternehmen in den vergangenen drei Jahren von Wirtschaftskriminalität betroffen waren. Es muss die Frage gestellt werden, weshalb die erlassenen Gesetzesnovellen und das vorhandene Problembewusstsein das Ausmaß von Wirtschaftskriminalität nicht stärker unterbinden. In diesem Zusammenhang stellt es sich als problematisch heraus, dass nur ca. 30% der befragten Unternehmen ein erhöhtes eigenes Risiko annehmen. Ganz nach dem Motto: „Es kann nicht sein, was nicht sein darf“. Als weitere Schwierigkeit zeigt sich das im Gesetz verlangte Überwachungssystem. Der Mangel einer Konkretisierung von zu ergreifenden Maßnahmen sowie der exakten Ausgestaltung des Überwachungssystems muss zwangsläufig zu einer Umsetzungsproblematik führen.
Untersuchungen von Ernst & Young haben gezeigt, dass zwei von drei Delikten durch eigene Mitarbeiter begangen werden. Dieser Umstand ist letztlich darauf zurückzuführen, dass die Einflussfaktoren „Gelegenheit“ und „Entdeckungsrisiko“ in vielen Unternehmen nicht hinreichend optimiert sind.
Als einer der wesentlichen Bereiche wirtschaftskrimineller Handlungen gilt im Unternehmen der Einkaufsbereich. Es verwundert, dass bislang keine detaillierten Vorgaben und Empfehlungen existieren, diesen Bereich ganzheitlich und bestmöglich gegen Wirtschaftskriminalität zu präparieren. Dies soll die Zielsetzung dieser Arbeit sein. Relevante Betrugsrisiken werden aufgezeigt und ihre konsequente Handhabung anhand des systematischen Risikomanagementprozesses dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung dieser Arbeit
- Gang der Untersuchung
- Thematische Abgrenzung und Grundlagen für das Fraudmanagement und den Einkaufsbereich
- Definition relevanter Begriffe
- Industrielle Unternehmen
- Einkaufsprozess
- Fraud und Fraudmanagement
- Wertorientierte Unternehmensführung und das Konzept des Shareholder Value
- Theoretische Einführung ins Fraudmanagement
- Principal-Agent-Theorie als Erklärungsansatz zur Notwendigkeit einer Corporate Governance
- Gegenstand der Principal-Agent-Theorie
- Principal-Agent-Konflikte
- Lösungsansätze der Principal-Agent-Probleme
- Corporate Governance
- Begriff und Zielsetzung
- Angloamerikanischer und europäischer Ansatz
- Relevante Rechtsgebiete als Ausfluss der Corporate Governance Diskussion vor dem Hintergrund von Fraudaktivitäten im Einkaufsbereich
- Allgemeines
- Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
- Deutscher Corporate Governance Kodex
- Sarbanes Oxley Act
- Unternehmerisches Überwachungssystem und die Einordnung des beschaffungsrelevanten Fraudmanagements
- Überwachungssystem des Unternehmens
- Begriff der Überwachung
- Überwachungsobjekte
- Überwachungsträger
- Risikomanagementsystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG
- Vorbemerkung
- Einflussnahme des Internal-Control-Ansatzes nach dem COSO-Report
- Elemente des Risikomanagementprozesses
- Unternehmensziele und -strategien
- Risikoidentifikation
- Risikoanalyse und -bewertung
- Risikosteuerung
- Risikocontrolling und -reporting
- Komponenten des Risikomanagementsystems
- Früherkennungssystem
- Internes Überwachungssystem
- Controllingsystem
- Abgrenzung des Fraudmanagementsystems aus dem Risikomanagementsystem und ihr organisatorischer Zusammenhang
- Beschaffungsrelevante Fraudrisiken als Teilmenge der unternehmerischen Risikobetrachtung des Risikomanagementsystems
- Organisatorische Integration des Fraudmanagementsystems
- Einkaufsbereich
- Vorbemerkung
- Aufgabe und Zielsetzung des Einkaufs
- Beschaffungsobjekte und die Abgrenzung auf Sachgüter
- Organisation des Einkaufs
- Vorbemerkung
- Aufbauorganisation
- Funktions- und objektorientierte Ausrichtung des Einkaufs
- Hierarchische Eingliederung in die Unternehmensorganisation
- Ablauforganisation
- Bedarfsermittlung
- Lieferantenvorauswahl
- Angebotseinholung und Auftragsvergabe
- Lieferungs- und Leistungskontrolle
- Abrechnungskontrolle
- Lieferantenbewertung
- Management von Fraudrisiken im Einkaufsbereich
- Allgemeine Fraudbetrachtung
- Risikoaspekte für Fraudaktivitäten von Mitarbeitern
- Vorbemerkung
- Korruption und ihre Abhängigkeit
- Sonstige Interessenkonflikte der Mitarbeiter
- Risikofaktor „Mensch“
- Einsatz von universellen Anti-Fraud-Maßnahmen
- Personalrotation
- Whistleblowing über Hinweisgebersysteme
- Massendatenauswertungen
- Vier-Augen-Prinzip
- Bedeutung von Business Ethics
- Fraudbetrachtung in Abhängigkeit von der Aufbau- und Ablauforganisation des Einkaufsbereichs
- Hinweis zur Darstellung des Fraudmanagements in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3
- Aufbauorganisation
- Vorbemerkung
- Funktions- und objektorientierte Ausrichtung des Einkaufs
- Risikoidentifikation und -bewertung
- Risikosteuerung und -controlling
- Kritische Würdigung von Risiken und Gegenmaßnahmen
- Zuordnung der Risikohandhabung auf die Komponenten des Risikomanagementsystems
- Hierarchische Eingliederung in die Unternehmensorganisation
- Risikoidentifikation und -bewertung
- Risikosteuerung und -controlling
- Die wichtigsten Fraudrisiken im Einkaufsprozess
- Entwicklung eines umfassenden Fraudmanagementsystems
- Die Bedeutung von Corporate Governance und Compliance im Kontext von Fraudprävention
- Die Rolle des Risikomanagements im Kampf gegen Fraud
- Die Relevanz von Business Ethics und Whistleblowing-Systemen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik des Fraudmanagements im Einkaufsprozess industrieller Unternehmen. Im Zentrum der Betrachtung stehen börsennotierte Kapitalgesellschaften. Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten Fraudrisiken im Einkaufsbereich zu identifizieren und ein umfassendes Fraudmanagementsystem zu entwickeln, welches diese Risiken effizient bewältigt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung des Fraudmanagements im Einkaufsprozess beleuchtet wird. Die Zielsetzung der Arbeit wird definiert und der Gang der Untersuchung skizziert. Im zweiten Kapitel werden relevante Begriffe wie Industrielle Unternehmen, Einkaufsprozess, Fraud und Fraudmanagement definiert. Die Principal-Agent-Theorie als Erklärungsansatz zur Notwendigkeit einer Corporate Governance wird erläutert und die Bedeutung von Rechtsgebieten wie dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich und dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Kontext von Fraudaktivitäten im Einkaufsbereich diskutiert. Das Kapitel endet mit der Vorstellung des unternehmerischen Überwachungssystems und der Einordnung des Fraudmanagements. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Einkaufsbereich und dessen Organisation, wobei die relevanten Abläufe vom Bedarfsermittlung bis zur Lieferantenbewertung detailliert dargestellt werden. Das vierte Kapitel analysiert die Management von Fraudrisiken im Einkaufsbereich und untersucht die Risikoaspekte für Fraudaktivitäten von Mitarbeitern sowie den Einsatz von universellen Anti-Fraud-Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Fraudmanagement, Einkaufsprozess, Industrielle Unternehmen, Börsennotierte Kapitalgesellschaften, Risikomanagement, Corporate Governance, Compliance, Business Ethics, Whistleblowing-Systeme, Korruption, Interessenkonflikte, Anti-Fraud-Maßnahmen
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Fraud-Risiken im Einkauf?
Dazu gehören Korruption, Bestechung bei der Lieferantenauswahl, Scheinrechnungen, Preisabsprachen und sonstige Interessenkonflikte von Mitarbeitern.
Was ist die Principal-Agent-Theorie im Kontext von Fraud?
Sie erklärt den Konflikt, wenn ein Mitarbeiter (Agent) nicht im Sinne des Unternehmenseigentümers (Principal) handelt, sondern seinen eigenen Nutzen durch Betrug maximiert.
Welche Anti-Fraud-Maßnahmen sind für Unternehmen effektiv?
Effektive Maßnahmen sind das Vier-Augen-Prinzip, Personalrotation in sensiblen Bereichen, Whistleblowing-Systeme und regelmäßige Massendatenauswertungen.
Wie hoch ist der Schaden durch Wirtschaftskriminalität in Deutschland?
Die Arbeit zitiert BKA-Zahlen, nach denen Wirtschaftskriminalität über die Hälfte aller registrierten Schäden ausmacht, obwohl sie nur einen kleinen Teil der Delikte darstellt.
Was verlangt das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz (KonTraG)?
Es verpflichtet den Vorstand börsennotierter Gesellschaften zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems, um bestandsgefährdende Risiken (auch Fraud) rechtzeitig zu identifizieren.
- Quote paper
- Arne Gawrosch (Author), 2007, Fraudmanagement im Einkaufsprozess industrieller Unternehmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94186