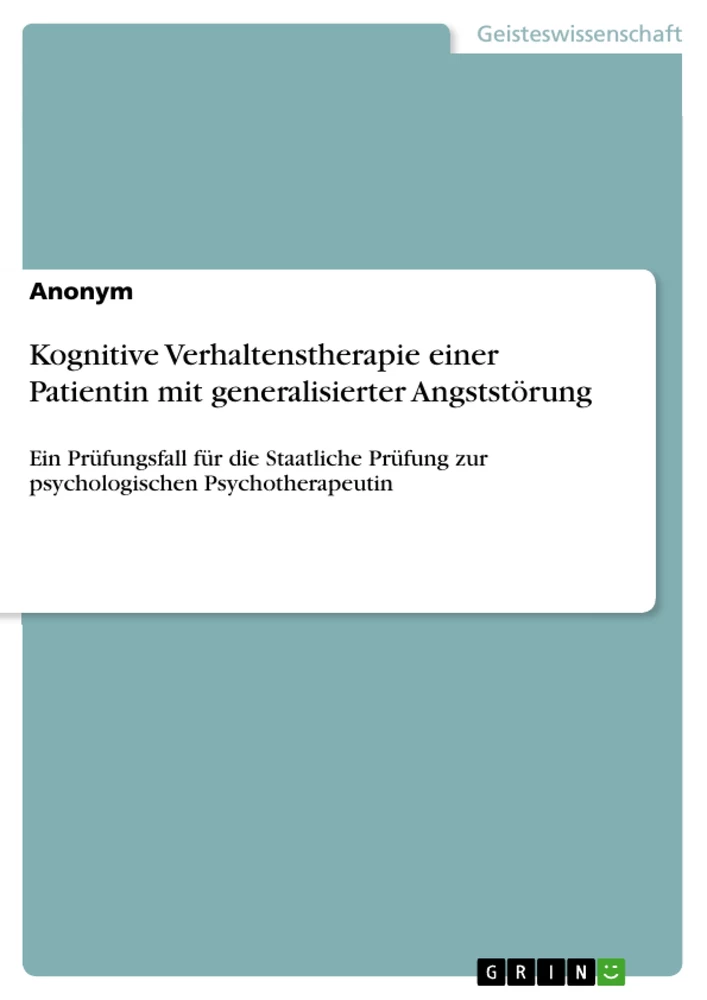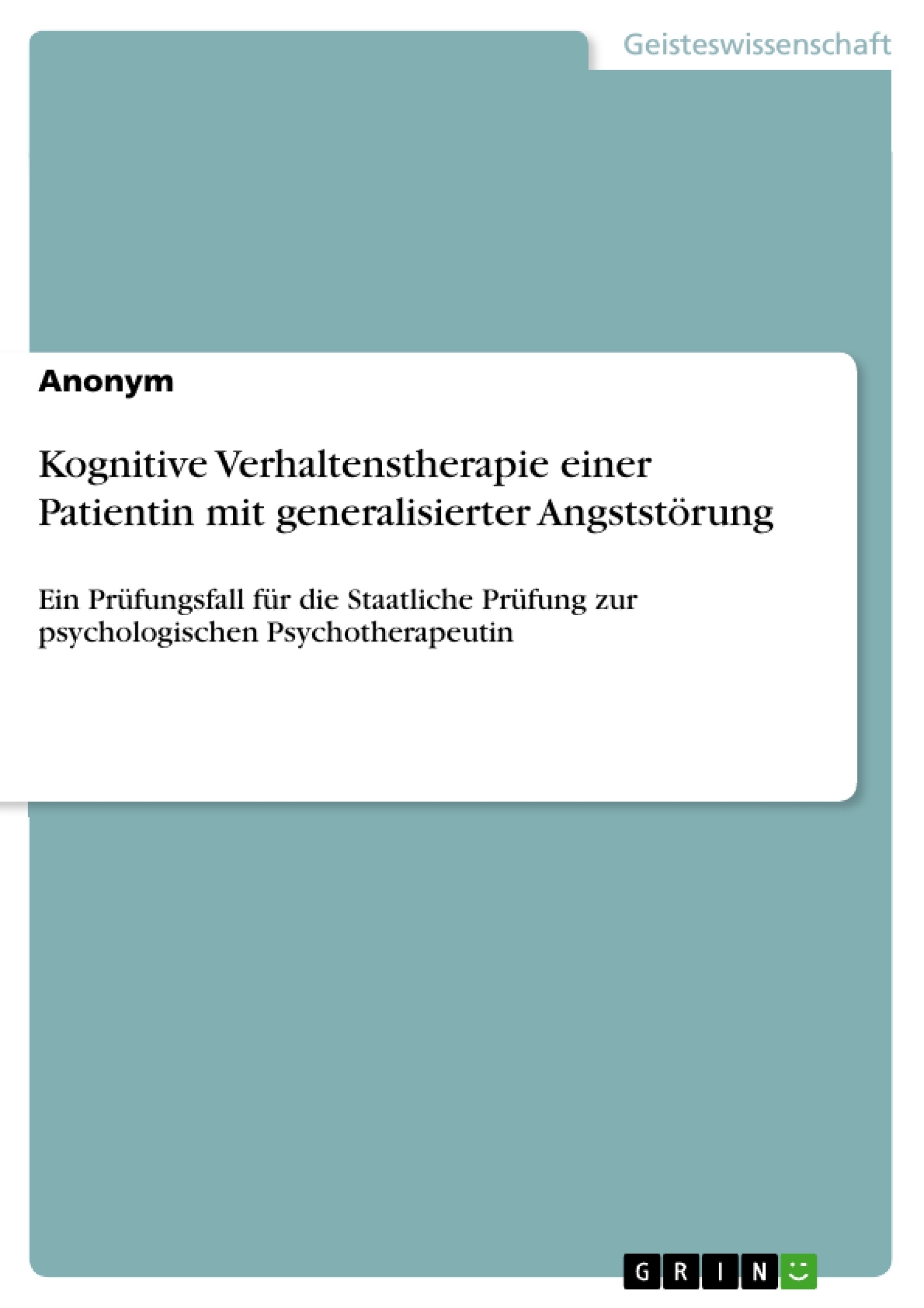Diese Arbeit verhandelt ein Praxisbeispiel einer Angststörung als Prüfungsleistung zur Erlangung des Titels "Psychotherapeut".
Bei dem Erstgespräch berichtete die Patientin, sie leide täglich mehrere Stunden an andauernden Sorgen und sei vermehrt unruhig und angespannt. Sie habe große Angst, dass ein Mitglied ihre Familie plötzlich schwer erkranke und infolge dessen versterbe. Sie habe Angst, dass sie oder ihre Familie in einen Unfall verwickelt seien und habe auch Angst davor, in Urlaub zu fahren. Seit etwa zwei Jahren leide sie an diesen Ängsten. Anfang 2017 habe auch „der Körper verrückt“ gespielt und sie habe an Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel sowie Kribbeln in Armen und Beinen gelitten. Sie sei überzeugt gewesen, an Multipler Sklerose erkrankt zu sein und habe sich bei ihrem Neurologen vorgestellt, der jedoch keine organische Ursache gefunden habe. Seitdem sei sie nicht mehr beim Arzt gewesen, da es „sowieso keinen Befund gebe“ und „Zeitverschwendung“ sei. Gelegentlich verspüre sie erneutes Kribbeln in den Extremitäten und habe auch immer wieder die Sorge, an Thrombose erkrankt zu sein. Sie fühle sich reizbar und sei ständig in der Erwartung, dass eine Katastrophe geschehe. Im letzten Jahr habe sie zwei Panikattacken erlitten. Die Ursache ihrer Ängste sehe die Patientin in ihrer ängstlichen, überbehütenden Mutter. Weiterhin verstärke Stress die Beschwerden. Als Ziel für die ambulante Therapie wünsche sie sich ein angstbefreites Leben.
Inhaltsverzeichnis
- Aktuelle Anamnese
- Biographische & soziale Anamnese
- Psychopathologischer Befund
- Diagnostik
- Therapieziele
- Therapieverlauf
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, den Therapieverlauf einer Patientin mit generalisierter Angststörung (GAS) im Rahmen einer ambulanten Einzeltherapie zu dokumentieren und kritisch zu reflektieren. Die Arbeit soll die diagnostischen Schritte, die Therapieziele, den Therapieverlauf und die erzielten Ergebnisse detailliert darstellen.
- Diagnostik und Verlauf einer Generalisierten Angststörung
- Die Rolle von Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten
- Die Bedeutung der therapeutischen Beziehung
- Psychoedukation und kognitive Umstrukturierung
- Einfluss der familiären Dynamik auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung
Zusammenfassung der Kapitel
Aktuelle Anamnese: Die Patientin berichtete über andauernde Sorgen, Unruhe und Anspannung, begleitet von Ängsten vor Krankheit und Tod ihrer Familie, Unfällen und Urlaubsreisen. Diese Ängste bestehen seit etwa zwei Jahren, verbunden mit körperlichen Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Kribbeln in den Extremitäten. Sie assoziiert ihre Ängste mit ihrer ängstlichen Mutter und Stresssituationen. Ihr Therapieziel ist ein angstfreies Leben.
Biographische & soziale Anamnese: Die Patientin wuchs als Einzelkind mit einer überbehütenden Mutter und einem ruhigen Vater auf. Die mütterliche Überbehütung und deren nachtragende Reaktionen führten bei der Patientin zu Unsicherheit, Angst und Schuldgefühlen. Der Vater war ihre wichtigste Bezugsperson. Sie absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung und lebt in einer stabilen Ehe mit zwei Kindern. Sie verfügt über Ressourcen wie Tennis, Yoga und Zeit mit Familie und Freunden.
Psychopathologischer Befund: Die Patientin präsentierte sich im Aufnahmegespräch als freundlich, mitteilungsbereit, aber sichtlich angespannt. Kognitive Funktionen waren unauffällig, jedoch berichtete sie über Konzentrationsprobleme. Ihr Denken war auf Sorgen fokussiert, ohne Anzeichen von Wahn oder Zwängen. Die Stimmung war schwankend, mit Gereiztheit, Niedergeschlagenheit und Weinen. Suizidalität oder akute Gefährdung lagen nicht vor.
Diagnostik: Mittels KPD-38 und PSWQ-D wurde eine Generalisierte Angststörung (F41.1) diagnostiziert. Die Testergebnisse bestätigten die hohe Belastung und deckten sich mit dem klinischen Eindruck.
Therapieziele: Die Therapieziele umfassten den Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Erarbeitung eines psychosomatischen Krankheitsmodells, Psychoedukation, die Identifizierung und Modifikation aufrechterhaltender Faktoren (Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten), die Verbesserung des Emotionsausdrucks, die Etablierung von Abgrenzungsstrategien gegenüber der Mutter und die Entwicklung funktionaler kognitiver Strategien.
Therapieverlauf: Die Patientin nahm zuverlässig an den Sitzungen teil. Nach ausführlicher Anamnese und Psychoedukation wurde ein individuelles Erklärungsmodell erarbeitet, was anfänglich Angst und Unsicherheit auslöste, aber auch als erleichternd empfunden wurde. Ein Sorgentagebuch half bei der Analyse auslösender und aufrechterhaltender Faktoren. Eine Verringerung des Sorgenaufkommens wurde beobachtet, wobei andauernde Überlastung und Vermeidungsverhalten als zentrale Faktoren identifiziert wurden. Diese wurden im weiteren Therapieverlauf modifiziert.
Schlüsselwörter
Generalisierte Angststörung, Kognitive Verhaltenstherapie, Vermeidungsverhalten, Rückversicherung, Psychoedukation, Familiäre Dynamik, Ressourcenaktivierung, Psychosomatische Beschwerden, Sorgentagebuch.
Häufig gestellte Fragen zur Therapie einer Patientin mit generalisierter Angststörung
Was ist der Inhalt dieser Fallstudie?
Diese Arbeit dokumentiert und reflektiert den Therapieverlauf einer Patientin mit generalisierter Angststörung (GAS) in ambulanter Einzeltherapie. Sie beschreibt detailliert die diagnostischen Schritte, Therapieziele, den Therapieverlauf und die erzielten Ergebnisse. Die Arbeit beinhaltet eine aktuelle und biographisch-soziale Anamnese, einen psychopathologischen Befund, die Diagnostik, die Therapieziele, den Therapieverlauf und das Ergebnis der Therapie.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Fallstudie beleuchtet die Diagnostik und den Verlauf einer generalisierten Angststörung, die Rolle von Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten, die Bedeutung der therapeutischen Beziehung, Psychoedukation und kognitive Umstrukturierung sowie den Einfluss der familiären Dynamik auf Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung.
Welche Diagnostik wurde durchgeführt?
Zur Diagnosestellung wurden der KPD-38 und der PSWQ-D eingesetzt. Die Ergebnisse bestätigten eine Generalisierte Angststörung (F41.1) und deckten sich mit dem klinischen Eindruck.
Welche Symptome zeigte die Patientin?
Die Patientin berichtete über andauernde Sorgen, Unruhe und Anspannung, Ängste vor Krankheit und Tod ihrer Familie, Unfällen und Urlaubsreisen, begleitet von körperlichen Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Kribbeln in den Extremitäten. Im Aufnahmegespräch präsentierte sie sich angespannt, berichtete über Konzentrationsprobleme und eine schwankende Stimmung mit Gereiztheit, Niedergeschlagenheit und Weinen.
Welche Therapieziele wurden verfolgt?
Die Therapieziele umfassten den Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Erarbeitung eines psychosomatischen Krankheitsmodells, Psychoedukation, die Identifizierung und Modifikation aufrechterhaltender Faktoren (Vermeidungs- und Rückversicherungsverhalten), die Verbesserung des Emotionsausdrucks, die Etablierung von Abgrenzungsstrategien gegenüber der Mutter und die Entwicklung funktionaler kognitiver Strategien.
Wie verlief die Therapie?
Die Patientin nahm zuverlässig an den Sitzungen teil. Es wurden ein individuelles Erklärungsmodell erarbeitet und ein Sorgentagebuch geführt. Die Therapie fokussierte sich auf die Analyse auslösender und aufrechterhaltender Faktoren, insbesondere andauernde Überlastung und Vermeidungsverhalten, die im weiteren Verlauf modifiziert wurden. Eine Verringerung des Sorgenaufkommens wurde beobachtet.
Welche Rolle spielte die familiäre Dynamik?
Die Patientin wuchs als Einzelkind mit einer überbehütenden Mutter auf, was zu Unsicherheit, Angst und Schuldgefühlen führte. Die mütterliche Überbehütung und deren nachtragende Reaktionen werden als Einflussfaktoren auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Angststörung betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben diese Fallstudie?
Generalisierte Angststörung, Kognitive Verhaltenstherapie, Vermeidungsverhalten, Rückversicherung, Psychoedukation, Familiäre Dynamik, Ressourcenaktivierung, Psychosomatische Beschwerden, Sorgentagebuch.
Was war das Ergebnis der Therapie?
Die Fallstudie beschreibt den Therapieverlauf und die erzielten Ergebnisse, geht aber nicht explizit auf ein abschließendes Therapieergebnis ein. Die Zusammenfassung zeigt eine Verbesserung im Umgang mit Sorgen und Vermeidungsverhalten an, jedoch werden keine konkreten Erfolgsmaße genannt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Kognitive Verhaltenstherapie einer Patientin mit generalisierter Angststörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942312