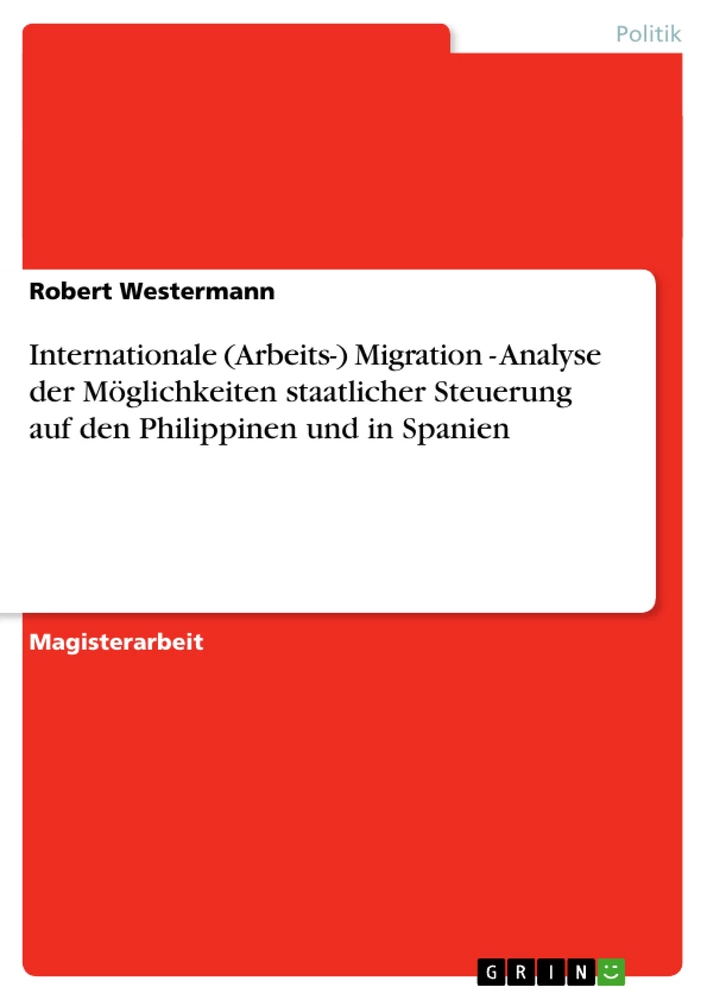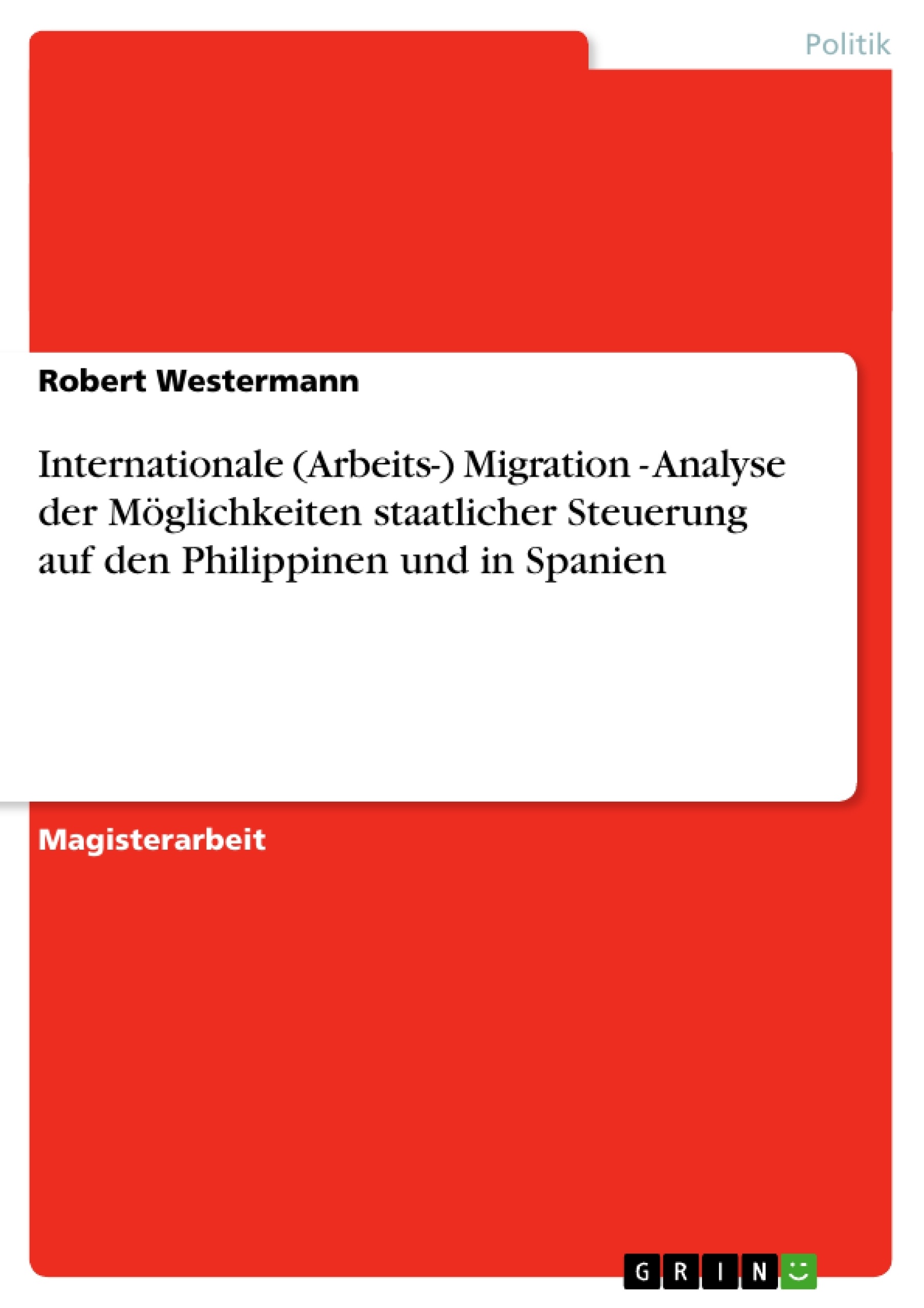Die Magisterarbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen analytischen Teilbereich. Zunächst wird ein Blick auf den aus der Migrationsforschung stammenden Migrationssystemansatz geworfen, der vor allem in der Lage ist, Pendelbewegungen von Migranten zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern konzeptionell zu erfassen. Um dem politikwissenschaftlichen Ansatz der Arbeit gerecht zu werden, wird darüber hinaus Bezug genommen auf neogramscianische Überlegungen von Robert Cox, der insbesondere sozio-ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Staaten im Zuge zunehmender Globalisierung beschreibt und Rückschlüsse auf weltweite Migrationsbewegungen vornimmt.
Für das Fallbeispiel der Philippinen ließ sich feststellen, dass der rapide Anstieg von temporären Arbeitsmigranten zusammenfällt mit einer zunehmenden Deregulierung der staatlichen Steuerungsfunktion. Zwar gehören die Philippinen zu den ersten Auswanderungsländern, in denen der Staat aufgrund der hohen Deviseneinnahmen durch remittances Migration gezielt unterstützt hat, jedoch vor allem seit den 90er Jahren ist die Betreuung von Migranten weitestgehend privatisiert worden, sodass der Staat vor allem eine Kontrollfunktion über Migrationsagenturen wahrnimmt. Der Einfluss bleibt jedoch auf das Inland beschränkt, da sich Arbeitsmärkte zwar globalisieren, Arbeitnehmerrechte jedoch weiterhin national bestimmt werden.
Das Fallbeispiel Spanien konnte zeigen, dass in Einwanderungsländern der Staat zunehmend Einfluss auf Migrationsbewegungen nimmt. Gerade sicherheits- und wirtschaftspolitische Interessen veranlassten Spanien dazu, bilaterale Verhandlungen mit afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern aufzunehmen. Im Gegensatz zu den zentraleuropäischen Staaten wird Einwanderung nicht grundsätzlich als ein Problem wahrgenommen, sondern auch als notwendiges Element einer global konkurrenzfähigen Wirtschaft. Daraus ergibt sich, dass Spanien in jüngster Zeit über Migrationsabkommen gezielt internationale Politik betrieben hat und administrativ-logistischen Voraussetzungen für temporäre Arbeitsmigration immer weiter ausbaut.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Methodische und theoretische Grundannahmen
- Arbeitsmigration, Globalisierung und der Nationalstaat
- Migrationssysteme
- Die Krise der Push- und Pull-Ansätze
- Verknüpfung von Mikro- und Makro-Ebenen
- Migrationssystem-Ansätze
- Typologie von Einflussfaktoren
- Neo-Gramscianismus
- Das Konzept transnationaler Hegemonie
- Erklärung strukturellen Wandels
- Migrationssteuerung – ein neoliberales Projekt?
- Erstes Fallbeispiel: Die Philippinen
- Sozio-ökonomischer und politischer Wandel
- Institutionalisierung von Migrationsprozessen
- Rekrutierung
- Betreuung im Ausland
- Reintegrationsprogramme
- Feminisierung und Flexibilisierung transnationaler Arbeit
- Zweites Fallbeispiel: Spanien
- Sozio-ökonomischer und politischer Wandel
- Externalisierung von Migrationspolitik
- Legalisierungen
- Quotensysteme
- Bilaterale Migrationsverträge
- Ethnische Segmentierung von Arbeitsmärkten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert die Möglichkeiten staatlicher Steuerung von internationaler (Arbeits-)Migration am Beispiel der Philippinen und Spaniens. Sie untersucht, inwiefern Staaten in der Lage sind, die komplexen Prozesse der internationalen Migration zu beeinflussen und zu steuern. Dabei werden die Herausforderungen und Chancen staatlicher Migrationspolitik im Kontext von Globalisierung und transnationalen Migrationsbewegungen beleuchtet.
- Die Herausforderungen der staatlichen Steuerung von internationaler Arbeitsmigration im Zeitalter der Globalisierung.
- Die Rolle von Migrationssystemen und transnationaler Hegemonie bei der Gestaltung von Migrationsbewegungen.
- Die Analyse von Fallbeispielen auf den Philippinen und in Spanien, die unterschiedliche Ansätze zur Regulierung und Steuerung von Migration aufzeigen.
- Die Auswirkungen von Migration auf die Arbeitsmärkte und die gesellschaftliche Integration von Migranten.
- Die Bedeutung von temporären Migrationsprogrammen als Instrument der staatlichen Steuerung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den aktuellen Diskurs zur Steuerung von Migration. Kapitel 2 beleuchtet die methodischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit. Hier werden Migrationssysteme, die Krise der Push- und Pull-Ansätze, sowie das Konzept der transnationalen Hegemonie im neo-gramscianischen Rahmen vorgestellt. Kapitel 3 analysiert die Philippinen als Fallbeispiel. Es werden die sozio-ökonomischen und politischen Entwicklungen, die Institutionalisierung von Migrationsprozessen und die Auswirkungen der Feminisierung transnationaler Arbeit beleuchtet. Kapitel 4 widmet sich Spanien als zweitem Fallbeispiel. Hier werden die Externalisierung von Migrationspolitik, die Legalisierungen, Quotensysteme und bilaterale Migrationsverträge diskutiert. Die Zusammenfassung der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammen.
Schlüsselwörter
Internationale Arbeitsmigration, Globalisierung, Nationalstaat, Migrationssysteme, Transnationale Hegemonie, Neo-Gramscianismus, Philippinen, Spanien, Temporäre Migrationsprogramme, Steuerung, Regulierung, Feminisierung, Flexibilisierung, Externalisierung, Legalisierung, Quotensysteme, Bilaterale Migrationsverträge, Ethnische Segmentierung.
Häufig gestellte Fragen
Wie steuern die Philippinen ihre Arbeitsmigration?
Die Philippinen fördern Migration aktiv zur Devisengewinnung (Remittances), haben jedoch seit den 90er Jahren die Betreuung weitgehend privatisiert und üben primär eine Kontrollfunktion über Agenturen aus.
Welchen Ansatz verfolgt Spanien bei der Einwanderungspolitik?
Spanien sieht Einwanderung als wirtschaftliche Notwendigkeit und nutzt bilaterale Migrationsabkommen mit afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern zur gezielten Steuerung.
Was ist der Migrationssystemansatz?
Dieser Ansatz erfasst die Pendelbewegungen von Migranten zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern und verknüpft dabei Mikro- (Individuen) und Makro-Ebenen (Staaten).
Was bedeutet „Feminisierung der Arbeit“ im Kontext der Migration?
Es beschreibt den steigenden Anteil von Frauen in der transnationalen Arbeitsmigration, was besonders im Fallbeispiel der Philippinen eine große Rolle spielt.
Was sind bilaterale Migrationsverträge?
Das sind Abkommen zwischen zwei Staaten, die die Bedingungen für Arbeitsmigration, Rückführung und soziale Absicherung der Migranten regeln.
- Citation du texte
- Robert Westermann (Auteur), 2007, Internationale (Arbeits-) Migration - Analyse der Möglichkeiten staatlicher Steuerung auf den Philippinen und in Spanien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94232