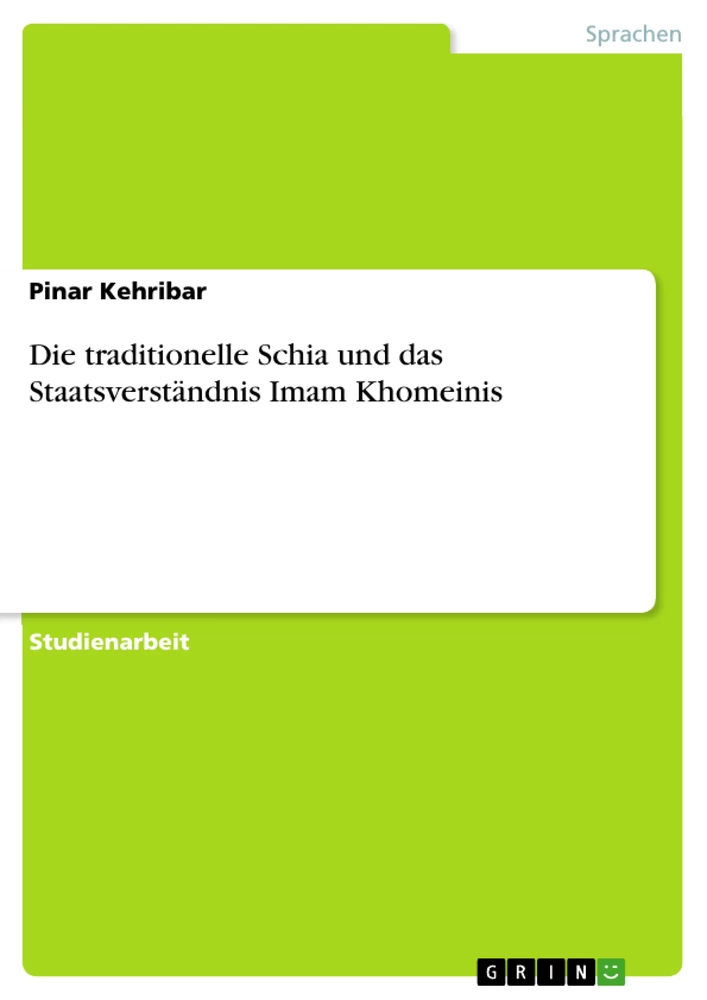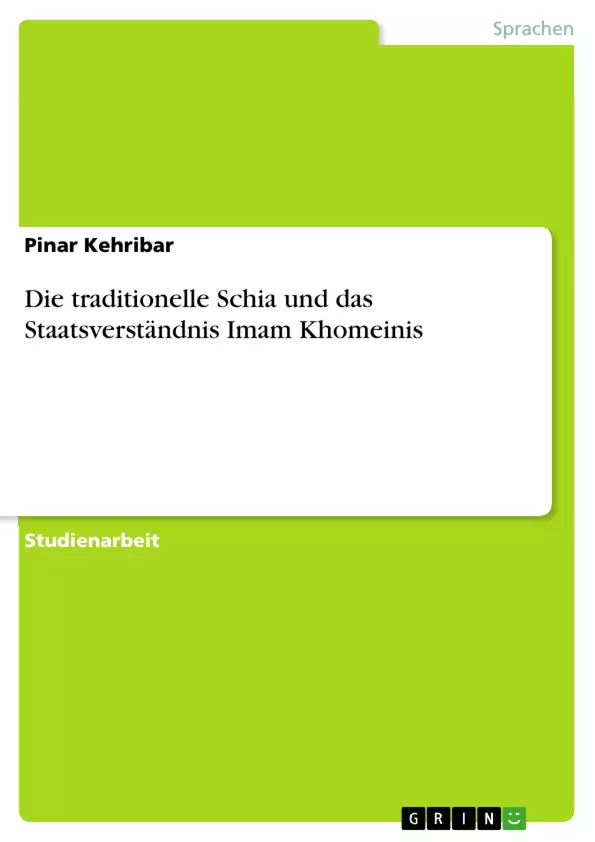Seit ihren Anfängen versuchen die Schiiten, die Frage nach der legitimen
Stellvertreterschaft des Verborgenen, Zwölften Imams zu beantworten. Aufgabe dieser Hausarbeit ist es, das Spannungsverhältnis zwischen den Schiitischen Gelehrten, der ´ulamā´ und den weltlichen Herrschern von den Anfängen der Schia (680/684) bis zur Islamischen Revolution im Iran 1979 wiederzugeben. Ich bin hierbei vor allem auf die letzten beiden Dynastien eingegangen. Dabei ist mein Hauptanliegen aufzuzeigen, inwiefern sich die Ansichten der Schia bezüglich der Beteiligung an der Regierungsausübung, von Mitbestimmung bis hin zur vollen Ausübung, durch die Jahrhunderte hinweg wandeln, und worin sich Khomeinis Staatsverständnis von dem der traditionellen Schia unterscheidet.
Inhalt:
1. Die Schia und ihr Verhältnis zu den jeweiligen weltlichen
Herrschern S. 3-4
1.1 Die Qağaren-Dynastie S. 4-5
1.2 Die Pahlavi-Dynastie S. 5-6
2. Ayatollāh Khomeini und die islamische Revolution S. 6-8
3. Die Grundprinzipien islamischer Staatstheorie und
Khomeinis Verständnis eines islamischen Staates S. 8-10
3.1 Khomeini und die Wilāyat faqīh S.10-12
3.2 Relative und absolute Statthalterschaft S.13
4. Die Umsetzung von Khomeinis Vorstellungen durch
die Verfassung der Islamischen Republik Iran S.13-15
5. Anhang: Die Imame der Zwölfer-Schia S.15
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Schia und ihr Verhältnis zu den jeweiligen weltlichen Herrschern 680-1979
- Die Qāğāren-Dynastie (bis 1925)
- Die Pahlavi-Dynastie (1925-1979)
- Ayatollah Khomeini und die Islamische Revolution 1979
- Die Grundprinzipien islamischer Staatstheorie und Khomeinis Verständnis eines islamischen Staates
- Khomeini und die Wilāyat faqih
- Relative und absolute Statthalterschaft
- Die Umsetzung von Khomeinis Vorstellungen durch die Verfassung der Islamischen Republik Iran
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen schiitischen Gelehrten ('ulamā') und weltlichen Herrschern von den Anfängen der Schia bis zur Islamischen Revolution 1979 im Iran. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des schiitischen Staatsverständnisses und den Unterschieden zwischen der traditionellen Schia und Khomeinis Interpretation.
- Die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen der Schia und weltlichen Herrschern.
- Die Rolle der schiitischen Gelehrten ('ulamā') in der politischen Landschaft.
- Das Verständnis des Imamats und der legitimen Herrschaft in der schiitischen Tradition.
- Khomeinis Konzept der Wilāyat faqih und seine Auswirkungen auf die iranische Staatsordnung.
- Der Vergleich zwischen dem traditionellen schiitischen Staatsverständnis und Khomeinis Vision eines islamischen Staates.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die zentrale Fragestellung der Arbeit: die Untersuchung des Spannungsverhältnisses zwischen schiitischen Gelehrten und weltlichen Herrschern vom Ursprung der Schia bis zur iranischen Revolution 1979. Sie betont die Analyse der Entwicklung des schiitischen Staatsverständnisses im Laufe der Geschichte und den Fokus auf den Unterschied zwischen der traditionellen Schia und Khomeinis Sichtweise. Die Arbeit konzentriert sich auf die letzten beiden Dynastien, die Qadscharen und Pahlavi, um die historische Entwicklung nachzuvollziehen.
Die Schia und ihr Verhältnis zu den jeweiligen weltlichen Herrschern 680-1979: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Schia und ihr wechselhaftes Verhältnis zu weltlichen Herrschern. Von ihren Anfängen als oppositionelle Minderheit bis hin zu Phasen größerer politischer Einflussnahme unter den Buyiden wird die Entwicklung der schiitischen Beteiligung an der Politik dargestellt. Der Kern der schiitischen Staatslehre, die Vorrangstellung der Imame in religiöser und politischer Führung, wird erläutert, sowie die unterschiedlichen schiitischen Richtungen hinsichtlich der Anerkennung der Imame. Die Rolle der Imame als unfehlbare Führer und die Herausforderung ihrer Abwesenheit nach dem Verschwinden des zwölften Imams wird beleuchtet.
1.1 Die Qāğāren-Dynastie (bis 1925): Dieses Unterkapitel analysiert die Rolle der 'ulamā' während der Qāğāren-Dynastie. Im Gegensatz zu den Safaviden, die eine religiöse Legitimation beanspruchten, fehlte den Qadschren diese aufgrund ihrer türkmenischen Abstammung. Die 'ulamā' erlangten dadurch mehr Unabhängigkeit und Einfluss, indem sie die Stellvertretung des zwölften Imams beanspruchten. Sie fungierten als Vermittler zwischen Bevölkerung und Regierung, bewahrten die Interessen der Bevölkerung und des Landes vor europäischen Einflüssen. Ihre enge Verbindung zum Basar und ihre wirtschaftliche Grundlage durch den Khums (Einkommensteuer) wird hervorgehoben.
1.2 Die Pahlavi-Dynastie (1925-1979): (Hier fehlt im Ausgangstext der Inhalt dieses Abschnitts. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Ayatollah Khomeini und die Islamische Revolution 1979: (Hier fehlt im Ausgangstext der Inhalt dieses Abschnitts. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Die Grundprinzipien islamischer Staatstheorie und Khomeinis Verständnis eines islamischen Staates: (Hier fehlt im Ausgangstext der Inhalt dieses Abschnitts. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Die Umsetzung von Khomeinis Vorstellungen durch die Verfassung der Islamischen Republik Iran: (Hier fehlt im Ausgangstext der Inhalt dieses Abschnitts. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
Schlüsselwörter
Schia, Imamat, Wilāyat faqih, Islamische Revolution, Iran, 'ulamā', Qāğāren-Dynastie, Pahlavi-Dynastie, politische Theologie, schiitisches Staatsverständnis, religiöse Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Schia und ihr Verhältnis zu weltlichen Herrschern im Iran
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen schiitischen Gelehrten ('ulamā') und weltlichen Herrschern im Iran von den Anfängen der Schia bis zur Islamischen Revolution 1979. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des schiitischen Staatsverständnisses und den Unterschieden zwischen der traditionellen Schia und Khomeinis Interpretation.
Welche Zeiträume und Dynastien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung vom Ursprung der Schia bis 1979, mit besonderem Augenmerk auf die Qāğāren-Dynastie (bis 1925) und die Pahlavi-Dynastie (1925-1979).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Schia und weltlichen Herrschern, die Rolle der 'ulamā' in der Politik, das Verständnis des Imamats und der legitimen Herrschaft in der schiitischen Tradition, Khomeinis Konzept der Wilāyat faqih und dessen Auswirkungen, sowie einen Vergleich zwischen traditionellem und khomeinistischem schiitischen Staatsverständnis.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Beziehung zwischen Schia und weltlichen Herrschern (unterteilt in die Qāğāren- und Pahlavi-Dynastien), ein Kapitel zu Ayatollah Khomeini und der Islamischen Revolution, ein Kapitel zu den Grundprinzipien islamischer Staatstheorie und Khomeinis Verständnis eines islamischen Staates, ein Kapitel zur Umsetzung von Khomeinis Vorstellungen in der Verfassung und einen Anhang.
Was ist der Inhalt des Kapitels über die Qāğāren-Dynastie?
Dieses Kapitel analysiert die Rolle der 'ulamā' während der Qāğāren-Dynastie. Im Gegensatz zu den Safaviden fehlte den Qadschren eine religiöse Legitimation, was den 'ulamā' mehr Unabhängigkeit und Einfluss verschaffte. Sie fungierten als Vermittler zwischen Bevölkerung und Regierung und bewahrten die Interessen der Bevölkerung vor europäischen Einflüssen. Ihre enge Verbindung zum Basar und ihre wirtschaftliche Grundlage durch den Khums wird hervorgehoben.
Was ist der Inhalt der Kapitel über die Pahlavi-Dynastie, Khomeini, die islamische Staatstheorie und die iranische Verfassung?
Der Ausgangstext enthält keine Zusammenfassung für diese Kapitel.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Schia, Imamat, Wilāyat faqih, Islamische Revolution, Iran, 'ulamā', Qāğāren-Dynastie, Pahlavi-Dynastie, politische Theologie, schiitisches Staatsverständnis, religiöse Legitimation.
- Quote paper
- Pinar Kehribar (Author), 2005, Die traditionelle Schia und das Staatsverständnis Imam Khomeinis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94254