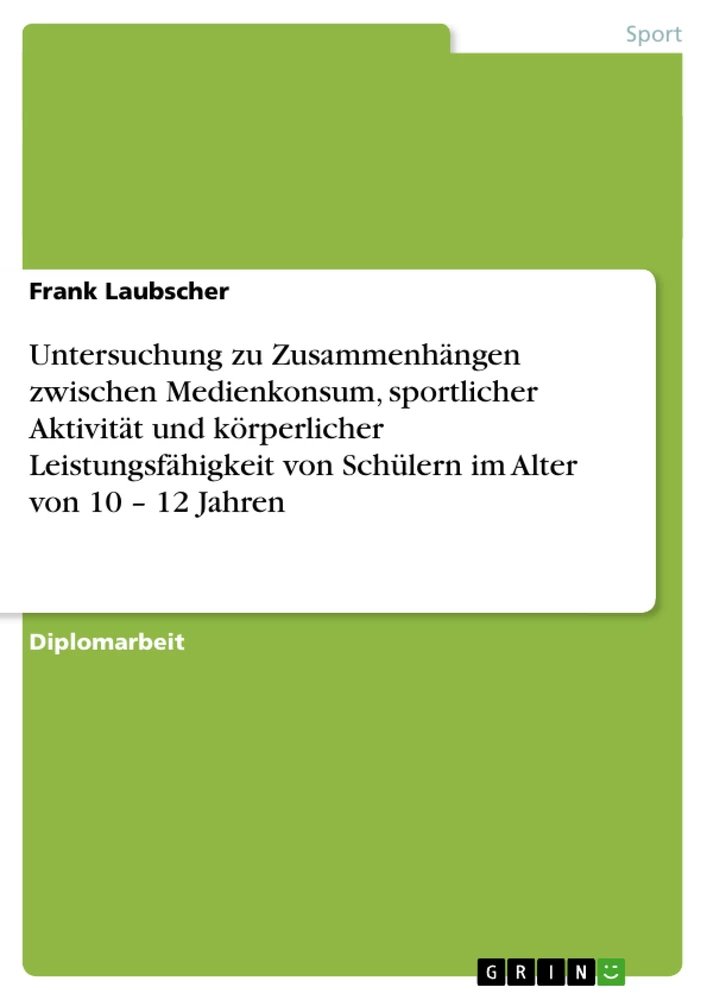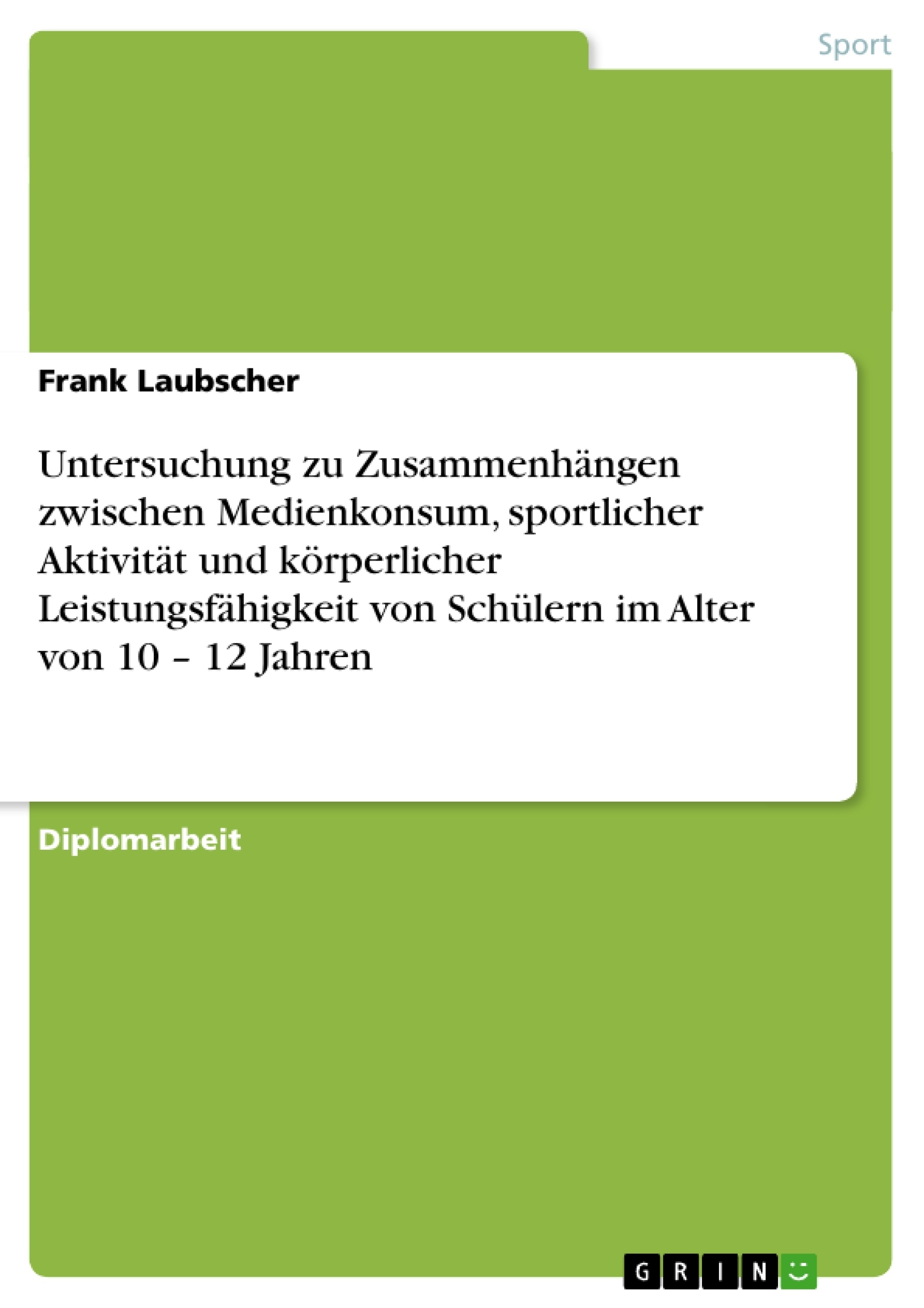Angesichts der großen Bedeutung elektronischer Medien für das Freizeitverhalten heutiger Kinder wird eine Abnahme der körperlich – sportlichen Aktivität befürchtet, mit der Folge, dass es aufgrund des Bewegungsmangels zu einer Verschlechterung der motorischen Leistungsfähigkeit kommt und das Auftreten von Übergewicht und Adipositas bereits in jungen Jahren begünstigt wird. Der unterstellte Zusammenhang zwischen Mediennutzung und körperlich-sportlicher Aktivität konnte allerdings bislang nicht überzeugend nachgewiesen werden.
Ziel der vorliegenden Studie war es, die Zusammenhänge zwischen Medienkonsum, sportlicher Aktivität und körperlicher Leistungsfähigkeit von Schülern im Alter von 10 – 12 Jahren zu untersuchen. Mit Hilfe eines kindspezifischen Motoriktests wurden die aktuelle Leistung der Kinder festgestellt und anhand eines Fragebogens die körperlich-sportliche Aktivität sowie das Medienkonsumverhalten im Alltag erfasst.
Anhand der gefundenen Ergebnisse in der untersuchten Altersgruppe konnte gezeigt werden, dass die Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge nicht so trivial sind wie oft angenommen. Ein Zusammenhang zwischen dem täglichen Medienkonsum und der körperlich-sportlichen Aktivität ist zwar nicht grundsätzlich auszuschließen, der Einfluss von Medien auf die sportliche Aktivität sollte aber auch nicht überbewertet werden. So gehört z. B. das Sporttreiben, entgegen manch spektakulärer Überzeichnung vom Ausmaße der Inaktivität heutiger Kinder, weiterhin zu den favorisierten Freizeitbeschäftigungen bei Kindern. Es zeigt sich, dass in Abhängigkeit von der Beschäftigungsdauer und Art der Medien unterschiedliche Zusammenhangsmuster zwischen Medienkonsum und sportlicher Aktivität bestehen und dass der Gefahr der Verallgemeinerung entgegengewirkt werden muss.
Ebenso lassen sich zwar in Abhängigkeit vom zeitlichen Umfangs der Medienzuwendung in einzelnen motorischen Dimensionen Leistungsunterschiede feststellen, von einem generellen Rückgang der motorischen Leistungsfähigkeit aufgrund von Medienkonsum ist allerdings nicht auszugehen. Die Annahme, dass übermäßiger Medienkonsum zum Auftreten von Übergewicht beitragen kann, wird durch die vorliegende Studie gestützt. Der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang kann allerdings nicht eindeutig geklärt werden und bedarf einer vertiefenden Analyse.
Schlüsselwörter: Medienkonsum, motorische Leistungsfähigkeit, sportliche Aktivität, Kinder, Übergewicht, Adipositas
Inhaltsverzeichnis
- Problemdarstellung, Ziel und Aufbau der Arbeit
- Problemdarstellung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- Motorische Leistungsfähigkeit
- Motorik
- Sportliche Leistungsfähigkeit
- Fähigkeiten und Fertigkeiten
- Systematisierung der allgemeinen motorischen Fähigkeiten
- Motorische Entwicklung
- Ausgewählte Theorien und Modelle der motorischen Entwicklung
- Anlage und Umwelt
- Methoden zur Einschätzung der Erblichkeit
- Einfluss von Anlage und Umwelt auf die motorische Leistungsfähigkeit
- Entwicklungsphasen motorischer Basisdimensionen im Kindes- und Jugendalter
- Ausdauer
- Aerobe Ausdauer
- Anaerobe laktazide Ausdauer
- Kraft
- Schnelligkeit
- Koordination
- Beweglichkeit
- Säkulare Trends und Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen
- Sportliche Akzeleration
- Aktuelle Ergebnisse zur Einschätzung der motorischen Leistungsfähigkeit
- Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)
- Motorik-Modul („MoMo“)
- Sportmotorische Tests
- Motorik-Modul Testbatterie
- Aktivitätsfragebogen
- Erste Ergebnisse zum Motorik-Modul
- Einflussfaktoren auf die motorische Leistungsfähigkeit
- Übergewicht und Adipositas
- BMI
- Prävalenz von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen
- Sozioökonomische und -ökologische Einflussfaktoren
- Bewegungsaktivität von Kindern und Jugendlichen
- Medienkonsum
- Definition Medien
- Kindliche Medienkultur
- Themeninteresse
- Gerätebesitz
- Freizeitaktivitäten
- Medienbindung
- Computernutzung
- Computerspiele
- Medienkonsum gleich Konkurrenz zur körperlich-sportlichen Aktivität?
- Darstellung der empirischen Untersuchung
- Fragestellung und Arbeitshypothesen
- Untersuchungsmethodik
- Personenstichprobe
- Variablenstichprobe
- Motorische Leistungsfähigkeit: Kinderturntest
- Körperlich – sportliche Aktivität: Aktivitätsfragebogen
- Medienkonsum: Fragebogen KIM-Studie
- Ablauf der Untersuchung
- Statistische Hypothesen
- Statistik
- Ergebnisdarstellung
- Deskriptive Statistik
- Alter, Größe, Gewicht und BMI
- Ergebnisse des Kinderturntest
- Körperlich-sportliche Aktivität
- Körperlich-sportliche Aktivität allgemein
- Körperlich-sportliche Aktivität in der Schule
- Körperliche Aktivität im Alltag
- Verfügbarkeit von Sportstätten und -geräten
- Sportliche Aktivität in der Freizeit organisiert im Verein
- Sportliche Aktivität in der Freizeit außerhalb des Vereins
- Sportverhalten der Bezugspersonen/Peergroup
- Medienkonsum
- Medienausstattung
- Computerspiele
- Medienbindung
- Hypothesenprüfung
- Motorische Leistungsfähigkeit und Medienkonsum
- Körperlich-sportliche Aktivität und Medienkonsum
- Body-Mass- Index und Medienkonsum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Medienkonsum, sportlicher Aktivität und körperlicher Leistungsfähigkeit von Schülern im Alter von 10 bis 12 Jahren. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen von Medienkonsum auf die motorische Leistungsfähigkeit und sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen zu beleuchten. Hierfür wird die aktuelle Forschungslage auf dem Gebiet der motorischen Entwicklung und des Medienkonsums zusammengefasst. Darüber hinaus wird die empirische Untersuchung von Schülern im Alter von 10 bis 12 Jahren vorgestellt, um die Hypothese zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen Medienkonsum und motorischer Leistungsfähigkeit bzw. sportlicher Aktivität besteht.
- Zusammenhang zwischen Medienkonsum und motorischer Leistungsfähigkeit
- Einfluss von Medienkonsum auf die sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen
- Motorische Entwicklung und Einflussfaktoren auf die Leistungsfähigkeit
- Analyse des Medienkonsums und der Medienkultur von Kindern und Jugendlichen
- Empirische Untersuchung zur Überprüfung der Hypothese
Zusammenfassung der Kapitel
- Problemdarstellung, Ziel und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein und beleuchtet die aktuelle Problematik des Medienkonsums und seiner potenziellen Auswirkungen auf die motorische Entwicklung und sportliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen. Es wird die Zielsetzung der Arbeit dargelegt und die Gliederung der Arbeit beschrieben.
- Motorische Leistungsfähigkeit: Dieses Kapitel bietet einen grundlegenden Einblick in die Konzepte der Motorik und der sportlichen Leistungsfähigkeit. Es werden die verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Kontext der motorischen Entwicklung erläutert und die Systematisierung der allgemeinen motorischen Fähigkeiten vorgestellt.
- Motorische Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten im Kindes- und Jugendalter. Es werden ausgewählte Theorien und Modelle der motorischen Entwicklung dargestellt, und der Einfluss von Anlage und Umwelt auf die motorische Leistungsfähigkeit wird diskutiert.
- Entwicklungsphasen motorischer Basisdimensionen im Kindes- und Jugendalter: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung verschiedener motorischer Basisdimensionen wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Beweglichkeit im Kindes- und Jugendalter. Es wird die Bedeutung dieser Basisdimensionen für die motorische Entwicklung und die sportliche Leistungsfähigkeit beleuchtet.
- Säkulare Trends und Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen: Dieses Kapitel präsentiert aktuelle Trends und Studien zur motorischen Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Es werden die Ergebnisse von Studien wie dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) und dem Motorik-Modul („MoMo“) vorgestellt, um die aktuelle Entwicklung der motorischen Leistungsfähigkeit zu beleuchten.
- Einflussfaktoren auf die motorische Leistungsfähigkeit: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Einflussfaktoren auf die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen. Es werden die Themen Übergewicht und Adipositas, sozioökonomische und -ökologische Einflussfaktoren sowie die Bewegungsaktivität von Kindern und Jugendlichen behandelt.
- Medienkonsum: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Medien“ und untersucht die mediale Kultur von Kindern und Jugendlichen. Es werden verschiedene Aspekte des Medienkonsums, wie Themeninteresse, Gerätebesitz, Freizeitaktivitäten, Medienbindung, Computernutzung und Computerspiele, beleuchtet.
- Darstellung der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die durchgeführt wurde, um die Hypothese über den Zusammenhang zwischen Medienkonsum und motorischer Leistungsfähigkeit bzw. sportlicher Aktivität zu überprüfen. Es werden die Fragestellung und Arbeitshypothesen der Untersuchung vorgestellt, die Stichproben beschrieben und der Ablauf der Untersuchung erläutert.
Schlüsselwörter
Medienkonsum, motorische Leistungsfähigkeit, sportliche Aktivität, Kinder, Jugendliche, Entwicklung, Einflussfaktoren, Übergewicht, Adipositas, Bewegungsaktivität, empirische Untersuchung, Hypothese.
- Citation du texte
- Frank Laubscher (Auteur), 2008, Untersuchung zu Zusammenhängen zwischen Medienkonsum, sportlicher Aktivität und körperlicher Leistungsfähigkeit von Schülern im Alter von 10 – 12 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94292