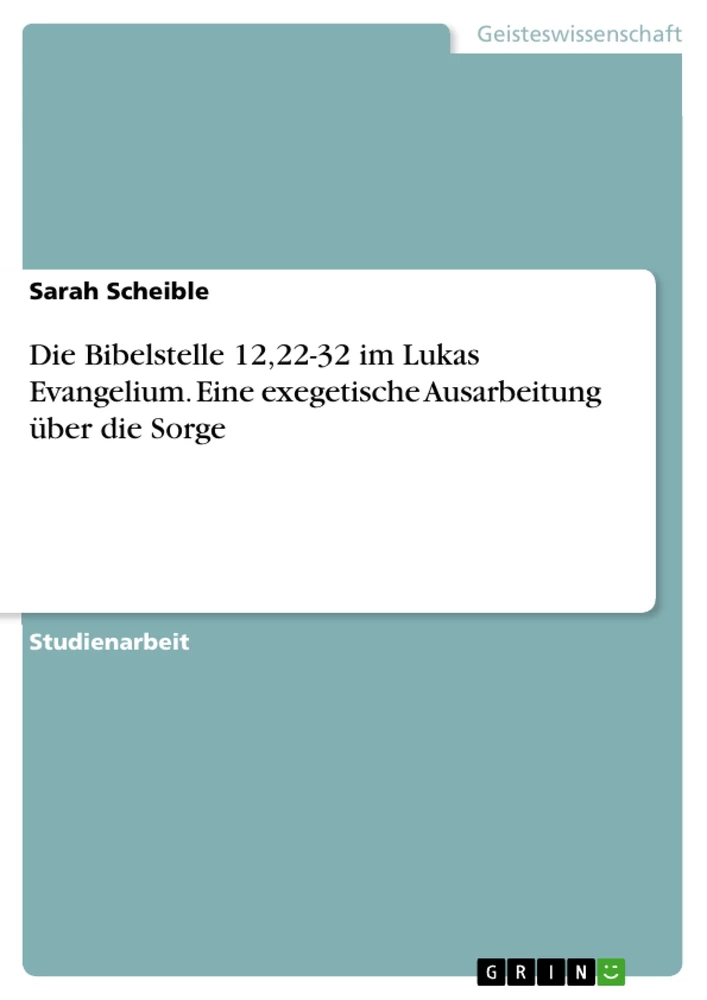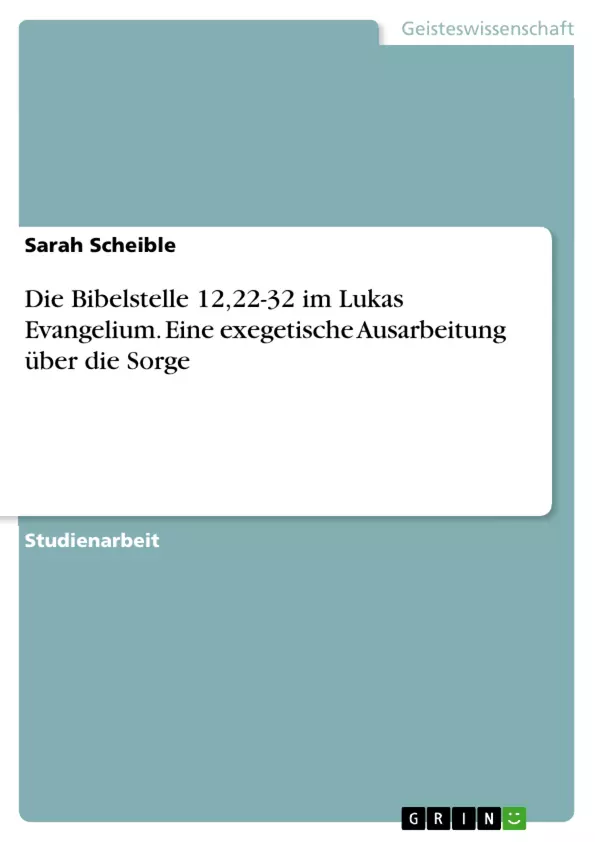In der Arbeit wird die Frage gestellt, woher Jesus das bedingungslose Vertrauen in Gott nimmt und wie wir Menschen eine ebenso tiefe Verbindung erlangen können? Reicht unser Glaube aus, um das nahende Reich Gottes zu spüren und zu erkennen?
Der Mensch wird als Wesen geboren, welches sich um sich selbst dreht und in ständiger Sorge lebt, dass ihm Unheil widerfährt, beziehungsweise jede erfolgte Tat eine Konsequenz nach sich zieht. Diese irdischen und menschlichen Sorgen prägen unseren Alltag und ziehen sich wie ein roter Faden durch unsere gesamte Lebenslaufbahn. Sorgen, die uns täglich begegnen, uns zermürben aber im Gegenzug auch zu neuem Ehrgeiz führen. In der vorliegenden Textstelle wird dieses Themenspektrum behandelt und der Versuch gestartet, eine Antwort darauf zu finden, weshalb der Mensch sich von seinen Sorgen leiten und lenken lässt. Ein Blick auf die historischen und die gegenwärtigen Verhältnisse gibt uns Einblicke in das Handeln des Menschen und den Stellenwert, den die Sorge im Leben eines Menschen einnimmt. Die Sorge um das Überleben, die schwierigen Lebensbedingungen und die großen existenziellen Lebensfragen beschäftigen die Menschheit seit Jahrhunderten.
Im vorliegenden Text (Lukas 12,22-32) wird der Versuch gewagt, den Menschen Halt im Glauben zu bieten und wendet den Blick hin zu einem Leben mit Gott, der uns Kraft geben soll und sich um die Menschheit sorgt. Der Text nimmt eine klar strukturierte Haltung ein. Als Hauptakteur steht Jesus im Fokus des Geschehens, der durch seine Mahnungen und bild-hafte Sprache ein Umdenken bei seinen Jüngern erreichen möchte. Er nutzt die Macht seiner Worte nicht, um seine Jünger zu belehren, sondern versucht durch Ratschläge eine Verbindung zu ihnen herzustellen und somit auf die Missstände in der Gemeinschaft hin-zuweisen. Auf seine charismatische und vertrauensvolle Art beschreibt Jesus gekonnt, welche Absichten hinter den Handlungen Gottes stehen und versucht ihnen ihre Position bei Gott deutlich zu machen. Der Mensch als Stellvertreter und Sinnbild Gottes, der seinem Willen folgt und sein Wort hört. Die Art der Belehrung findet, typisch für Jesus, auf eine sehr metaphorische Weise statt. Jesus wird während seiner Rede nicht unterbrochen und der Leser kann erkennen, dass er eine wichtige Position bekleidet, die ihm Respekt und Ehrfurcht einbringt. Es scheint eine Gottesfürchtigkeit in der Luft zu hängen, die Spannung aufbaut und eine besondere Atmosphäre bewirkt.
Inhaltsverzeichnis
- Wiedergabe der Textstelle Lk 12,22-32
- Einleitende Überlegungen am Text
- Kontextualisierung des Textes
- Angaben zum Autor
- Verfassungsort und -zeit
- Adressaten
- Gliederung, Aufbau und Inhalt
- Quellen
- Theologie des Lukasevangeliums
- Verfassungszweck
- Interpretation des Textes
- Exegetische Betrachtung
- Die Sorge
- Didaktische Überlegungen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text widmet sich der exegetischen Analyse des Lukasevangeliums, insbesondere der Stelle Lukas 12,22-32, welche sich mit dem Thema der Sorge und ihrer Überwindung durch den Glauben an Gott beschäftigt.
- Die Bedeutung des Glaubens in der Überwindung von Sorgen
- Die Rolle der göttlichen Fürsorge für den Menschen
- Die Kritik an der menschlichen Neigung zur Übertreibung und Besorgnis
- Das Reich Gottes als Ziel und Grundlage des Lebens
- Die metaphorische Sprache Jesu und ihre didaktische Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Wiedergabe der Textstelle Lk 12,22-32: Dieser Abschnitt präsentiert den Text von Lukas 12,22-32, der sich mit der falschen und rechten Sorge auseinandersetzt. Jesus ermahnt seine Jünger, sich nicht um irdische Dinge zu sorgen, sondern sich auf das Reich Gottes zu konzentrieren.
- Einleitende Überlegungen am Text: Dieser Abschnitt liefert eine erste Interpretation des Textes und stellt die zentrale Frage nach der Ursache menschlicher Sorgen und dem Weg zur Überwindung derselben.
- Kontextualisierung des Textes: In diesem Kapitel wird der Text in seinen historischen und literarischen Kontext eingebettet. Es werden Angaben zum Autor, zum Entstehungszeitpunkt und -ort sowie zu den Adressaten des Textes gegeben.
- Interpretation des Textes: Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte exegetische Analyse des Textes, untersucht die Bedeutung der Sorge und ihrer Überwindung, und präsentiert didaktische Überlegungen zur Anwendung des Textes im pädagogischen Kontext.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Textes repräsentieren, sind unter anderem: Sorge, Glaube, Reich Gottes, Fürsorge, Exegese, Lukasevangelium, Didaktik, metaphorische Sprache, Jesus Christus, Gott.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Lukas 12,22-32?
Jesus mahnt seine Jünger, sich nicht von irdischen Sorgen um Nahrung und Kleidung beherrschen zu lassen, sondern bedingungslos auf die Fürsorge Gottes zu vertrauen und nach dem Reich Gottes zu trachten.
Warum nutzt Jesus Metaphern wie Raben und Lilien?
Diese Bilder dienen als didaktisches Mittel. Wenn Gott sich bereits um die Vögel und Blumen sorgt, die nicht arbeiten, wie viel mehr wird er sich dann um den Menschen sorgen, der in seinen Augen wertvoller ist.
Was bedeutet „Sorge“ in diesem biblischen Kontext?
Sorge wird hier als ein „Sich-um-sich-selbst-Drehen“ verstanden, das den Menschen vom Glauben ablenkt. Es geht um die existenzielle Angst, die durch das Vertrauen in Gott überwunden werden soll.
Was ist das „Reich Gottes“ in dieser Textstelle?
Das Reich Gottes ist das Ziel und die Grundlage des Lebens. Wer es an erste Stelle setzt, dem wird laut Verheißung alles andere „zugegeben“.
An wen richtet sich Jesus in dieser Rede?
Jesus spricht direkt zu seinen Jüngern. Die Atmosphäre ist geprägt von Ehrfurcht und Respekt gegenüber seiner charismatischen Autorität.
- Quote paper
- Sarah Scheible (Author), 2018, Die Bibelstelle 12,22-32 im Lukas Evangelium. Eine exegetische Ausarbeitung über die Sorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/942986