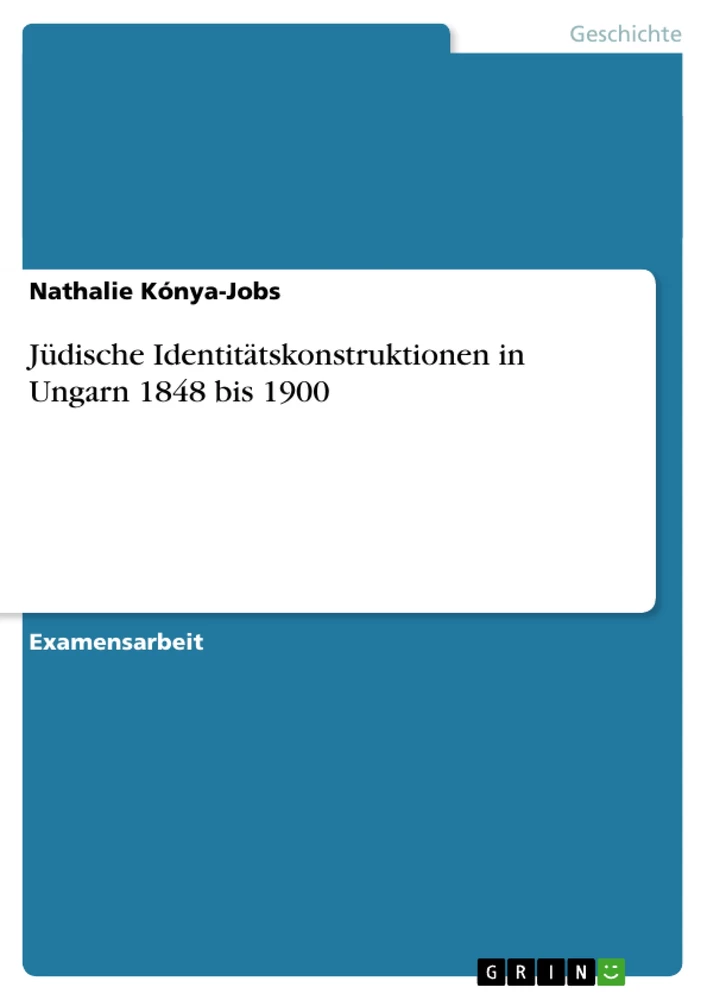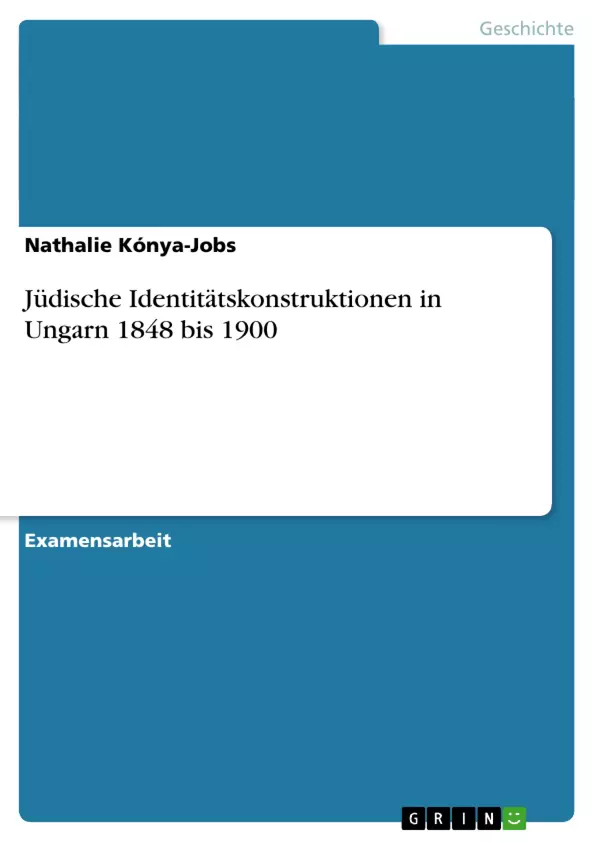Die vorliegende Arbeit geht von der Hypothese aus, dass personale und kollektive Identitäten Konstruktionen sind. Ihre Quellen sind historiographische Schriften, die zwischen 1848 und 1900 in Ungarn erschienen sind und sich mit ungarisch-jüdischer Geschichte beschäftigen.
Die Arbeit fragt danach, wie Autoren jüdische Identität und jüdische Geschichte
narrativ konstruierten und sie nach außen in ihren Schriften vertraten. Welche Identitätsmuster gaben sie ihren jüdischen Lesern an die Hand? Welche ‚Identitätspolitik’ verfolgten sie nicht-jüdischen Lesern gegenüber? Ferner beleuchtet die Analyse die innerjüdischen Einflüsse, denen Identitätskonstruktionen unterlagen. Auch die Rahmenbedingungen der Identitätskonstruktionen zwischen 1848 und 1900 werden in die Analyse mit einbezogen. Zunächst werden Identitätstheorien aus der Philosophie, Psychoanalyse, Sozialpsychologie und Soziologie kritisch aufgearbeitet. Die nächsten beiden Abschnitte beschäftigen sich mit der identitätsstiftenden
Wirkung der jüdischen Religion und der Verbindung der Identitätsfrage mit dem Entstehen der jüdischen Geschichtswissenschaft.
Mit Hilfe der Identitätstheorien wird ein Perspektivenkatalog entwickelt, anhand dessen
die Quellen nach Identitätskonstruktionen befragt werden. Die Auswertung wird anschließend durchgeführt.
Um weiter mit den Ergebnissen arbeiten zu können, werden Hintergrundinformationen
nachgetragen. Deshalb beschäftigt sich die Untersuchung mit den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen jüdischer Identitätskonstruktionen und mit der Ausdifferenzierung des ungarischen Judentums zwischen 1848-1900.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Quellenanalyse systematisiert und typologisiert.
Die Examensarbeit endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, einer Schlussbetrachtung und einem Ausblick auf weitere Forschungsfragen, die sich aus der Darstellung ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Anmerkungen zum Forschungsstand und zur verwendeten Literatur
- II. Theorien zur,Personalen Identität'
- 1. Der Identitätsbegriff in der Psychoanalyse Sigmund Freuds und der psychoanalytischen Ich-Psychologie Erik H. Eriksons
- 2. ,Symbolischer Interaktionismus' – George Herbert Mead, Irving Goffman und Lothar Krappmann
- 3. ,Patchworkidentitäten' – Der Ansatz Heiner Keupps
- III. Theorien zur,Kollektiven Identität'
- 1. Allgemeines
- 2. ,Kollektive Identität' als heuristisches Modell in der Psychologie, Interaktionsforschung und Kultursoziologie – Jürgen Straub und Alois Hahn
- 3. Bernhard Giesens Konzept
- 4. Der Begriff, Kollektive Identität' zwischen, Plastikwort' und heuristischer Terminologie
- IV. Aspekte der identitätsstiftenden Wirkung der jüdischen Religion
- V. ,Identität und jüdische Geschichtswissenschaft
- VI. Perspektivenkatalog zur Quellenanalyse
- 1. Allgemeines
- 2. Die mediale Perspektive
- 2.1. Die Narrativität der Identitätskonstruktionen
- 2.2. Der Appellcharakter der Identitätskonstruktionen
- 3. Interaktive Zuschreibungsmechanismen
- 3.1. Die, abgrenzende Zuschreibung'
- 3.2. Die, apologetische Zuschreibung'
- 3.3. Die, kompilatorische Zuschreibung'
- 4. Arten des Umgangs mit Brüchen und Auflösungsphänomenen
- 4.1. Die Haltung gegenüber veränderten Lebensumständen
- 4.2. Die Konstruktion über bestimmte Anknüpfungspunkte
- VII. Analyse der Quellen
- 1. Einführung in die Quellen
- 2. Analyse
- 2.1. Die mediale Perspektive
- 2.1.1. Die Narrativität der Identitätskonstruktionen
- 2.1.2. Der Appellcharakter der Identitätskonstruktionen
- 2.2. Interaktive Zuschreibungsmechanismen kollektiver Identität
- 2.2.1. Abgrenzende Zuschreibung
- 2.2.2. Apologetische Zuschreibung
- 2.2.3. Kompilatorische Zuschreibung
- 2.3. Arten des Umgangs mit Brüchen und Auflösungsphänomenen
- 2.3.1. Die Haltung gegenüber veränderten Lebensumständen
- 2.3.2. Die Konstruktion über Anknüpfungspunkte
- 2.1. Die mediale Perspektive
- VIII. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen jüdisch-ungarischer Identitätskonstruktionen im 19. Jahrhundert
- 1. Herkunft, Einwanderung, Bevölkerungsentwicklung und Zusammensetzung des ungarischen Judentums
- 2. Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen jüdisch-ungarischer Identitätskonstruktionen von der Reformzeit bis zur Jahrhundertwende
- 3. Der Beginn des politischen Antisemitismus in Ungarn
- 4. Die Ausdifferenzierung des ungarischen Judentums
- IX. Systematisierung und Typologie der Ergebnisse
- 1. Einleitung
- 2. Adressatenkreise und Textarten
- 3. Typen des Identitätsangebots und der Identitätskonstruktion
- 4. Mythen
- 4.1. Zu den Begriffen,Mythos' und,Mythologie'
- 4.2. ,Mythen' und,Mythologisierung' als Mittel der Identitätskonstruktion
- 5. Das Symbol als Ausdruck der Identität
- 5.1. Der Begriff, Symbol'
- 5.2. Die Wehrhaftigkeit als Symbol ungarisch-jüdischer Identität
- 6. Utopien
- 6.1. Der Begriff, Utopie'
- 6.2. Utopien als Mittel der Identitätskonstruktion
- X. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussbetrachtung
- XI. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Konstruktion von jüdischer Identität in Ungarn zwischen 1848 und 1900, basierend auf historiographischen Texten der Zeit. Sie fragt nach den narrativen Strategien der Autoren, wie sie jüdische Identität und Geschichte darstellten und welche Identitätsmuster sie ihren Lesern vermittelten.
- Narrative Konstruktion jüdischer Identität in historiographischen Texten
- Identitätspolitik gegenüber jüdischen und nicht-jüdischen Lesern
- Einflüsse innerjüdischer Debatten auf Identitätskonstruktionen
- Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen jüdischer Identitätskonstruktionen in Ungarn
- Entwicklungen innerhalb des ungarischen Judentums im 19. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage und die methodische Herangehensweise vor, die auf einer Analyse von Identitätskonstruktionen in historiographischen Texten beruht.
- II. Theorien zur,Personalen Identität': Es werden Theorien zur individuellen Identität aus der Philosophie, Psychoanalyse und Sozialpsychologie vorgestellt, um ein theoretisches Fundament für die Analyse zu schaffen.
- III. Theorien zur,Kollektiven Identität': Die Arbeit beleuchtet Theorien zur kollektiven Identität und deren Bedeutung für das Verständnis von Identitätsprozessen.
- IV. Aspekte der identitätsstiftenden Wirkung der jüdischen Religion: Dieser Abschnitt untersucht die Rolle der jüdischen Religion im Kontext von Identitätsbildung.
- V. ,Identität und jüdische Geschichtswissenschaft': Hier wird der Zusammenhang zwischen Geschichtswissenschaft und der Konstruktion von jüdischer Identität erörtert.
- VI. Perspektivenkatalog zur Quellenanalyse: Es werden verschiedene Perspektiven und Kategorien für die Analyse der Quellen in Bezug auf Identitätskonstruktionen entwickelt.
- VII. Analyse der Quellen: Die Arbeit analysiert die Quellen anhand des entwickelten Perspektivenkatalogs und untersucht narrative Strategien, appellative Elemente und interaktive Zuschreibungsmechanismen in den Texten.
- VIII. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen jüdisch-ungarischer Identitätskonstruktionen im 19. Jahrhundert: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die historischen und sozialen Bedingungen, die die Konstruktion von jüdischer Identität in Ungarn beeinflussten.
- IX. Systematisierung und Typologie der Ergebnisse: Die Ergebnisse der Quellenanalyse werden systematisch zusammengefasst und typologisiert, wobei Themen wie Mythen, Symbole und Utopien im Kontext von Identitätskonstruktionen betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen wie jüdische Identität, Geschichtswissenschaft, Narrative, Identitätspolitik, Identitätskonstruktionen, Religion, Mythen, Symbole, Utopien, Antisemitismus und der Ausdifferenzierung des ungarischen Judentums im 19. Jahrhundert. Die Analyse basiert auf historiographischen Texten, die in Ungarn zwischen 1848 und 1900 entstanden sind. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Geschichte und Geschichtsschreibung für die Konstruktion von Identität und die Rolle der Medien im Prozess der Identitätsvermittlung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde jüdische Identität in Ungarn im 19. Jahrhundert konstruiert?
Die Identität wurde narrativ über historiographische Schriften geformt, die versuchten, jüdische Geschichte mit der ungarischen Nationalgeschichte zu verknüpfen.
Welche Rolle spielte die jüdische Geschichtswissenschaft?
Die Entstehung der jüdischen Geschichtswissenschaft diente als identitätsstiftendes Mittel, um das Selbstverständnis des Judentums in einer Zeit des Umbruchs zu festigen.
Was bedeutet 'Identitätspolitik' in diesem Kontext?
Autoren verfolgten eine Politik der Rechtfertigung (Apologetik) gegenüber der nicht-jüdischen Mehrheit und boten gleichzeitig Identitätsmuster für die jüdische Leserschaft an.
Wie beeinflusste der Antisemitismus die Identitätsbildung?
Der aufkommende politische Antisemitismus in Ungarn ab den 1870er Jahren zwang das Judentum zu neuen Abgrenzungs- und Integrationsstrategien.
Welche Theorien werden zur Analyse herangezogen?
Die Arbeit nutzt Konzepte von Freud, Erikson, Mead und Keupp (Patchworkidentitäten), um personale und kollektive Identitätsmuster zu untersuchen.
- Quote paper
- Nathalie Kónya-Jobs (Author), 2006, Jüdische Identitätskonstruktionen in Ungarn 1848 bis 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94302