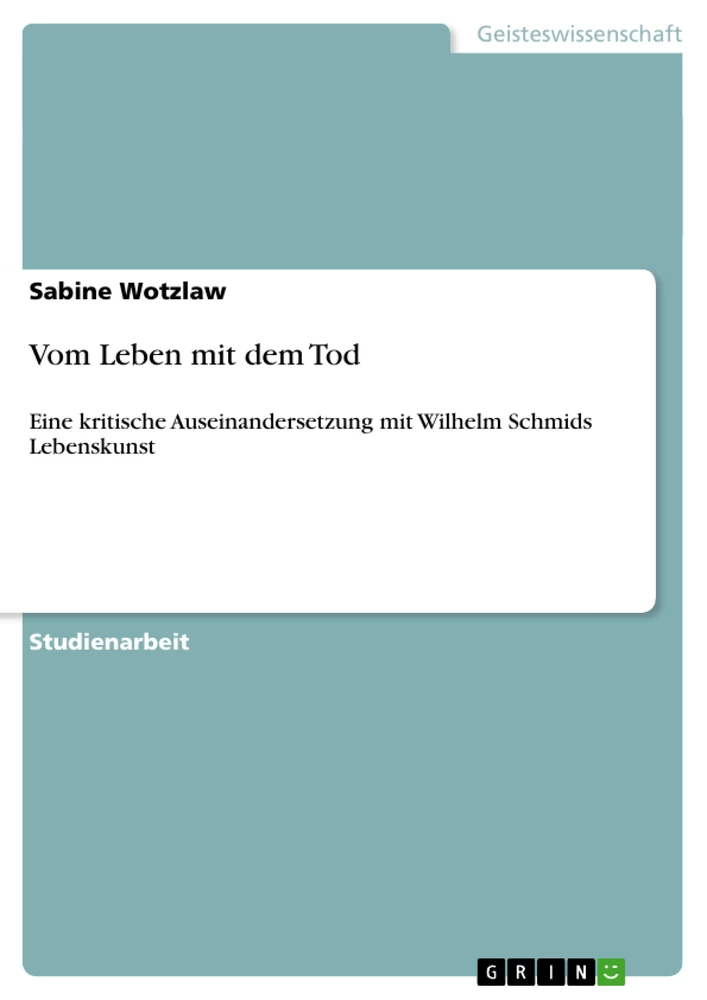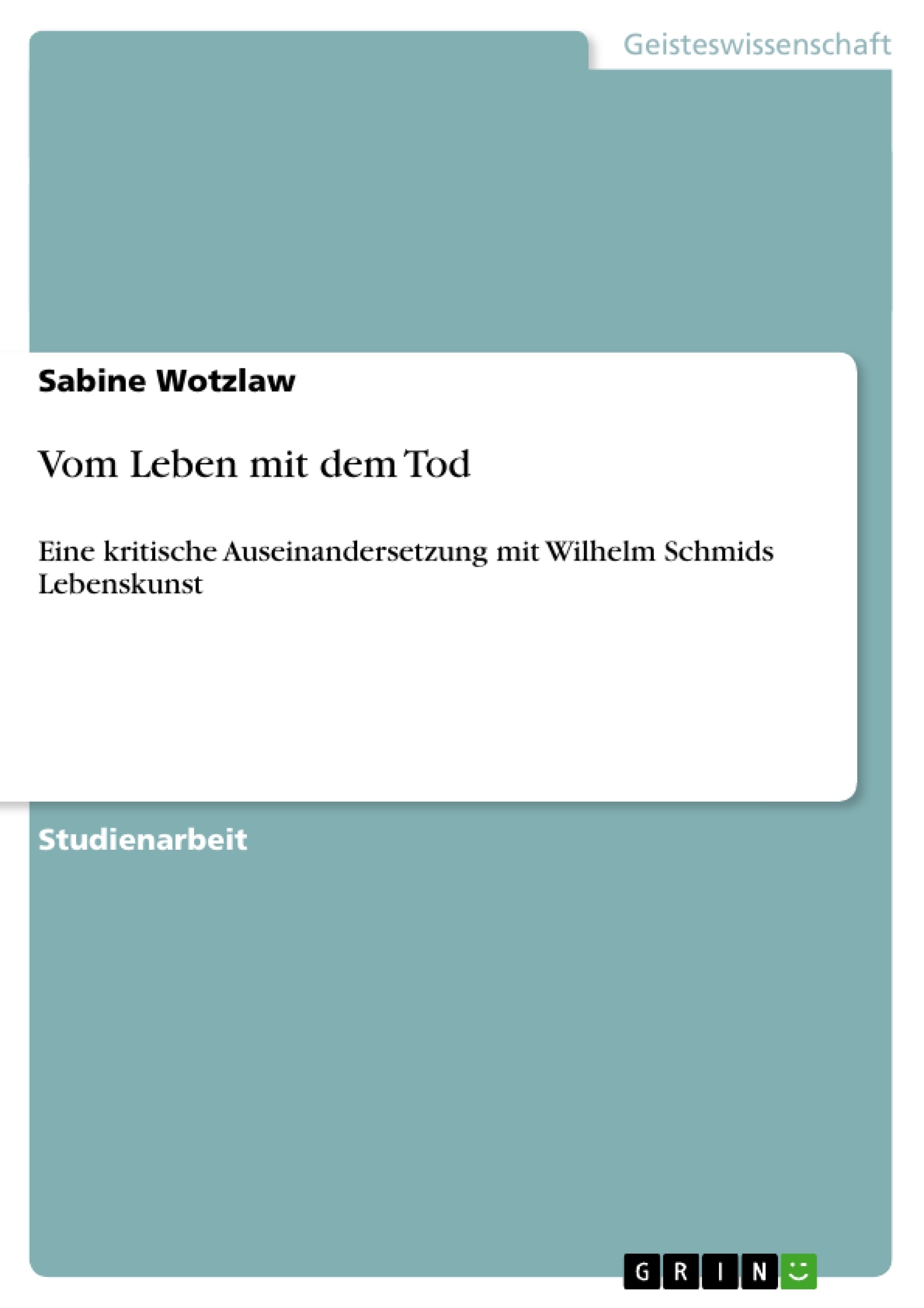Was hat es mit diesem Leben auf sich, wenn Beziehungen zerbrechen, sich Zusammenhänge auflösen und der Einzelne mit Situationen konfrontiert wird, die ihm von Grund auf fremd sind? Immer dann, wenn diese Fragen nach dem eigenen Leben auftreten, kommt die Lebenskunst ins Spiel. Unabhängig von Zeit und Kultur fragen diejenigen nach Lebenskunst, für die sich das Leben nicht mehr von selbst versteht. Sobald der Orientierungsverlust eintritt, setzt die Sinnsuche ein. Bei einer Philosophie der Lebenskunst steht die theoretische Reflexion des Lebens, wie es bewusst gelebt werden könnte, im Mittelpunkt. „Unter Lebenskunst wird grundsätzlich die Möglichkeit und die Anstrengung verstanden, das Leben auf reflektierte Weise zu führen und es nicht unbewusst einfach nur dahingehen zu lassen.“ Dabei besteht die Aufgabe der Philosophie in erster Linie darin, durch Reflektiertheit Möglichkeiten zu eröffnen. Insofern ist die Philosophie der Lebenskunst eine Lebenshilfe. Wer die Frage nach dem Leben stellt, befindet sich auf der Suche nach einer Antwort, die das Lebenkönnen wieder ermöglicht. Die Frage „Was soll ich tun?“ hat hier keinen moralischen, sondern einen existenziellen Charakter. Die Kunst besteht in diesem Fall darin, mit der Fragwürdigkeit zu leben. Noch entscheidender als die Frage nach den Möglichkeiten der Lebensgestaltung ist die Frage, warum es überhaupt Sinn macht, das Leben zu gestalten? Über Sinn und Sinnlosigkeit entscheidet das Individuum selbst. Die antike Philosophie gibt eine Antwort auf die Frage, warum es Sinn macht, das eigene Leben zu gestalten. Der Sinn liegt in der Kürze des Lebens. Das ist das finale Argument der Lebenskunst. Es ist das finale Argument, weil es sich auf das Ende bezieht. Es ist zutiefst menschlich, über den Tod nachzudenken. Der Tod meint das Ende des Lebens, das durch das Sterben eintritt. Allerdings ist sowohl unser persönlicher, wie auch gesellschaftlicher Umgang mit dem Tod ambivalent und geprägt durch Tabuisierungen, Ängste und Verdrängungen. Der Philosophie der Lebenskunst geht es um ein Bewusstsein von der Begrenztheit des Lebens. In der folgenden Arbeit werde ich darstellen, welchen Sinn Wilhelm Schmid dem Tod zuschreibt und dem eine christliche Deutung des Todes gegenüberstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wilhelm Schmid und der Tod
- Der Tod in der Bibel
- Die christliche Deutung von Tod und Sterben
- Kritische Würdigung Wilhelm Schmids
- Abschließende Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Philosophie der Lebenskunst und dem Umgang mit dem Tod. Ziel ist es, Wilhelm Schmids Sichtweise auf den Tod im Kontext seiner Philosophie der Lebenskunst darzustellen und diese mit der christlichen Deutung des Todes zu vergleichen. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob ein philosophischer Ansatz dem Tod einen Sinn geben kann, insbesondere in einer Zeit, in der der Glaube verloren geht und Religion keine Rolle mehr spielt.
- Der Tod als Grenze und Bedeutungsstifter für das Leben
- Der Tod als Motivation für ein schönes und erfülltes Leben
- Die Bedeutung des „Mitsterbens mit Anderen“ im Umgang mit dem Tod
- Die Frage nach dem Sinn des Lebens angesichts des Todes
- Bewusster Umgang mit der Zeit und die Vergänglichkeit des Lebens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Bedeutung der Lebenskunst im Angesicht von existentiellen Herausforderungen wie dem Verlust von Beziehungen und dem Erleben von Fremdheit. Die Philosophie der Lebenskunst wird als Möglichkeit dargestellt, das Leben bewusst zu gestalten und den Orientierungsverlust zu überwinden.
Wilhelm Schmid und der Tod
In diesem Kapitel wird Wilhelm Schmids Sichtweise auf den Tod im Kontext der Lebenskunst erörtert. Schmid argumentiert, dass der Tod nicht als etwas an sich existiert, sondern nur in den Erfahrungen und Vorstellungen der Menschen. Der Tod stellt eine Grenze dar, die dem Leben Form und Bedeutung gibt und den Menschen motiviert, ein schönes und erfülltes Leben zu führen. Das Denken an den Tod wird als Ermutigung zum Leben betrachtet, um die Angst vor dem Tod zu überwinden und gelassener mit ihm umzugehen. Der Umgang mit dem Tod beinhaltet auch das „Mitsterben mit Anderen“, welches als Möglichkeit dargestellt wird, sich dem Tod zu nähern und ihm eine Bedeutung zu verleihen.
Schlüsselwörter
Lebenskunst, Tod, Wilhelm Schmid, Philosophie, Christentum, Bedeutung, Grenze, Vergänglichkeit, Zeit, Mitsterben, Angst, Leben, Sinn, Glaube, Religion.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Wilhelm Schmid unter Lebenskunst?
Lebenskunst ist die Anstrengung, das Leben auf reflektierte Weise zu führen und es nicht unbewusst verstreichen zu lassen, besonders in Zeiten von Orientierungsverlust.
Welchen Sinn hat der Tod in Schmids Philosophie?
Der Tod dient als Grenze, die dem Leben erst Form und Bedeutung verleiht. Er ist das "finale Argument", das den Menschen motiviert, sein Leben aktiv zu gestalten.
Wie unterscheidet sich die christliche Deutung des Todes?
Während Schmid den Tod als immanente Grenze sieht, bietet das Christentum eine transzendente Deutung, die über das irdische Ende hinausweist.
Was bedeutet "Mitsterben mit Anderen"?
Es beschreibt die Erfahrung, den Tod nahestehender Menschen bewusst mitzuerleben, was helfen kann, die eigene Angst vor der Vergänglichkeit zu überwinden.
Kann Philosophie Religion beim Thema Tod ersetzen?
Die Arbeit untersucht, ob philosophische Reflexion in einer säkularen Zeit, in der Religion an Bedeutung verliert, eine vergleichbare Lebenshilfe bieten kann.
- Citar trabajo
- Sabine Wotzlaw (Autor), 2005, Vom Leben mit dem Tod, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94354