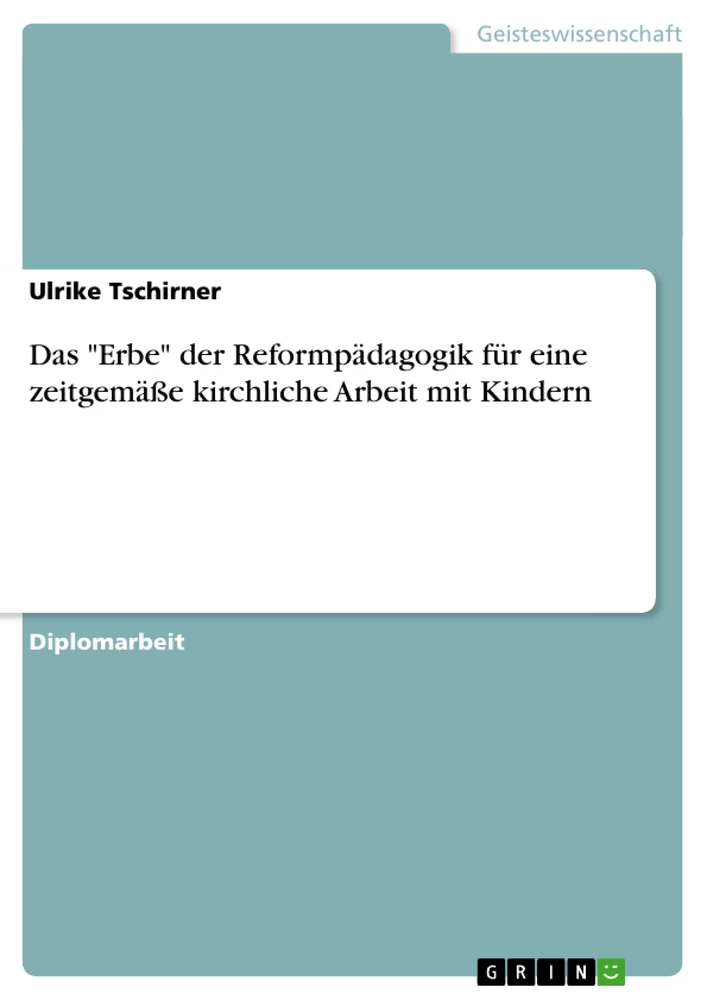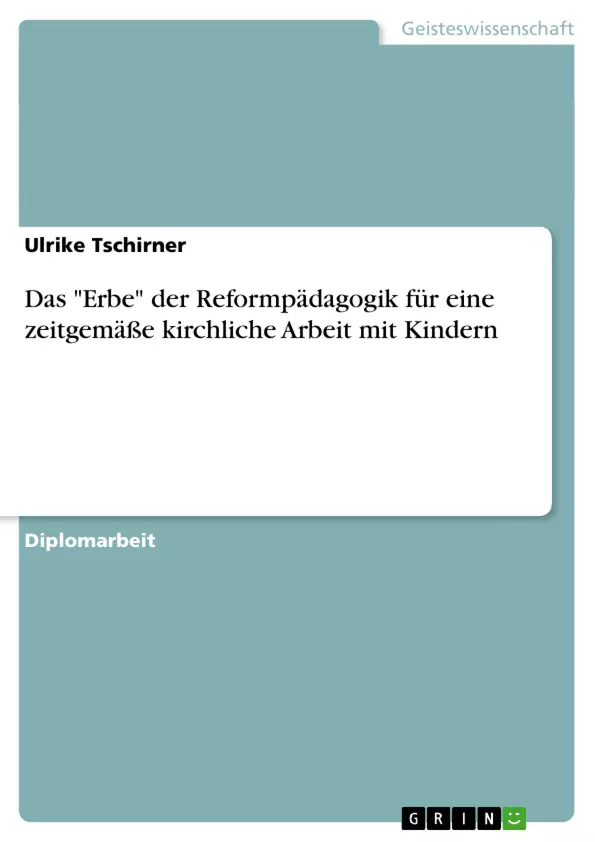Geht es um die Bildung und Erziehung von Kindern, kommt man heute kaum umhin, sich mit Reformpädagogik auseinander zu setzen. Angesichts zunehmender Probleme an Regelschulen ( z. B. mit Gewalt oder den Leistungen) denken viele Eltern über den Besuch einer reformpädagogisch orientierten Schule nach. Was unterscheidet diese Schulen von herkömmlichen? Welche Intentionen stehen hinter den ungewöhnlichen Konzeptionen? Und wäre diese Pädagogik nicht auch etwas für die gemeindliche Arbeit mit Kindern – schließlich sind es doch die gleichen Kinder!? Aufgrund dieser aktuellen gesellschaftlichen und persönlichen Interessen, die einer Fülle von historischen Konzeptionen
gegenüberstehen, habe ich eine Schwerpunktverlagerung in Richtung der
Reformpädagogik bewusst zugelassen. Mit „Reformpädagogik“ wird in älteren wissenschaftlichen Darstellungen meist eine vielschichtige, erneuerungswillige pädagogische Bewegung bezeichnet, welche auf die Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Untergang der Weimarer Republik begrenzt wird.1 In neueren Publikationen jedoch wird zunehmend davon abgerückt, die Reformpädagogik zeitlich derart einzuschränken, wobei auch diese Darstellungen einer besonderen Zäsur und einer Hochzeit des veränderungswilligen pädagogischen Bestrebens
in dieser Zeit bestätigen.2 „In einem ganz eminenten Sinn war Pädagogik immer
‚Reformpädagogik’, nur dass sich die Verhältnisse änderten, in denen die damit
verbundenen Postulate Wirklichkeit wurden, oder besser: an der Wirklichkeit getestet werden konnten.“3 Grund für die besondere Häufung der veränderungsmotivierten Pädagogen, zahlreichen bemerkenswerten Konzeptionen und pädagogischen Versuche ist in den großen Veränderungen des 19. Jahrhunderts zu suchen.4 In meiner Arbeit werde ich zunächst das Wesentliche dieser unübersichtlichen pädagogischen Glanzzeit mit kurzem Blick auf ihre Vorwehen im 19. Jahrhundert darzustellen versuchen – wobei der Schwerpunkt auf der Situation in Deutschland liegen wird – mit Ausnahme der Konzeption Maria Montessoris – obgleich es sich um eine internationale Bewegung handelt(e).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Reformpädagogik in ihrer „Blütezeit“
- 2.1. Der „, Vorlauf\" im 19. Jahrhundert
- 2.1.1. Blick auf die sozial-gesellschaftliche Situation in Deutschland
- 2.1.2. Blick auf die schulische Situation
- 2.1.3. Kritik und frühe Reformpläne
- 2.1.4. Mythos Kind
- 2.2. Das neue Jahrhundert: Strömungen 1900 - 1933
- 2.2.1. Gesellschaftliche Bewegung
- 2.2.1.1 Frauenbewegung
- 2.2.1.2 Jugendbewegung
- 2.2.1.3 Soziale Bewegung
- 2.2.2. Schulreformkonzepte - und Versuche
- 2.2.2.1 Jahrhundertwende bis 1. Weltkrieg
- 2.2.2.2 Landerziehungsheime
- 2.2.2.3 Berthold Ottos Hauslehrerschule
- 2.2.3. Die Arbeitsschulidee
- 2.2.1. Gesellschaftliche Bewegung
- 2.3. Kriegsende bis Machtergreifung der Nationalsozialisten
- 2.3.1. Äußere Schulreformansätze
- 2.3.2. Innere Schulreformansätze
- 2.3.2.1 Peter Petersens Jena-Plan-Schule
- 2.3.2.2 Waldorf-Schulen
- 2.4. Ausgewählte Konzeptionen
- 2.4.1. Die Pädagogik der Maria Montessori
- 2.4.1.1 Biographische Aspekte
- 2.4.1.2 Montessoris pädagogische Grunderkenntnisse und wichtigste Praxis-Ansatzpunkte
- 2.4.1.3 Religiöse Motivation Maria Montessoris
- 2.4.1.4 Montessori- Materialien
- 2.4.1.5 Montessori- Pädagogik heute
- 2.4.2. Landerziehungsheimpädagogik mit besonderem Augenmerk auf das Werk Hermann Lietzs
- 2.4.2.1 Die Idee der Landerziehungsheime
- 2.4.3. Der Begründer des 1. deutschen Landerziehungsheims
- 2.4.3.1 Biographische Aspekte Hermann Lietzs
- 2.4.3.2 Lietzs Inspirationen und Vorbilder
- 2.4.3.3 Lietzs Pädagogik und die erzieherische Praxis in seinen LEH
- 2.4.3.4 Seine Weltanschauung
- 2.4.3.5 Alltag in Lietzs Landerziehungsheimen
- 2.4.3.6 Landerziehungsheime in der Bundesrepublik Deutschland heute
- 2.5. Teilresümee zur Reformpädagogik der Vergangenheit
- 2.4.1. Die Pädagogik der Maria Montessori
- 3. Gegenwärtige Kirchliche Arbeit mit Kindern
- 3.1. Zur Lebenssituation von Kindern in Deutschland
- 3.2. Bildung und Erziehung am Lernort Gemeinde
- 3.3. Zur Situation der kirchlichen Arbeit mit Kindern in der EKD
- 3.3.1. Verschiedene Ansätze und Profile
- 3.3.1.1 Der Ansatz der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej)
- 3.3.1.2 Leitlinien, Ansichten und Anstöße der Evangelischen Kirche Berlin - Brandenburg
- 3.3.1.3 Das Profil der Kinder- und Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EHKN)
- 3.3.1. Verschiedene Ansätze und Profile
- 3.4. Teilresümee zur Kirchlichen Arbeit mit Kindern
- 4. Reformpädagogik von damals und Arbeit mit Kindern heute?
- 4.1. Parallelen
- 4.2. Chancen und Grenzen bei der Übertragung reformpädagogischer Ansätze in die Gegenwart
- 4.3. Beispiele der Verknüpfung gemeindepädagogischer Arbeit mit reformpädagogischen Ideen
- 4.3.1. ,,Das ist der Gipfel“ – Ein Partizipationsprojekt der Ev. Kirche von Westfalen
- 4.3.2. „Der KÜV kommt“ – verantwortliche Beteiligung von Kindern in der Ev. Kirche von Westfalen
- 4.3.3. ,,Motzen - Träumen – Klotzen“ Eine Zukunftswerkstatt zur Partizipation in der Ev. Kirche der Pfalz
- 4.3.4. Kinderparlament – das Projekt eines Kindergartens in der Ev. Kirche der Pfalz
- 4.3.5. Der Ansatz von „Godly Play“
- 4.4. Was lässt sich lernen aus der (Geschichte der) Reformpädagogik?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Reformpädagogik und ihren Bezügen zur gegenwärtigen kirchlichen Arbeit mit Kindern. Die Hauptaugenmerke liegen auf der Darstellung der Reformpädagogik, ihren wichtigsten Strömungen und Konzeptionen, sowie der Analyse der gegenwärtigen Situation der Kinderarbeit innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Arbeit untersucht die Möglichkeit, reformpädagogische Ideen in die heutige kirchliche Praxis zu übertragen und so eine zeitgemäße Arbeit mit Kindern zu gestalten.
- Die Entwicklung und die wichtigsten Strömungen der Reformpädagogik
- Die Situation der kirchlichen Arbeit mit Kindern in der EKD
- Parallelen zwischen der Reformpädagogik und der kirchlichen Kinderarbeit
- Chancen und Grenzen bei der Übertragung reformpädagogischer Ansätze in die Gegenwart
- Beispiele für die Verknüpfung von gemeindepädagogischer Arbeit mit reformpädagogischen Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung erläutert die Bedeutung und Aktualität der Reformpädagogik im Kontext der heutigen Bildung und Erziehung von Kindern. Die Arbeit fokussiert auf die Reformpädagogik als zentrales Thema und setzt die Relevanz für die gemeindliche Arbeit mit Kindern in den Vordergrund. Die Einleitung unterstreicht die Komplexität der Reformpädagogik und die Relevanz ihrer historischen Entwicklung.
Kapitel 2 (Reformpädagogik in ihrer „Blütezeit“): Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Reformpädagogik im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Es werden die sozial-gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen dieser Zeit analysiert und die Kritik an bestehenden Bildungssystemen herausgestellt. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Strömungen innerhalb der Reformpädagogik, die den Wandel der Zeit widerspiegeln. Die Arbeit verdeutlicht die Relevanz des „Mythos Kind“ für die Reformpädagogik und die verschiedenen Konzeptionen, die im Laufe der Zeit entstanden sind.
Kapitel 3 (Gegenwärtige Kirchliche Arbeit mit Kindern): Dieses Kapitel analysiert die gegenwärtige Lebenssituation von Kindern in Deutschland und die Bedeutung von Bildung und Erziehung im Kontext der Gemeinde. Es beleuchtet die Situation der kirchlichen Arbeit mit Kindern innerhalb der EKD und stellt verschiedene Ansätze und Profile in unterschiedlichen Landeskirchen und Verbänden vor.
Kapitel 4 (Reformpädagogik von damals und Arbeit mit Kindern heute?): Kapitel 4 befasst sich mit der Frage, inwieweit die Reformpädagogik von damals für die heutige kirchlich-gemeindliche Arbeit mit Kindern relevant ist. Es werden Parallelen zwischen den reformpädagogischen Ideen und den aktuellen Ansätzen der Kinderarbeit aufgezeigt und Chancen sowie Grenzen der Übertragung dieser Ideen in die Gegenwart diskutiert. Des Weiteren werden konkrete Beispiele für die Verknüpfung von gemeindepädagogischer Arbeit mit reformpädagogischen Ideen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Reformpädagogik, die gemeindliche Arbeit mit Kindern und ihre Verknüpfung. Wichtige Schlüsselwörter sind: Reformpädagogik, Kinderarbeit, Gemeinde, Bildung, Erziehung, Kirche, Partizipation, Inklusion, Zeitgemäßheit, Landerziehungsheim, Montessori-Pädagogik, Godly Play.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser pädagogischen Arbeit?
Die Arbeit untersucht das „Erbe“ der Reformpädagogik und deren Relevanz für eine zeitgemäße kirchliche Arbeit mit Kindern in der heutigen Zeit.
Welche historischen Konzepte der Reformpädagogik werden behandelt?
Es werden unter anderem die Ansätze von Maria Montessori (Montessori-Pädagogik), Peter Petersen (Jena-Plan), Rudolf Steiner (Waldorf-Schulen) und Hermann Lietz (Landerziehungsheime) analysiert.
Wie wird die kirchliche Arbeit mit Kindern in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation in der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) und stellt verschiedene Profile und Ansätze der gemeindlichen Kinderarbeit vor.
Welche Parallelen gibt es zwischen Reformpädagogik und Gemeindepädagogik?
Die Arbeit zeigt Parallelen auf und diskutiert Chancen sowie Grenzen bei der Übertragung reformpädagogischer Prinzipien wie Partizipation und Inklusion auf den Lernort Gemeinde.
Was ist das „Godly Play“-Konzept?
„Godly Play“ wird als ein konkretes Beispiel für die Verknüpfung von gemeindepädagogischer Arbeit mit reformpädagogischen Ideen in der Arbeit vorgestellt.
- 2.1. Der „, Vorlauf\" im 19. Jahrhundert
- Citar trabajo
- Ulrike Tschirner (Autor), 2005, Das "Erbe" der Reformpädagogik für eine zeitgemäße kirchliche Arbeit mit Kindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94388