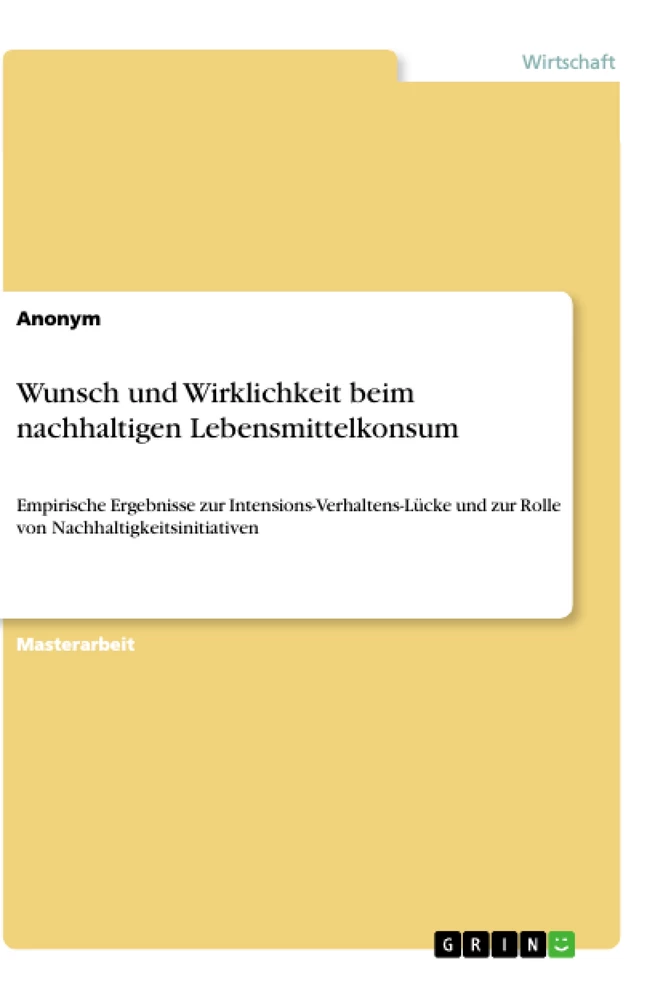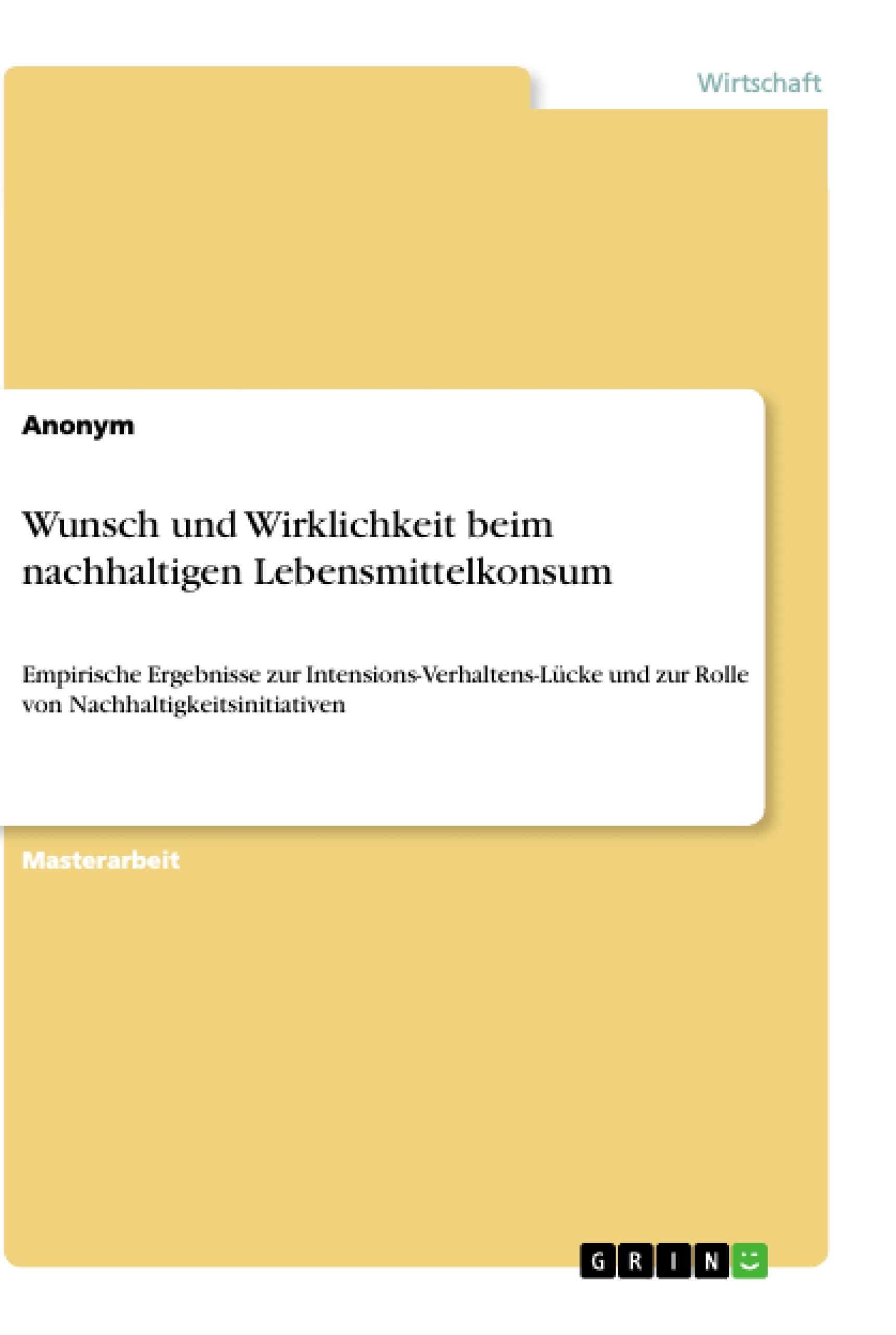Ziel dieser Masterthesis ist es, einen Beitrag zum besseren Verständnis des Konsumentenverhaltens im Bereich nachhaltiger Lebensmittelkonsum zu leisten. Dazu dient eine quantitative Befragung von Verbrauchern, die auf einer umfangreichen Literaturanalyse sowie einer qualitativen Vorstudie in Form von Experteninterviews aufbaut. Über das Nachhaltigkeitsverständnis und das Einkaufsverhalten der Konsumenten hin-aus ist dabei von besonderem Interesse, inwieweit aktuelle private, öffentliche und unternehmerische Initiativen dazu beitragen, dass die Verbraucher mehr nachhaltige Lebensmittel konsumieren. Vor dem Hintergrund der geschilderten Problemstellung steht dabei die folgende Forschungsfrage im Mittelpunkt: "Welche Initiativen für nachhaltigen Lebensmittelkonsum sind in der Lage, einen Beitrag zur Schließung der Intentions-Verhaltens-Lücke zu leisten?"
Ausgehend von dieser zentralen Fragestellung will die Arbeit untersuchen, inwiefern die Konsumenten gewillt sind, von der Konsumentensouveränität aktiv Gebrauch zu machen, d. h. durch ihre Konsumentscheidungen Art und Umfang der Produktion zu bestimmen, und wo sie zusätzlichen Aufwand scheuen. Zur Beantwortung der Forschungsfrage sind verschiedene Teilaspekte zu berücksichtigen, die sich aus der unterstellten Wirkungskette ergeben. Zentrale Komponenten sind das Nachhaltigkeitsbewusstsein der Konsumenten, ihr konkretes Einkaufsverhalten und die unterschiedlichen praktischen und theoretischen Ansätze, wie beides zusammenhängt bzw. zusammengebracht werden kann. Erstens gilt es daher zu ermitteln, was die Konsumenten unter nachhaltigem Lebensmittelkonsum verstehen und wie sich dadurch ihr Einkaufsverhalten verändert. Zweitens ist zu überprüfen, inwiefern sich tatsächlich von einer Intentions-Verhaltens-Lücke sprechen lässt und welche Faktoren dafür ursächlich sein könnten. Drittens schließlich gilt es die verschiedenen Typen von Initiativen zu identifizieren, die es im Bereich nachhaltige Lebensmittelwirtschaft gibt, um ihre Wirkung und Erfolgschancen bewerten zu können. Dabei lassen sich verschiedene Stufen des Engagements vom Vertrauen auf staatliche Labels über die Recherche nach Informationen bis hin zur solidarischen Landwirtschaft unterscheiden. Idealerweise ist es am Ende der Arbeit möglich, Zielgruppen für solche Initiativen herauszuarbeiten und zugleich die Grenzen in Bezug auf die Bereitschaft der Konsumenten aufzuzeigen, sich aktiv um nachhaltigen Lebensmittelkonsum zu bemühen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Fragestellung
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen zum Thema nachhaltiger Lebensmittelkonsum
- Lebensmittelerzeugung und Lebensmittelhandel in Deutschland
- Ökonomische Bedeutung und Struktur der Lebensmittelbranche
- Aktuelle Entwicklungstrends und Diskussionen
- Nachhaltigkeit und nachhaltiger Konsum
- Grundidee der Nachhaltigkeit
- Nachhaltigkeitsverständnis im Bereich Lebensmittel
- Nachhaltigkeitsbilanz der Lebensmittelwirtschaft
- Konsumentensouveränität und Intentions-Verhaltens-Lücke
- Konsumforschung und das Prinzip der Konsumentensouveränität
- Neue Rolle des Konsumenten
- Die Intentions-Verhaltens-Lücke und ihre Ursachen
- Initiativen für nachhaltigen Lebensmittelkonsum
- Informationsplattformen und Beratungsportale
- Gütesiegel und Qualitätsstandards
- Selbstversorgung, solidarische Landwirtschaft und regionale Netzwerke
- Beteiligungs- und Mitbestimmungsmodelle
- Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verpackung
- A-priori-Hypothesen für die empirische Untersuchung
- Methodik der empirischen Datenerhebung
- Konzeption der empirischen Untersuchung
- Forschungsdesign
- Gütekriterien der qualitativen und quantitativen Forschung
- Entwicklung der Erhebungsmethoden
- Entwicklung des Leitfadens für die Experteninterviews
- Entwicklung des quantitativen Erhebungsinstruments
- Aufbau und Struktur des Fragebogens
- Operationalisierung der Konstrukte
- Stichprobe der Untersuchungen
- Gewinnung von Interviewpartnern
- Rekrutierung der Umfrageteilnehmer
- Datenerhebung
- Pretests
- Durchführungssystematik
- Datenerfassung
- Transkription der Interviews
- Datenerfassung im Fragebogen
- Auswertung und Interpretation der Daten
- Qualitative Inhaltsanalyse der Interviews
- Quantitative statistische Auswertung der Onlineumfrage
- Computergestützte Auswertung
- Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews
- Qualitative Inhaltsanalyse der Experteninterviews
- Verständnis des Problemfelds
- Hemmnisse und psychologische Faktoren
- Initiativen und Zielgruppen
- Ableitung von ex-post-Hypothesen
- Ergebnisse der Konsumentenbefragung
- Deskriptive Statistik
- Verständnis von nachhaltigem Konsum
- Einkaufsverhalten bei Lebensmitteln
- Engagement für nachhaltigen Lebensmittelkonsum
- Bewertung der Hypothesen
- Wunsch und Wirklichkeit des Lebensmitteleinkaufs
- Ursachen der Intentions-Verhaltens-Lücke
- Erfolgschancen und Zielgruppen für Nachhaltigkeitsinitiativen
- Bewertung von Reliabilität, Validität und Repräsentativität der Studie
- Diskussion und Fazit
- Zusammenfassung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse
- Handlunsgempfehlungen zur Überwindung der Intentions-Verhaltens-Lücke
- Limitationen der Untersuchung
- Implikationen für die weitere Forschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterthesis befasst sich mit der Lücke zwischen dem Wunsch nach nachhaltigem Lebensmittelkonsum und dem tatsächlichen Verhalten der Konsumenten. Die Arbeit analysiert die Gründe für diese Intentions-Verhaltens-Lücke und untersucht den Einfluss von Nachhaltigkeitsinitiativen auf das Konsumentenverhalten.
- Analyse der Intentions-Verhaltens-Lücke im Kontext von nachhaltigem Lebensmittelkonsum
- Untersuchung der Rolle von Nachhaltigkeitsinitiativen bei der Förderung nachhaltigen Lebensmittelkonsums
- Identifizierung von psychologischen und soziokulturellen Einflussfaktoren auf das Konsumentenverhalten
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Überwindung der Intentions-Verhaltens-Lücke
- Bedeutung von Konsumentensouveränität und dem Einfluss von Nachhaltigkeitsinitiativen auf die Entscheidungsfindung der Konsumenten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und die Forschungsfrage der Masterthesis dar. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und erläutert die Bedeutung des Themas nachhaltiger Lebensmittelkonsum im Kontext der heutigen Gesellschaft.
Kapitel 2 bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen zum Thema nachhaltiger Lebensmittelkonsum. Es werden die ökonomischen und strukturellen Aspekte der Lebensmittelbranche beleuchtet, sowie die Konzepte der Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Konsums erläutert. Die Kapitel behandelt auch die Intentions-Verhaltens-Lücke und untersucht die verschiedenen Ursachen dieses Phänomens.
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden das Forschungsdesign, die Gütekriterien und die Entwicklung der Erhebungsinstrumente (Fragebogen und Interviewleitfaden) erläutert. Des Weiteren werden die Stichproben, die Datenerhebung und die Auswertungsmethoden vorgestellt.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews, die Einblicke in die verschiedenen Perspektiven und Herausforderungen im Kontext von nachhaltigem Lebensmittelkonsum liefern. Die Interviews fokussieren auf das Verständnis des Problemfelds, die Hemmnisse und psychologischen Faktoren, die das Konsumentenverhalten beeinflussen, sowie die Rolle von Initiativen und die Zielgruppenansprache.
Kapitel 5 analysiert die Ergebnisse der quantitativen Konsumentenbefragung. Es werden deskriptive Statistiken zu den verschiedenen Aspekten des nachhaltigen Lebensmittelkonsums präsentiert, wie zum Beispiel das Verständnis von Nachhaltigkeit, das Einkaufsverhalten und das Engagement für nachhaltige Produkte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Nachhaltigkeit, Lebensmittelkonsum, Intentions-Verhaltens-Lücke, Konsumentensouveränität, Nachhaltigkeitsinitiativen, psychologische Faktoren, soziokulturelle Einflussfaktoren, qualitative und quantitative Forschung, Experteninterviews, Konsumentenbefragungen, Handlungsempfehlungen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Wunsch und Wirklichkeit beim nachhaltigen Lebensmittelkonsum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944510