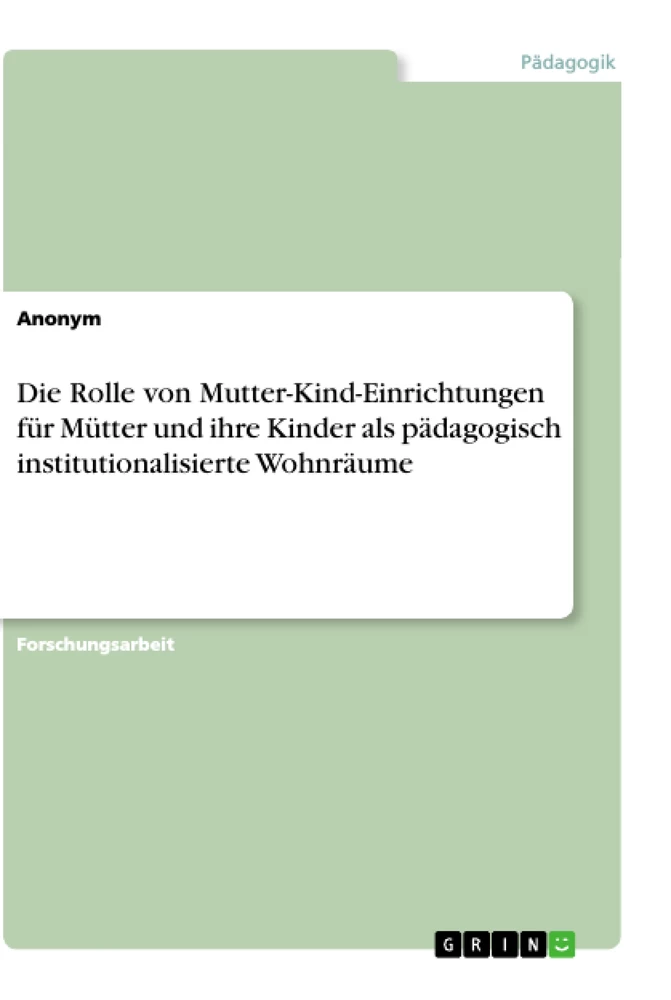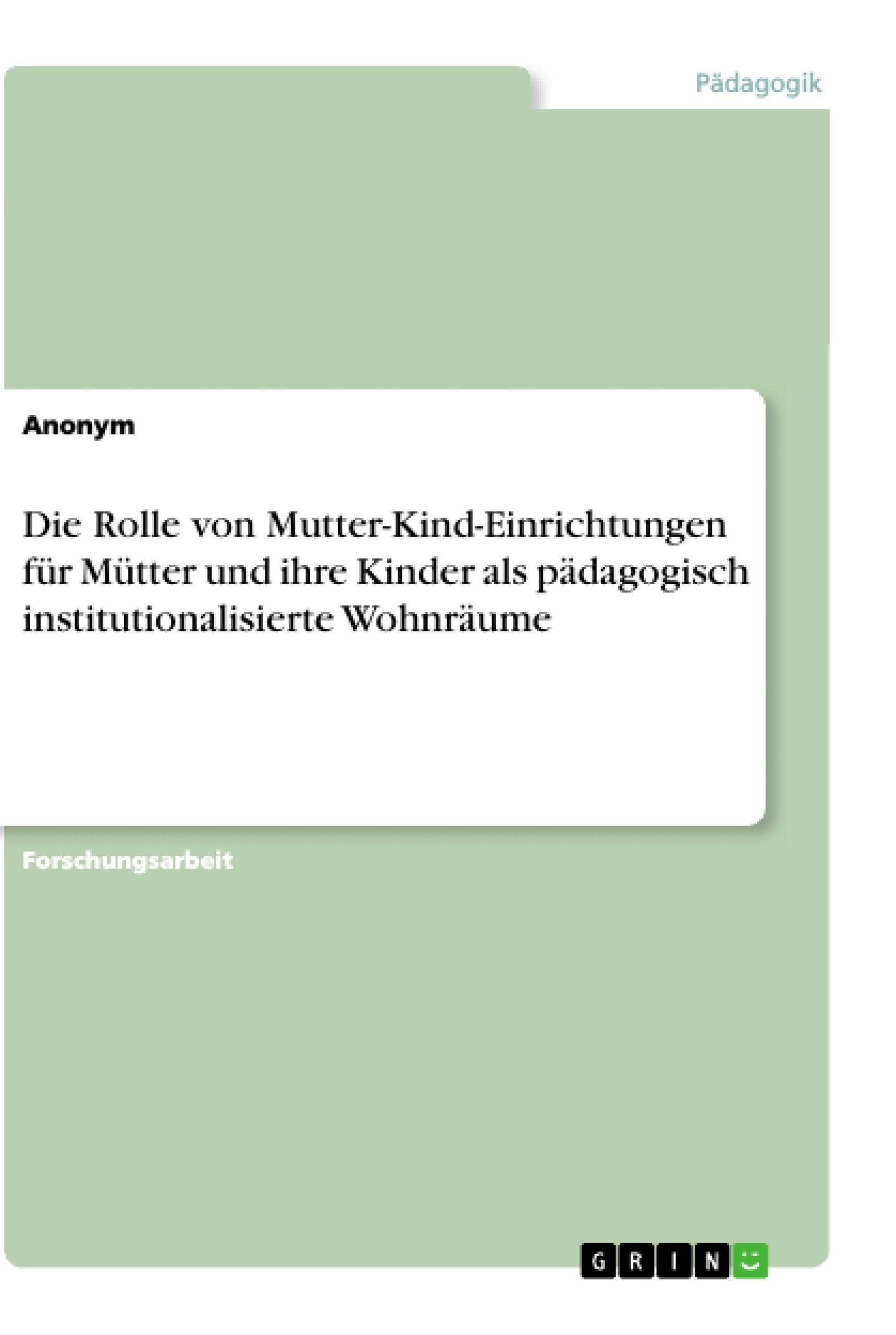Alleinerziehende Mütter sind immer wieder mit der Pflege, Erziehung und Betreuung ihrer Kinder überfordert. Dennoch erfahren sie in der Gesellschaft wenig Verständnis und Zuspruch für ihre Lage. Auch die psychosozialen und wirtschaftlichen Lagen sowie die Bedürfnisse und Herausforderungen der Lebenswelten werden weitgehend außer Acht gelassen. Trotz Pluralisierung und neuer Lebens- und Familienformen wird Alleinerziehenden nicht selten mit Vorurteilen begegnet.
Eine Fall- und Feldanalyse soll die Umstände in einer solchen Einrichtung und vor allem die Bedeutung in den Fokus nehmen. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der pädagogischen Entwicklung der Kinder. Denn die Kindheit ist eine bedeutende Phase im Leben, in der Weichen für die spätere Zukunft gestellt werden. Aus diesem Grund wird dem Wohl des Kindes eine hohe Bedeutung beigemessen. Falls das Wohl jedoch nicht gesichert ist, muss der Staat von seinem Wächteramt Gebrauch machen. Die im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankerte gemeinsame Wohnform für Mütter und Väter mit ihren Kindern als eine von vielen Hilfsmöglichkeiten, bietet den allein sorgeberechtigten Elternteilen die Chance, ihre Erziehungskompetenzen zu stärken. Es ist auch eine Unterstützungsform für Schwangere in prekären Lebenssituationen, die aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzung nicht in der Lage sind, allein Sorge für das Kind zu tragen und denen Unterstützungsangebote aus ihrem sozialen und familiären Umfeld fehlen.
Im Zentrum der Analyse stehen vor allem alleinerziehende Müttern, deren Kompetenzen zur Versorgung und Betreuung ihrer Kinder alleine nicht ausreichen. Gemeinsame Wohnformen, wie die Mutter-Kind-Einrichtungen, bieten eine Möglichkeit, diese fehlenden Kenntnisse und persönlichen Kompetenzen zu erweitern, um später ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben mit Kind zu führen. Im theoretischen Teil werden die für die Arbeit relevanten Begriffe bezüglich des Themas Schwanger- und Elternschaft vorerst definiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORIE UND BEGRIFFSDEFINTION
- 2.1 Rechtsgrundlage
- 2.2 Lebensbewältigung
- 2.3 Der historische Kontext Sozialer Arbeit mit jungen Müttern
- 2.4 Elternschaft
- 2.5 Kindheit
- 2.6 Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung
- 2.7 Familie
- 2.8 Lebenslagen alleinerziehender Mütter
- 3. METHODISCHES VORGEHEN
- 3.1 Datenerhebung
- 3.1.1 Schriftliches Interview
- 3.1.2 Forschungsfeld
- 3.2 Datenauswertung
- 3.2.1 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.2.2 Merkmale Qualitativer Inhaltsanalyse
- 3.2.3 Allgemeiner Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse
- 3.2.4 Zusammenfassenden Inhaltsanalyse
- 3.3 Konkrete Umsetzung der Analyse
- 3.3.1 Einbettung in den Kommunikationszusammenhang
- 3.3.2 Formale Charakteristika
- 3.3.3 Richtung der Analyse
- 3.3.4 Auswertungs-, Kontext- und Kodiereinheit
- 3.3.5 Anwendung der zusammenfassenden Inhaltsanalyse
- 3.1 Datenerhebung
- 4. VORSTELLUNG DER ERGEBNISSE
- 4.1 Hauptkategorie “Lebenssituation, Problemfelder, Bedürfnisse Frauen“
- 4.2 Hauptkategorie “Institutionelle Rahmenbedingungen”
- 4.3 Hauptkategorie \"Betreuung und Förderung der Kinder\"\n
- 4.4 Hauptkategorie \"Persönliche Aspekte der Interviewpartnerin\"\n
- 4.5 Hauptkategorie \"Corona-Pandemie\"\n
- 5. FAZIT
- 5.1 Kritische Reflexion
- 5.2 Offene Fragen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Rolle von Mutter-Kind-Einrichtungen als pädagogisch institutionalisierte Wohnräume aus der Perspektive einer professionellen Sozialpädagogin. Ziel ist es, die Arbeitsweise und die Herausforderungen im Kontext der Betreuung von Müttern und ihren Kindern in einer solchen Einrichtung zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf einem Leitfadeninterview mit einer Sozialpädagogin, das die Lebenswelt der Mütter und die professionelle Praxis in der Einrichtung analysiert.
- Die Lebenslagen alleinerziehender Mütter und ihre individuellen Bedürfnisse
- Die Rolle von Mutter-Kind-Einrichtungen als unterstützende Institution im Kontext von Kindeswohl und Lebensbewältigung
- Die Herausforderungen der Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen aus der Sicht einer Sozialpädagogin
- Die Bedeutung von pädagogischen Interventionen und der Förderung von Kindern in dieser Einrichtung
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit in der Mutter-Kind-Einrichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und erläutert die Motivation der Autorin, sich mit dem Arbeitsfeld von Mutter-Kind-Einrichtungen zu beschäftigen. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext von Kindeswohl und der Unterstützung von alleinerziehenden Müttern.
Das zweite Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Aspekte und Begriffsbestimmungen, die für die Analyse der Lebenswelt von Müttern und ihren Kindern sowie für die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen relevant sind. Die Kapitel behandelt unter anderem die Rechtsgrundlage, Lebensbewältigung, den historischen Kontext Sozialer Arbeit mit jungen Müttern, Elternschaft, Kindheit, Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung, Familie und die Lebenslagen alleinerziehender Mütter.
Das dritte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Seminararbeit. Es fokussiert sich auf die Datenerhebung und -auswertung, insbesondere die Durchführung eines Leitfadeninterviews mit einer Sozialpädagogin und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse.
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse. Es werden die wichtigsten Kategorien, die aus dem Interview mit der Sozialpädagogin hervorgegangen sind, vorgestellt. Die Kapitel beleuchtet unter anderem die Lebenssituation und die Bedürfnisse der Frauen, die institutionellen Rahmenbedingungen der Einrichtung, die Betreuung und Förderung der Kinder sowie persönliche Aspekte der Interviewpartnerin und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Das fünfte Kapitel beinhaltet das Fazit der Seminararbeit. Es umfasst eine kritische Reflexion der Ergebnisse und diskutiert offene Fragen sowie einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit behandelt zentrale Themen wie die Lebenslagen alleinerziehender Mütter, die Arbeit in Mutter-Kind-Einrichtungen, die Rolle von professionellen Sozialpädagog*innen, die Förderung von Kindern, das Kindeswohl sowie die Herausforderungen der Arbeit in der Einrichtung. Die Analyse basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse eines Leitfadeninterviews mit einer Sozialpädagogin.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Die Rolle von Mutter-Kind-Einrichtungen für Mütter und ihre Kinder als pädagogisch institutionalisierte Wohnräume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944587