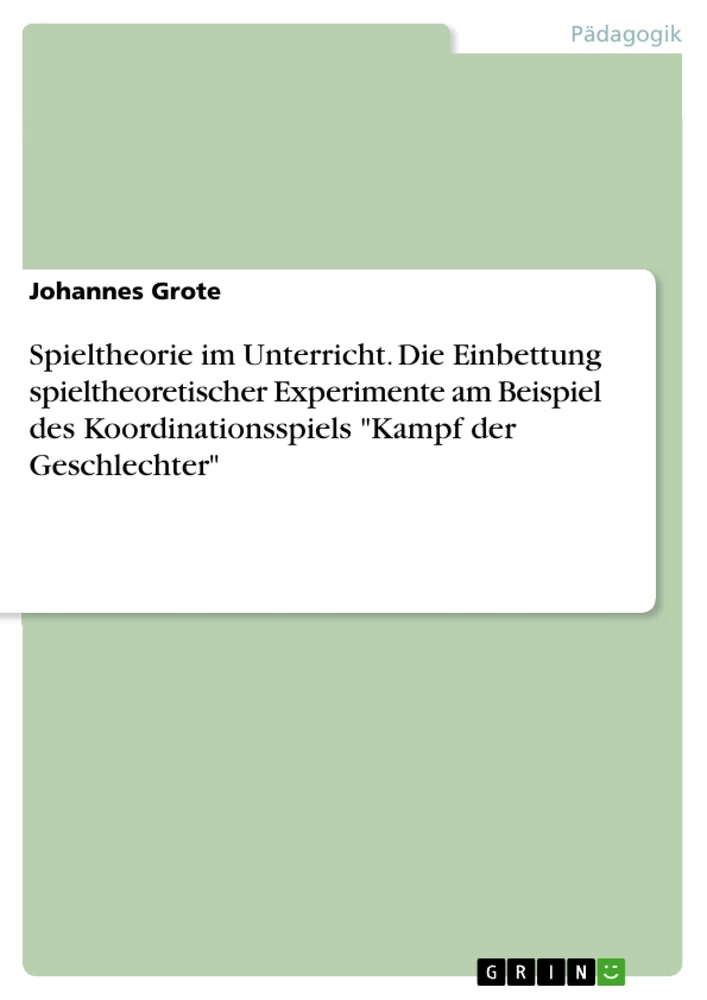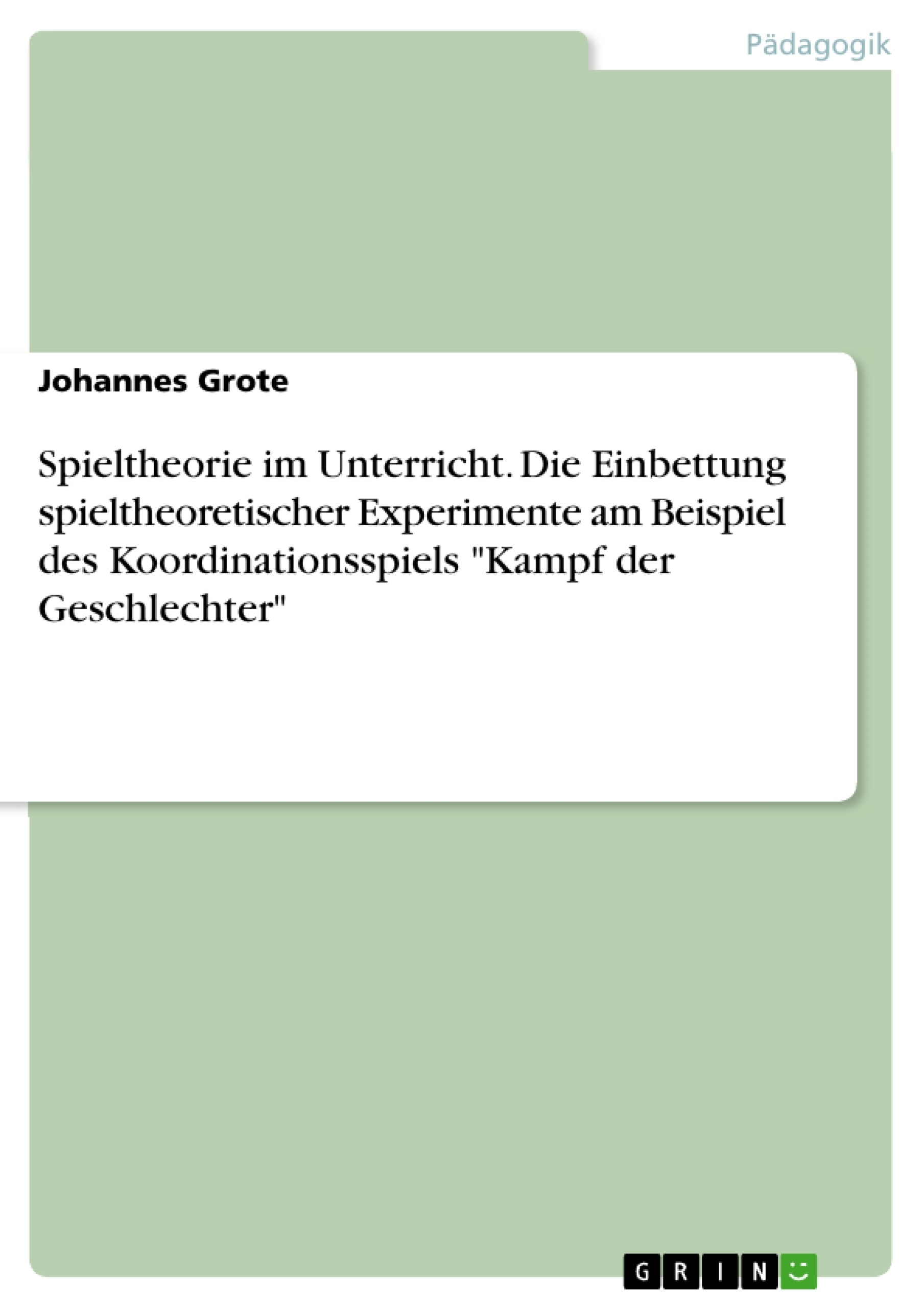Diese Ausarbeitung bietet einen Überblick über die Einbindung des Experiments „Kampf der Geschlechter“ in den Kontext der Schule. Dazu wird eine exemplarische Einbindung in eine Unterrichtsreihe gegeben und das Experiment anhand einer fachwissentlichen und fachdidaktischen Analyse auf den möglichen Einsatz im Unterricht überprüft.
"Kampf der Geschlechter" ist ein bekanntes Koordinationsspiel, das ein Problem der Spieltheorie beschreibt. Eine Frau und ein Mann haben sich zu einer ersten gemeinsamen Unternehmung verabredet. Allerdings haben die Beiden es versäumt, einen gemeinsamen Treffpunkt auszumachen. Da sie außerdem vergessen haben ihre Telefonnummern und ihre Adressen auszutauschen, gibt es keine Möglichkeit den jeweils Anderen zu kontaktieren, um noch einen Treffpunkt auszumachen. Die beiden Akteure haben eine unterschiedliche Präferenz für einen Treffpunkt, die dem Anderen auch bekannt ist. Der Mann präferiert den Besuch eines Fußballspieles, während die Frau den Besuch eines Theaters bevorzugt. Beiden Personen ist eine gemeinsame Unternehmung sehr wichtig, sodass der Mann lieber gemeinsam mit der Frau ins Theater geht und die Frau lieber gemeinsam mit dem Mann zum Fußball, statt einer getrennten Unternehmung nachzugehen. Man erhält somit vier verschiedene Kombinationen für die Wahl der Treffpunkte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzdarstellung des Experiments
- Inhalt
- Durchführung und Vorbereitung des Experiments im Unterricht
- Einbettung in eine Unterrichtsreihe
- Fachwissenschaftlicher Hintergrund
- Spieltheorie
- Was ist Spieltheorie?
- Das Nash-Gleichgewicht
- Die nicht-kooperative Spieltheorie
- Lösungsstrategien
- Dominante Strategien
- Spieltheorie
- Fachdidaktische Analyse
- Bezug zum Kerncurriculum
- Bedeutung für Schülerinnen und Schüler
- Didaktische Legitimierung des Experimentes
- Fazit
- Quellenverzeichnis
- Bücher/Monographien
- Periodika
- Quellen im Internet
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung bietet einen Überblick über die Einbindung des Experiments „Kampf der Geschlechter“ in den Kontext der Schule. Dazu wird eine exemplarische Einbindung in eine Unterrichtsreihe gegeben und das Experiment anhand einer fachwissentlichen und fachdidaktischen Analyse auf den möglichen Einsatz im Unterricht überprüft.
- Das Experiment „Kampf der Geschlechter“ als Beispiel für ein Koordinationsspiel der Spieltheorie.
- Die Einbettung des Experiments in eine Unterrichtsreihe im Fach Ökonomische Bildung.
- Fachwissenschaftliche Analyse des Experiments und seiner Relevanz für die ökonomische Bildung.
- Fachdidaktische Analyse des Experiments, inklusive Bezug zum Kerncurriculum und didaktischer Legitimierung.
- Praktische Hinweise zur Durchführung des Experiments im Unterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Experiment „Kampf der Geschlechter“ vor und erläutert den Zweck der Ausarbeitung. Es wird die Einbindung des Experiments in den Kontext der Schule sowie eine exemplarische Einbindung in eine Unterrichtsreihe beschrieben. Die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse des Experiments wird als Grundlage für die Überprüfung des möglichen Einsatzes im Unterricht vorgestellt.
Kurzdarstellung des Experiments
Dieser Abschnitt präsentiert den Inhalt des Experiments „Kampf der Geschlechter“, ein bekanntes Koordinationsspiel, das ein Problem der Spieltheorie beschreibt. Es werden die Präferenzen der beteiligten Akteure, die Auszahlungstabelle und die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Entscheidungen dargestellt. Das Konzept des Nash-Gleichgewichts wird erläutert. Zudem wird die Durchführung und Vorbereitung des Experiments im Unterricht besprochen, wobei die Relevanz des Gefangenendilemmas und die geeignete Jahrgangsstufe für die Anwendung hervorgehoben werden.
Einbettung in eine Unterrichtsreihe
Dieses Kapitel zeigt, wie das Experiment „Kampf der Geschlechter“ in eine Unterrichtsreihe zum Thema „Die Europäische Union“ für die 10. Klasse integriert werden kann. Es werden verschiedene Themenbereiche der Unterrichtsreihe aufgeführt, die durch das Experiment veranschaulicht und vertieft werden können. Die Einbindung des Experiments in den Kontext der Unterrichtsreihe soll einen praxisnahen Einblick in die Anwendung des Experiments im Unterricht geben.
Fachwissenschaftlicher Hintergrund
Dieser Teil der Ausarbeitung bietet einen Überblick über die Spieltheorie als fachlichen Hintergrund des Experiments. Es werden die Grundlagen der Spieltheorie und das Konzept des Nash-Gleichgewichts erläutert. Der Fokus liegt auf der nicht-kooperativen Spieltheorie und ihren Lösungsstrategien, insbesondere auf dem Konzept der dominanten Strategien.
Fachdidaktische Analyse
Die fachdidaktische Analyse beleuchtet den Bezug des Experiments zum Kerncurriculum des Faches Ökonomische Bildung. Es werden die Bedeutung des Experiments für Schülerinnen und Schüler sowie die didaktische Legitimierung für den Einsatz im Unterricht diskutiert. Die Analyse liefert Argumente und Hinweise für die rationale Auswahl des Experiments für den Unterricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen des Textes sind: Spieltheorie, Koordinationsspiel, Nash-Gleichgewicht, nicht-kooperative Spieltheorie, dominante Strategie, „Kampf der Geschlechter“-Experiment, ökonomische Bildung, Unterrichtsreihe, Fachdidaktik, Kerncurriculum, didaktische Legitimierung. Diese Begriffe prägen den fachlichen Rahmen und die Analyse des Experiments, und sie liefern einen Einblick in die wichtigen Themen und Konzepte, die im Text behandelt werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Experiment „Kampf der Geschlechter“?
Es ist ein klassisches Koordinationsspiel der Spieltheorie, bei dem zwei Akteure unterschiedliche Präferenzen haben, aber eine gemeinsame Unternehmung einer getrennten vorziehen.
Wie wird das Experiment im Unterricht eingesetzt?
Es dient dazu, ökonomische Entscheidungsprozesse und das Konzept des Nash-Gleichgewichts anschaulich in Fächern wie Ökonomischer Bildung zu vermitteln.
Was ist ein Nash-Gleichgewicht?
Ein Zustand, in dem kein Spieler seine Strategie einseitig ändern möchte, da dies seine Auszahlung nicht verbessern würde.
In welche Unterrichtsthemen lässt sich das Spiel einbetten?
Die Arbeit schlägt beispielsweise eine Einbettung in eine Unterrichtsreihe zum Thema „Die Europäische Union“ vor, um Verhandlungsprozesse zu verdeutlichen.
Was ist der Unterschied zwischen kooperativer und nicht-kooperativer Spieltheorie?
Die nicht-kooperative Spieltheorie untersucht Situationen, in denen Spieler keine bindenden Verträge schließen können und individuell ihre Auszahlung maximieren.
- Citar trabajo
- Johannes Grote (Autor), 2016, Spieltheorie im Unterricht. Die Einbettung spieltheoretischer Experimente am Beispiel des Koordinationsspiels "Kampf der Geschlechter", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944634