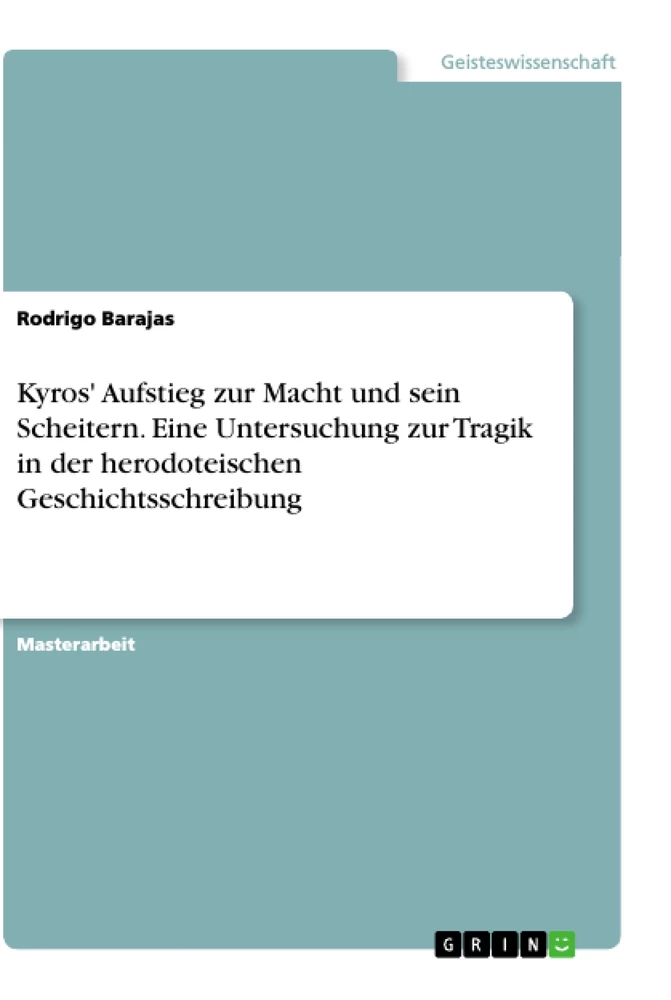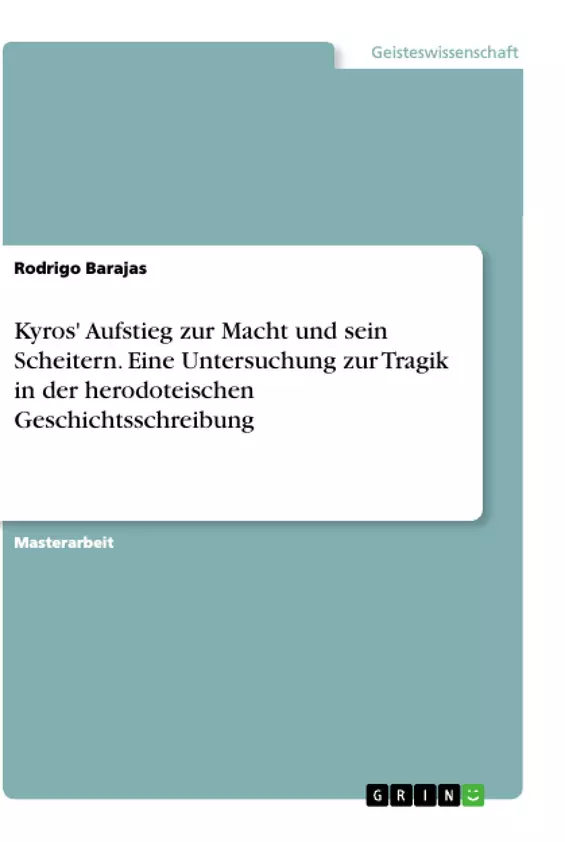Der Einfluss der Tragödie auf das herodoteische Geschichtswerk kann heute kaum noch bezweifelt werden. Zahlreich sind die Aufsätze und Monographien der älteren und neueren Forschung, die unter stets neuen Blickwinkeln Herodots Affinität zu den Tragödiendichtern nachwiesen. Untersucht wurden dabei vornehmlich lexikalische, idiomatische und motivische Entlehnungen sowie die Dramaturgie und äußere Struktur mancher Episoden und Novellen, wobei die Techniken und Kunstmittel, derer sich der Geschichtsschreiber bei der Charakterisierung seiner Akteure und der Ausgestaltung einzelner Szenen bediente, nicht weniger Gegenstand des Interesses waren als auch die in der Tragödie nicht irrelevante Rolle der Götter und des Schicksals sowie ihre Bedeutung für die menschliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit. Erforscht wurde all dies an kleineren und größeren Erzählungen der Historien, wobei nicht nur zu einzelnen Logoi, sondern speziell auch zu einzelnen Herrschergestalten umfangreiche Publikationen erschienen sind. Eine in diesem Zusammenhang nennenswerte Abhandlung stellt Jörg Schulte-Altedorneburgs Dissertation Geschichtliches Handeln und tragisches Scheitern dar.
Unter Rekurs auf die aristotelische Handlungstheorie widmet sich der Autor darin schwerpunktmäßig der Frage nach dem Eigenanteil des Menschen an dem ihm von den Göttern verhängten Schicksal; der Mensch, so die Hauptthese seiner Arbeit, handelt bei Herodot größtenteils eigenverantwortlich und bestimmt durch seine Entscheidungen bzw. Fehlentscheidungen mit über das eigene Ende. Diese im menschlichen Handeln und Scheitern sich offenbarende „Tragik“, wie sie einem etwa
aus der attischen Tragödie bekannt ist, wird von Schulte-Altedorneburg allerdings nicht am Beispiel aller Herrscherschicksale der Historien durchdiskutiert. Die vorliegende Untersuchung zum Perserkönig Kyros möchte daher einen Beitrag zu diesem noch vorhandenen Desiderat leisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung.
- Zur Forschungsliteratur.
- Definition des Tragikbegriffs und anzuwendende Methode
- Teil I
- Die Scheiterhaufenszene: Kyros' Milde und Gottesfurcht (Hdt. I,86)
- Ein moderater und einsichtsfähiger König: Kyros' Gespräche mit Kroisos (Hdt. 1,87-90 / 154-156)
- Zum Königsein geboren: Kyros' schicksalhafte Bestimmung (Hdt. I,114-115 / 125-126)
- Betrachtungen zu Herodots Erzähltechnik
- Ein tragischer Held? – Zusammenfassung und Zwischenfazit
- Teil II
- Hybris: des Menschen Verderben.
- Der Beginn einer neuen machtpolitischen Phase: Kyros' Umgang mit den griechischen Delegationen (Hdt. I,141 und 152/153)
- Die erste Grenzüberschreitung: Kyros' Rache am Gyndes (Hdt. I,189)
- Tomyris' und Kroisos' missachtete Mahnreden: Kyros' erster verhängnisvoller Fehler (Hdt. 1,201-208) – Weitere Betrachtungen zu Herodots Erzähltechnik
- Verkannte Warnungen: Kyros' Verblendung und sein letzter Schritt ins Verderben (Hdt. I,209-212).
- Der eigenen Epithymia zum Opfer gefallen: Kyros' tragischer Tod und seine sinnbildliche Darstellung durch Herodot (Hdt. 213-214).
- Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen zur Tragik in der herodoteischen Darstellung des Kyros.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Frage, inwiefern sich das Tragische im herodoteischen Geschichtswerk, insbesondere in der Darstellung des Perserkönigs Kyros, manifestiert. Im Fokus steht die Analyse von Kyros' Handlungen und Entscheidungen im Kontext der ihm zugeschriebenen „Tragik“ und deren Darstellung durch Herodot. Dabei soll untersucht werden, inwieweit Kyros' Handeln durch seine eigene Verblendung und Hybris zu seinem tragischen Ende führt und wie Herodot diese Aspekte in seinen Historien zum Ausdruck bringt.
- Der Einfluss der attischen Tragödie auf Herodots Geschichtswerk
- Die Rolle von Hybris und Verblendung im tragischen Scheitern von Kyros
- Die Bedeutung von Determinismus und menschlicher Freiheit in Herodots Darstellung von Kyros' Schicksal
- Herodots Erzähltechnik und seine Verwendung von tragischen Elementen in der Darstellung von Kyros' Geschichte
- Der Vergleich der Kyros-Darstellung mit anderen Herrscherschicksalen in Herodots Historien
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Diese Einleitung beleuchtet den Einfluss der attischen Tragödie auf Herodots Geschichtswerk und skizziert den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Sie definiert zudem den Tragikbegriff, der für die Analyse des Kyros-Logos verwendet wird, und erläutert die Methode, die bei der Analyse angewendet wird.
- Die Scheiterhaufenszene: Kyros' Milde und Gottesfurcht (Hdt. I,86): Dieses Kapitel analysiert die Szene, in der Kyros seine Milde und Gottesfurcht demonstriert, und erörtert, inwiefern diese Eigenschaften im Kontext der Tragik interpretiert werden können.
- Ein moderater und einsichtsfähiger König: Kyros' Gespräche mit Kroisos (Hdt. 1,87-90 / 154-156): Dieses Kapitel untersucht Kyros' Gespräche mit Kroisos und analysiert, wie Herodot Kyros' Charakter und seine Fähigkeit zur Einsicht darstellt. Es wird erörtert, inwieweit diese Eigenschaften mit Kyros' späterem tragischen Schicksal zusammenhängen.
- Zum Königsein geboren: Kyros' schicksalhafte Bestimmung (Hdt. I,114-115 / 125-126): Dieses Kapitel untersucht Kyros' schicksalhafte Bestimmung, die ihn zum König macht. Es werden Herodots Erzähltechniken analysiert und die Frage diskutiert, inwieweit Kyros' Schicksal durch den Einfluss der Götter und die eigene Wahl beeinflusst wird.
- Hybris: des Menschen Verderben.: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Hybris im tragischen Scheitern des Menschen. Es wird die These aufgestellt, dass Kyros' Hybris maßgeblich zu seinem Untergang beiträgt und wie diese Thematik in Herodots Werk dargestellt wird.
- Der Beginn einer neuen machtpolitischen Phase: Kyros' Umgang mit den griechischen Delegationen (Hdt. I,141 und 152/153): Dieses Kapitel untersucht Kyros' Umgang mit den griechischen Delegationen und analysiert, wie Herodot Kyros' Machtansprüche und seine politische Strategie darstellt. Es wird erörtert, inwieweit diese Aspekte mit dem Tragischen in Verbindung stehen.
- Die erste Grenzüberschreitung: Kyros' Rache am Gyndes (Hdt. I,189): Dieses Kapitel analysiert Kyros' Rache an dem Fluss Gyndes und diskutiert, inwieweit diese Handlung als erste Grenzüberschreitung interpretiert werden kann, die zu seinem tragischen Untergang führt.
- Tomyris' und Kroisos' missachtete Mahnreden: Kyros' erster verhängnisvoller Fehler (Hdt. 1,201-208) – Weitere Betrachtungen zu Herodots Erzähltechnik: Dieses Kapitel untersucht die Warnungen, die Kyros von Tomyris und Kroisos erhält, und analysiert, inwieweit Kyros' Missachtung dieser Mahnreden zu seinem tragischen Ende beiträgt. Außerdem werden Herodots Erzähltechniken in diesem Zusammenhang genauer betrachtet.
- Verkannte Warnungen: Kyros' Verblendung und sein letzter Schritt ins Verderben (Hdt. I,209-212).: Dieses Kapitel analysiert Kyros' Verblendung und seinen letzten Schritt ins Verderben. Es wird untersucht, inwieweit Kyros' Verweigerung, Warnungen anzunehmen, zu seinem tragischen Untergang beiträgt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der attischen Tragödie auf Herodots Historien, insbesondere mit der Darstellung des Perserkönigs Kyros. Im Zentrum stehen die Themen Hybris, Verblendung, Determinismus, menschliche Freiheit, tragische Ironie, Schuld und Sühne. Die Analyse erfolgt anhand von Herodots Erzähltechniken, die Verwendung von tragischen Elementen sowie dem Vergleich mit anderen Herrscherschicksalen in Herodots Werk.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste die attische Tragödie das Werk von Herodot?
Herodot übernahm dramaturgische Techniken, Motivik und das Konzept des tragischen Scheiterns aus der Tragödie, um historische Ereignisse zu deuten.
Welche Rolle spielt die „Hybris“ im Schicksal des Königs Kyros?
Kyros' Übermut und seine Missachtung göttlicher und menschlicher Grenzen (Hybris) führen laut Herodot zwangsläufig zu seinem tragischen Untergang.
Handelt Kyros bei Herodot eigenverantwortlich?
Ja, die Forschung (z.B. Schulte-Altedorneburg) betont, dass der Mensch bei Herodot trotz göttlicher Vorsehung durch eigene Fehlentscheidungen sein Ende mitbestimmt.
Was war die erste große Grenzüberschreitung von Kyros?
Seine Rache am Fluss Gyndes gilt als symbolische Grenzüberschreitung, die seine zunehmende Verblendung und Machtgier verdeutlicht.
Welche Bedeutung haben die Mahnreden von Tomyris und Kroisos?
Sie fungieren als tragische Warnungen, die Kyros in seiner Verblendung ignoriert, was seinen Charakter als tragischen Helden festigt.
- Citar trabajo
- Rodrigo Barajas (Autor), 2018, Kyros' Aufstieg zur Macht und sein Scheitern. Eine Untersuchung zur Tragik in der herodoteischen Geschichtsschreibung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944649