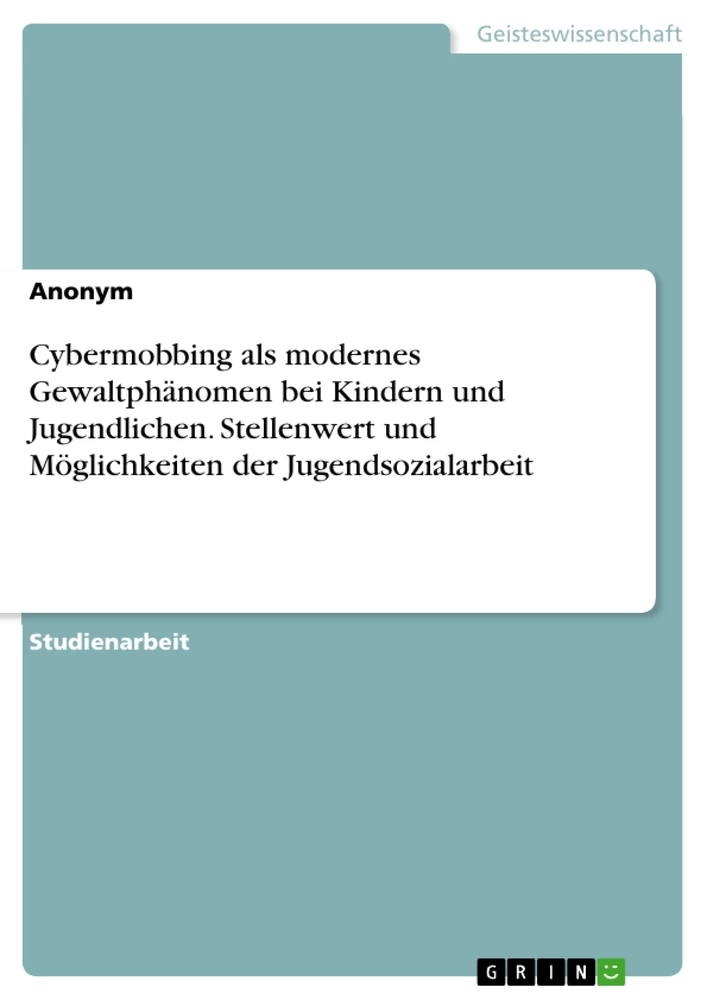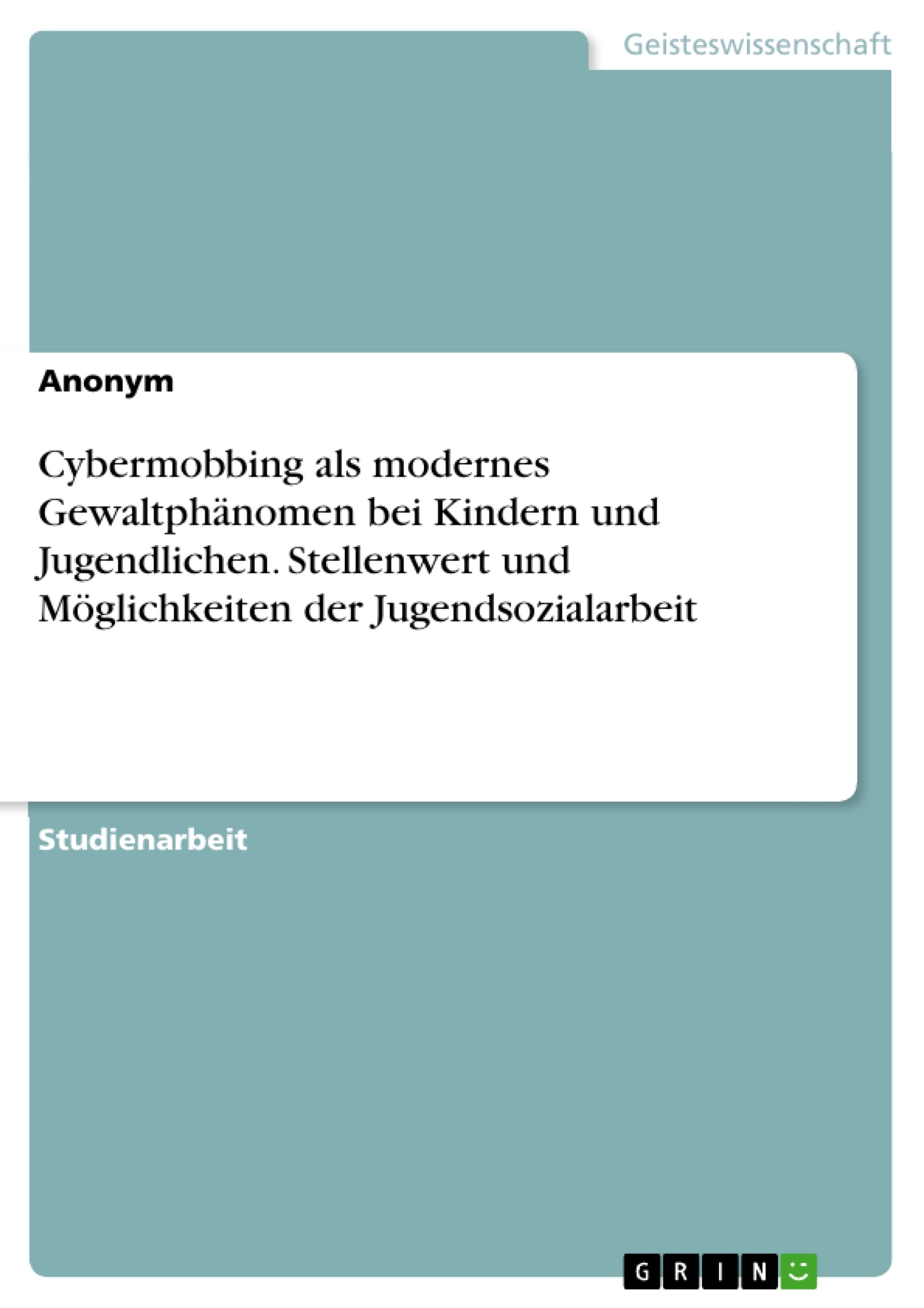In dieser Arbeit soll das Thema Cybermobbing als modernes gesellschaftliches Gewaltphänomen bei Kindern und Jugendlichen behandelt werden. Konkret sollen der Stellenwert des Cybermobbings sowie Möglichkeiten bezüglich der Thematik in der Jugendsozialarbeit behandelt werden.
Hierfür sollen zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten erläutert werden. Anschließend werden die Gründe und Auswirkungen von Cybermobbing dargestellt. Im nächsten Kapitel wird die Thematik hinsichtlich der Jugendsozialarbeit erörtert. Es folgen Präventionsmaßnahmen, Konzepte zur Prävention sowie Interventionsmaßnahmen und Konzepte zur Intervention bei Cybermobbing. Abschließend wird auf Postventionsmaßnahmen und die Rechtslage bei Cybermobbing eingegangen.
Im modernen Zeitalter gehören Internet, Laptops, Tablets und Smartphones zur Grundausstattung unserer Gesellschaft. Auch bei Kindern und Jugendlichen gehören diese digitalen Medien zum gemeinsamen kulturellen und sozialen Leben. Neben positiven Auswirkungen wie Erreichbarkeit, Informationsangebote und Kommunikationsmöglichkeiten birgt die Digitalisierung aber auch Risiken wie z.B. Cybermobbing, Fake News, Internetsucht und Spielsucht.
Dementsprechend nehmen digitale Medien immer mehr Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Gerade soziale Netzwerke und Messenger wie Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter und Snapchat sind große Bestandteile des täglichen Lebens und der Kommunikation. Durch diese Entwicklung entstehen Gewaltphänomene wie das Cybermobbing, welches eine neue Form der Gewalt darstellt.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, ist etwa jeder fünfte Jugendliche schon Opfer von Cybermobbing geworden, dabei sind Jungen mit 22% häufiger betroffen als Mädchen mit 15%. Dass Cybermobbing kein Bagatelldelikt ist, sondern zu Ausgrenzung, Minderwertigkeit, Ängsten, im schlimmsten Fall zum Suizid führen kann, ist hinlänglich bekannt. Dadurch entsteht für die Jugendsozialarbeit ein neues Arbeitsfeld, in welchem das Hauptaugenmerk auf der Prävention, der Intervention und der Postvention von Cybermobbing liegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Definitionen Mobbing und Cybermobbing
- Gründe für Cybermobbing
- Auswirkungen des Cybermobbings
- Stellenwert und Möglichkeiten der Jugendsozialarbeit im Hinblick auf Cybermobbing
- Präventionsmaßnahmen
- Konzepte zur Prävention bei Cybermobbing
- Interventionsmaßnahmen
- Konzepte zur Intervention bei Cybermobbing
- Postventionsmaßnahmen
- Präventionsmaßnahmen
- Rechtslage bei Cybermobbing
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Cybermobbing als modernes Gewaltphänomen bei Kindern und Jugendlichen und beleuchtet den Stellenwert und die Möglichkeiten der Jugendsozialarbeit im Umgang damit. Es werden Definitionen von Mobbing und Cybermobbing abgegrenzt und die Ursachen sowie die schwerwiegenden Auswirkungen von Cybermobbing auf die Betroffenen erörtert.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing und Cybermobbing
- Ursachen und Motive von Cybermobbing
- Psychosoziale Auswirkungen von Cybermobbing auf Opfer
- Rolle der Jugendsozialarbeit in Prävention, Intervention und Postvention
- Relevanz der Rechtslage im Kontext von Cybermobbing
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung beschreibt den zunehmenden Einfluss digitaler Medien auf das Leben von Kindern und Jugendlichen und hebt Cybermobbing als ein daraus resultierendes, ernstzunehmendes Gewaltphänomen hervor. Die Arbeit unterstreicht die Bedeutung der Jugendsozialarbeit in der Prävention, Intervention und Postvention von Cybermobbing und kündigt die Darstellung des Stellenwerts und der Möglichkeiten der Jugendsozialarbeit in diesem Kontext an. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und sozialen Medien wird als Kontext für das Aufkommen von Cybermobbing dargestellt, wobei die Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (JIM-Studie 2018) als Beleg für die Häufigkeit von Cybermobbing bei Jugendlichen angeführt wird.
2. Definitionen Mobbing und Cybermobbing: Dieses Kapitel definiert Mobbing und Cybermobbing und grenzt beide Phänomene voneinander ab. Es wird die Definition von Olweus für Mobbing vorgestellt und im Kontrast dazu Cybermobbing als eine allgegenwärtige Form des Mobbings beschrieben, die durch Anonymität, Verbreitung, Dauerhaftigkeit und Öffentlichkeit gekennzeichnet ist. Die Definition von Pieschl und Porsch wird ebenfalls einbezogen, welche das Erleben des Opfers in den Mittelpunkt stellt. Die Rolle von "Bystandern" und der "Bystander-Effekt" werden erläutert. Der zentrale Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing liegt in der Unmöglichkeit des Opfers, sich dem Cybermobbing zu entziehen, da es die Betroffenen permanent begleitet.
3. Gründe für Cybermobbing: Dieses Kapitel untersucht die vielfältigen Gründe für Cybermobbing. Es werden sowohl individuelle Motive wie Langeweile, Spaß, Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Wut oder Rache genannt als auch soziokulturelle Faktoren, wie z.B. aggressive Umgangsformen im Umfeld der Täter. Der Rollentausch von Mobbingopfern zu Tätern ("Täter-Opfer") wird diskutiert, ebenso wie impulsives Handeln als ein weiterer Faktor. Die dauerhafte Speicherung und Verbreitung von Bildern und Videos im Internet als spezifische Möglichkeit des Cybermobbings wird ebenfalls hervorgehoben.
4. Auswirkungen des Cybermobbings: Das Kapitel beschreibt die schwerwiegenden psychischen und sozialen Auswirkungen von Cybermobbing auf die Betroffenen. Es wird betont, dass diese Auswirkungen oft langfristig und tiefgreifend sind, und auf die psychische und soziale Ebene des Opfers wirken. Der Text deutet auf die potenziellen Folgen hin, ohne jedoch ins Detail zu gehen.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Mobbing, Jugendsozialarbeit, Prävention, Intervention, Postvention, digitale Medien, soziale Netzwerke, psychische Gesundheit, Gewalt, Opfer, Täter, Bystander-Effekt, Rechtslage.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Cybermobbing und die Rolle der Jugendsozialarbeit
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Cybermobbing, insbesondere im Hinblick auf seine Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche und die Rolle der Jugendsozialarbeit in der Prävention, Intervention und Postvention. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernthemen: Definition und Abgrenzung von Mobbing und Cybermobbing, Ursachen und Motive von Cybermobbing, psychosoziale Auswirkungen auf Opfer, die Rolle der Jugendsozialarbeit (Prävention, Intervention, Postvention), und die Relevanz der Rechtslage im Kontext von Cybermobbing. Die JIM-Studie 2018 wird als Beleg für die Häufigkeit von Cybermobbing bei Jugendlichen angeführt.
Wie werden Mobbing und Cybermobbing definiert und abgegrenzt?
Das Dokument verwendet die Definition von Olweus für Mobbing und beschreibt Cybermobbing als eine allgegenwärtige Form des Mobbings, gekennzeichnet durch Anonymität, Verbreitung, Dauerhaftigkeit und Öffentlichkeit. Die Definition von Pieschl und Porsch, die das Erleben des Opfers in den Mittelpunkt stellt, wird ebenfalls berücksichtigt. Der entscheidende Unterschied liegt in der Unmöglichkeit des Opfers, sich dem Cybermobbing zu entziehen.
Welche Ursachen und Motive für Cybermobbing werden genannt?
Das Dokument nennt sowohl individuelle Motive (Langeweile, Spaß, Minderwertigkeitsgefühle, Neid, Wut, Rache) als auch soziokulturelle Faktoren (aggressive Umgangsformen im Umfeld der Täter) als Ursachen für Cybermobbing. Der Rollentausch von Mobbingopfern zu Tätern und impulsives Handeln werden ebenfalls diskutiert. Die dauerhafte Speicherung und Verbreitung von Bildern und Videos im Internet wird als spezifische Möglichkeit des Cybermobbings hervorgehoben.
Welche Auswirkungen hat Cybermobbing auf die Betroffenen?
Das Dokument beschreibt die schwerwiegenden psychischen und sozialen Auswirkungen von Cybermobbing, die oft langfristig und tiefgreifend sind und sowohl die psychische als auch die soziale Ebene des Opfers betreffen. Konkrete Details zu den Folgen werden jedoch nicht ausführlich dargestellt.
Welche Rolle spielt die Jugendsozialarbeit im Umgang mit Cybermobbing?
Das Dokument betont die wichtige Rolle der Jugendsozialarbeit in der Prävention, Intervention und Postvention von Cybermobbing. Es werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen diskutiert, jedoch ohne konkrete Konzepte im Detail zu erläutern. Postventionsmaßnahmen werden ebenfalls erwähnt.
Wie wird die Rechtslage zum Thema Cybermobbing behandelt?
Das Dokument erwähnt die Relevanz der Rechtslage im Kontext von Cybermobbing, geht aber nicht detailliert auf spezifische Gesetze oder rechtliche Aspekte ein.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Cybermobbing, Mobbing, Jugendsozialarbeit, Prävention, Intervention, Postvention, digitale Medien, soziale Netzwerke, psychische Gesundheit, Gewalt, Opfer, Täter, Bystander-Effekt, Rechtslage.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Cybermobbing als modernes Gewaltphänomen bei Kindern und Jugendlichen. Stellenwert und Möglichkeiten der Jugendsozialarbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/944784