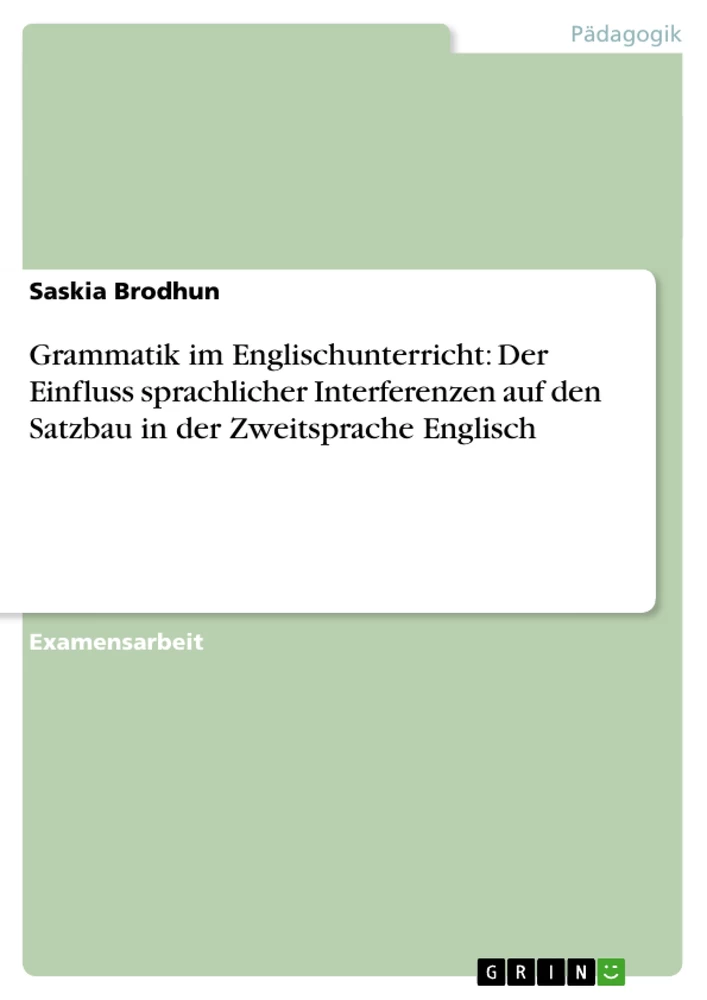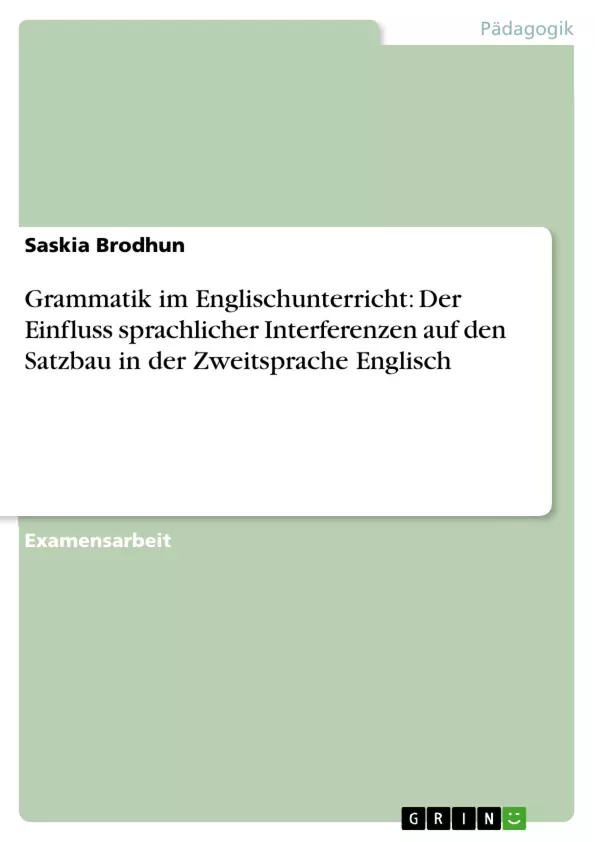„[…] we are going to drive only the last weeks to Italy” (Aigner 2001: 125). Derartig falsche Sätze findet man bei deutschen Lernern des Englischen immer wieder. Die meisten Sprachkundigen würden beim Hören dieses Satzes wahrscheinlich dem Eindruck zustimmen, dass dieser sich deshalb falsch anhört, weil er irgendwie ‚zu deutsch’ klingt (vgl.: Wir fahren nur die letzten Wochen nach Italien). Aber warum klingt dieser Satz eigentlich so deutsch? Und warum kommt es immer wieder zu derartigen Fehlern beim Erwerb des Englischen als Fremdsprache? Die Gründe hierfür liegen in der ständigen Präsenz der Muttersprache. „Muttersprachen wirken – ungewollt und ungerufen – in die Fremdsprache hinein und produzieren dort die gefürchteten Interferenzen “ (Butzkamm 2004: 146).
Dabei handelt es sich keineswegs um Ausnahmeerscheinungen. „Muttersprachlicher Transfer hat sich als die Hauptursache für fremdsprachliche Fehler herausgestellt“ (Schloter 1992: 134). Dieser findet sich besonders bei Anfängern in den verschiedensten Bereichen der Sprache wieder. „Je weniger wir eine Fremdsprache ausgebaut haben, desto leichter lässt sie sich von der Muttersprache infizieren, angefangen bei Lautung und Schreibung bis hin zur Idiomatik und Pragmatik“ (Butzkamm 2004: 146).
Den am stärksten betroffenen Bereich stellt dabei der Satzbau dar (vgl. Ideler 2001: 297; Aigner 1996: 152 ff.). Vor diesem Hintergrund erscheint es lohnenswert, genau für diesen Bereich zu untersuchen, wie und warum die Muttersprache den Fremdsprachenerwerb negativ beeinflusst. Diese Erkenntnisse können als Grundlage dienen, Ansätze für einen Grammatikunterricht zu entwickeln, der dazu beiträgt, derartige Interferenzen zu vermeiden.
Damit ergeben sich die beiden Zielsetzungen dieser Arbeit: Es soll zum einen analysiert werden, welchen Einfluss die Muttersprache und die dadurch entstehenden Interferenzen auf den Satzbau in der Fremdsprache Englisch ausüben. Das zweite Ziel besteht darin, auf Grundlage der erkannten Ursachen für diese L1-Interferenzen geeignete Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese Fehler durch Grammatikunterricht vermieden werden können.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grammatikunterricht im Wandel der Zeit
- 2.1 Die Grammatik-Übersetzungsmethode
- 2.2 Erste Reformen
- 2.3 Die audiolinguale und die audiovisuelle Methode
- 2.4 Die kommunikative Wende
- 2.5 Der aktuelle Forschungsstand
- 3 Erst- und Zweitspracherwerb
- 3.1 Erstspracherwerb
- 3.1.1 Theorien des Erstspracherwerbs
- 3.1.2 Voraussetzungen für den Spracherwerb
- 3.1.3 Erwerbsstadien im Erstspracherwerb
- 3.2 Zweitspracherwerb
- 3.2.1 Theorien des Zweitspracherwerbs
- 3.2.2 Erwerbsstadien im Zweitspracherwerb
- 4 Sprachliche Interferenzen
- 4.1 Begriffsklärung und Einschränkung des Analysefeldes
- 4.2 Sprachliche Interferenzen und Zweitspracherwerbshypothesen
- 4.2.1 Die Kontrastivhypothese
- 4.2.2 Die Identitätshypothese
- 4.2.3 Die Lernersprachenhypothese
- 4.3 Ursachen für sprachliche Interferenzen
- 4.4 Klassifizierung von Interferenzen
- 4.4.1 Interferenztypen
- 4.4.2 Arten von Interferenzfehlern
- 4.5 Syntaktische Interferenzen
- 4.5.1 Grammatische Fehler verursachende Interferenzen
- 4.5.2 Unnatürliche stilistische Effekte verursachende Interferenzen und Probleme der Informationssteuerung
- 5 Von der Theorie zur Praxis
- 5.1 Sprachdidaktische Schlussfolgerungen aus der Theorie
- 5.2 Praktische Übungen zur Vermeidung syntaktischer Interferenzen
- 5.2.1 Übungen zur Vermeidung grammatischer Fehler aufgrund syntaktischer Interferenzen
- 5.2.2 Übungen zu möglichen Kompensationsstrategien zur Vermeidung unnatürlicher stilistischer Effekte
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Einfluss der Muttersprache auf den Satzbau im Englischunterricht und entwickelt daraus Ansätze für einen Grammatikunterricht, der Interferenzen vermeidet. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen muttersprachlicher Interferenzen auf den Erwerb der englischen Satzstruktur. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Ursachen dieser Interferenzen und der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung dieser Fehler im Unterricht.
- Einfluss der Muttersprache auf den englischen Satzbau
- Theorien des Erst- und Zweitspracherwerbs
- Klassifizierung und Ursachen sprachlicher Interferenzen
- Entwicklung von Strategien zur Interferenzvermeidung im Grammatikunterricht
- Sprachdidaktische Ansätze zur Reduktion von Interferenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der sprachlichen Interferenzen im Englischunterricht ein, indem sie anhand eines Beispielsatzes die Problematik verdeutlicht. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss der Muttersprache auf den Satzbau im Englischen und die daraus resultierenden Fehler dar. Die beiden Hauptziele der Arbeit werden formuliert: die Analyse des Einflusses der Muttersprache auf den Satzbau und die Entwicklung von Ansätzen für einen Grammatikunterricht, der Interferenzen vermeidet.
2 Grammatikunterricht im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung des Grammatikunterrichts im Englischunterricht, beginnend mit der Grammatik-Übersetzungsmethode und den darauf folgenden Reformen. Es beleuchtet verschiedene Methoden wie die audiolinguale und audiovisuelle Methode sowie die kommunikative Wende und den aktuellen Forschungsstand. Dieser historische Überblick dient als Grundlage für die spätere Entwicklung praxisorientierter Ansätze zur Interferenzvermeidung.
3 Erst- und Zweitspracherwerb: Dieses Kapitel befasst sich mit Theorien und Stadien des Erst- und Zweitspracherwerbs. Es werden relevante Theorien des Erstspracherwerbs (z.B. die Rolle von Input und Interaktion) und des Zweitspracherwerbs (z.B. Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Lernersprachenhypothese) vorgestellt. Der Vergleich beider Erwerbsarten bildet die Grundlage für das Verständnis von Interferenzen und deren Entstehung.
4 Sprachliche Interferenzen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der sprachlichen Interferenz und grenzt das Analysefeld ein. Es werden verschiedene Hypothesen zum Zweitspracherwerb im Kontext von Interferenzen diskutiert (Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Lernersprachenhypothese). Es werden Ursachen für sprachliche Interferenzen untersucht und verschiedene Arten von Interferenzfehlern klassifiziert, mit besonderem Fokus auf syntaktische Interferenzen und deren Auswirkungen auf den Satzbau.
5 Von der Theorie zur Praxis: Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen der vorherigen Kapitel werden in diesem Kapitel sprachdidaktische Schlussfolgerungen gezogen und praktische Übungen zur Vermeidung syntaktischer Interferenzen im Englischunterricht entwickelt. Es werden konkrete Übungen vorgestellt, die auf die Vermeidung grammatischer Fehler und die Entwicklung von Kompensationsstrategien abzielen.
Schlüsselwörter
Muttersprachlicher Transfer, Zweitspracherwerb, Interferenzen, Englischunterricht, Grammatikunterricht, Satzbau, Sprachdidaktik, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Lernersprachenhypothese, Interferenzvermeidung, Übungen, Kompensationsstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Einflusses der Muttersprache auf den Satzbau im Englischunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Einfluss der Muttersprache auf den Satzbau im Englischunterricht und entwickelt daraus Ansätze für einen Grammatikunterricht, der Interferenzen – also den negativen Einfluss der Muttersprache auf die Zweitsprache – vermeidet. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Auswirkungen muttersprachlicher Interferenzen auf den Erwerb der englischen Satzstruktur, den Ursachen dieser Interferenzen und der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung dieser Fehler im Unterricht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Grammatikunterrichts, Theorien des Erst- und Zweitspracherwerbs (inkl. relevanter Hypothesen wie der Kontrastivhypothese, Identitätshypothese und Lernersprachenhypothese), die Klassifizierung und Ursachen sprachlicher Interferenzen, insbesondere syntaktischer Interferenzen, und die Entwicklung von sprachdidaktischen Ansätzen und praktischen Übungen zur Reduktion von Interferenzen im Englischunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Grammatikunterricht im Wandel der Zeit, 3. Erst- und Zweitspracherwerb, 4. Sprachliche Interferenzen, 5. Von der Theorie zur Praxis und 6. Zusammenfassung und Ausblick. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung in das Thema und endend mit der Entwicklung praxisorientierter Ansätze.
Welche Theorien des Erst- und Zweitspracherwerbs werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet relevante Theorien des Erstspracherwerbs (z.B. die Rolle von Input und Interaktion) und des Zweitspracherwerbs (z.B. Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Lernersprachenhypothese). Diese Theorien bilden die Grundlage für das Verständnis von Interferenzen und deren Entstehung.
Wie werden sprachliche Interferenzen klassifiziert und erklärt?
Die Arbeit definiert den Begriff der sprachlichen Interferenz und grenzt das Analysefeld ein. Sie untersucht verschiedene Hypothesen zum Zweitspracherwerb im Kontext von Interferenzen und analysiert die Ursachen für sprachliche Interferenzen. Verschiedene Arten von Interferenzfehlern werden klassifiziert, mit besonderem Fokus auf syntaktische Interferenzen und deren Auswirkungen auf den Satzbau.
Welche praktischen Ansätze zur Interferenzvermeidung werden vorgestellt?
Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen werden sprachdidaktische Schlussfolgerungen gezogen und praktische Übungen zur Vermeidung syntaktischer Interferenzen im Englischunterricht entwickelt. Konkrete Übungen zur Vermeidung grammatischer Fehler und zur Entwicklung von Kompensationsstrategien werden vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Muttersprachlicher Transfer, Zweitspracherwerb, Interferenzen, Englischunterricht, Grammatikunterricht, Satzbau, Sprachdidaktik, Kontrastivhypothese, Identitätshypothese, Lernersprachenhypothese, Interferenzvermeidung, Übungen, Kompensationsstrategien.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende und Studierende im Bereich der Anglistik/Linguistik, insbesondere für diejenigen, die sich mit Grammatikunterricht, Zweitspracherwerb und Sprachdidaktik beschäftigen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Problematik sprachlicher Interferenzen und liefert konkrete Ansätze für einen effektiveren Englischunterricht.
- Citation du texte
- Saskia Brodhun (Auteur), 2008, Grammatik im Englischunterricht: Der Einfluss sprachlicher Interferenzen auf den Satzbau in der Zweitsprache Englisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94498