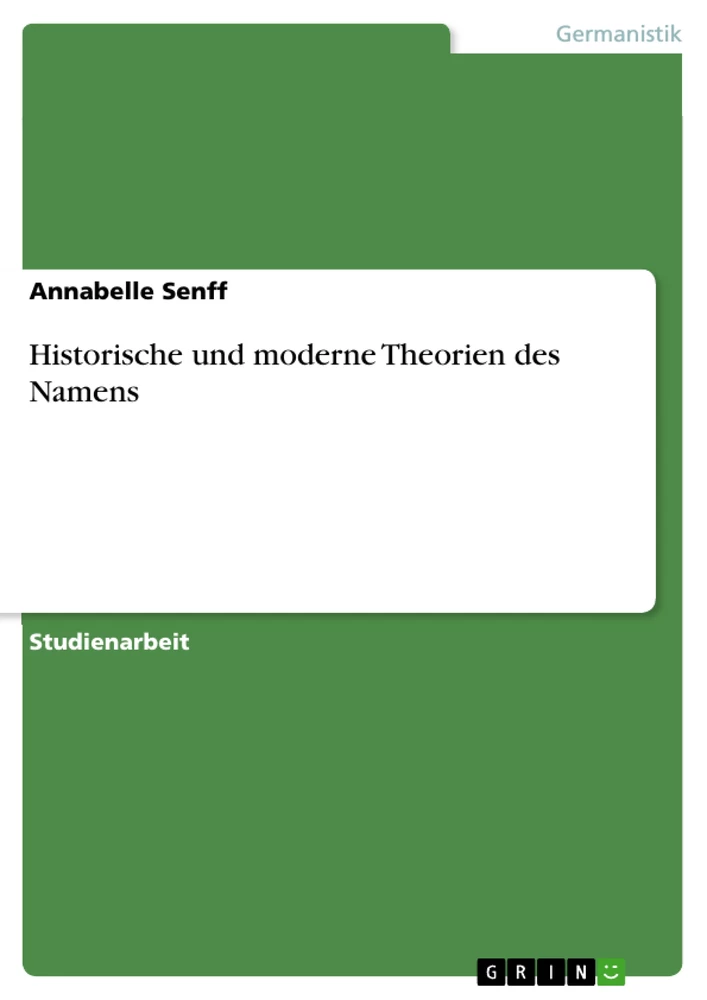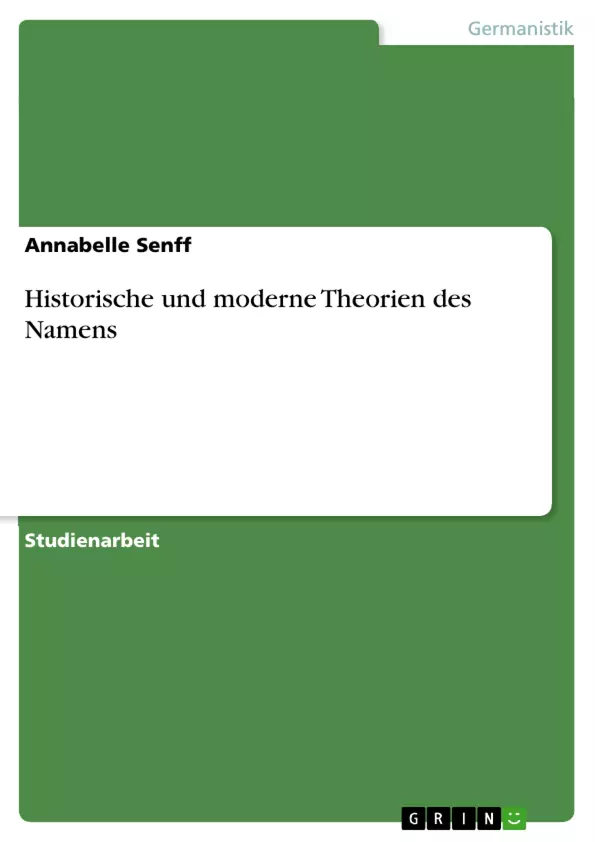In allen Sprachen der Welt markiert die Kategorie „Name“ einen besonderen Status. Jene universale Klasse hat von der Wirkung her ihre immens hohe soziale Aufmerksamkeit u.a. deshalb inne, »weil Namengebung zu den anthropologischen Grundbedürfnissen organisierter Gemeinschaften gehört«, wie Kalverkämper (1994: 209, 212) nüchtern konstatiert. Grund genug, sich diesem ergiebigen Gebiet der Sprachwissenschaft näher zu widmen.
Innerhalb des vorliegenden Beitrages zur Namenkunde soll sich daher detailliert mit der Geschichte und dem Gebrauch der Namen auseinandergesetzt werden. In Kapitel 2 erfolgt dabei zunächst die Darstellung der Entwicklung jener Thematik von historischen Theorien bis hin zu modernen Erklärungsmodellen, da man in der Deutung und Darlegung aktuellerer Forschungsstände auf die Betrachtung historischer Entwicklungen nicht verzichten kann.
Von der Antike bis zur Gegenwart andauernd ist die Untersuchung zur Unterscheidung des Nomen proprium (individueller Eigenname) vom Nomen appellativum (allgemeiner Gattungsname) immer wieder zum Forschungsgegenstand erhoben worden. Koß (2002: 55) regt jene Diskussion durch sein persiflierendes Eingangsbeispiel gelungen an: Namen sind demgemäß offensichtlich nicht nur »Schall und Rauch«
Den EN wird dabei im System der Sprache des Öfteren eine gewisse Sonderstellung zugesprochen, um deren wissenschaftliche Erfassung man hinsichtlich der Ausdrucks- und Inhaltsseite sowie im Bezug auf seine Verwendung bemüht ist. Als ein zentraler Aspekt in der Namenforschung kristallisiert sich epochenübergreifend die Frage nach dem Namen und seiner Bedeutung heraus, was schließlich in Kapitel 3 zum Untersuchungsgegenstand erhoben wird. Hansack (2004: 51) weist in diesem Zusammenhang auf jenen, durch ihn konträr vertretenen, Standpunkt hin: »nach traditioneller, heute noch weit verbreiteter Vorstellung haben Namen keine Bedeutung«. Innerhalb der Forschungsliteratur trifft man diesbezüglich jedoch auf einen durchaus kontrovers diskutierten Gegenstand, welcher einen graduell differenzierten Sinngehalt unterstellt bekommt. Dahingehend kursieren Auffassungen, welche von keiner, über eine begrenzte (Zwischenwerte) bis hin zu einem hohen Maß (Maximum) an Bedeutung reichen.
Jene unterschiedlichen Betrachtungsansätze werden im Verlauf der Arbeit schließlich noch ausführlicher kommentiert und erläutert. Den Abschluss bildet Kapitel 4 mit dem Versuch der Herleitung einer möglichst umfassenden Definition zur Kategorie „Name“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Theorien der Namenforschung
- Historische Auffassungen
- Moderne Auffassungen
- Zur Bedeutung von Namen
- Definitionsansätze
- Die phonematisch-graphematische Ebene
- Die morphematisch-lexematische Ebene
- Die syntaktische Ebene
- Die semantische Ebene
- Zusammenfassende Schlussbemerkungen und weiterreichende Ausblicke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und den Gebrauch von Namen. Sie beleuchtet historische und moderne Theorien der Namenforschung, untersucht die Bedeutung von Namen und entwickelt einen umfassenden Definitionsansatz für die Kategorie „Name“. Die Arbeit konzentriert sich auf die Unterscheidung zwischen Eigennamen und Appellativen.
- Historische Entwicklungen der Namenforschung
- Moderne Theorien der Namengebung
- Bedeutung von Namen: kontroverse Positionen und graduelle Differenzierung
- Definition des Begriffs „Name“
- Eigenname vs. Appellativ
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Das Vorwort führt in die Thematik der Namenkunde ein und betont die soziale Bedeutung von Namen. Es skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit der historischen Entwicklung und dem Gebrauch von Namen auseinandersetzt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Unterscheidung zwischen Eigennamen und Appellativen, wobei historische und moderne Theorien kontrastiert werden. Die Arbeit greift auf die Forschung von Kalverkämper, Hansack und Koß zurück und beleuchtet die kontroverse Frage nach der Bedeutung von Namen.
2. Theorien der Namenforschung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Namenforschung von historischen zu modernen Ansätzen. Es zeigt die Kontroverse zwischen der „Naturtheorie“ und der „Übereinkunftstheorie“ in der Antike auf, wobei die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Namen und dem Wesen der benannten Sache diskutiert wird. Die Arbeit stellt fest, dass sich die Meinungen darüber, ob Namen überhaupt Bedeutung haben und wenn ja, in welchem Ausmaß, stark unterscheiden. Der Unterschied zwischen Eigennamen (EN) und Appellativen (App) wird als zentraler Forschungsgegenstand hervorgehoben. Die Ausführungen basieren auf den Arbeiten von Hansack und Koß und untersuchen den historischen und aktuellen Forschungsstand.
Schlüsselwörter
Namenforschung, Eigenname, Appellativ, Nomen proprium, Nomen appellativum, historische Theorien, moderne Theorien, Bedeutung von Namen, Namensgebung, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Namenforschung. Er behandelt historische und moderne Theorien, untersucht die Bedeutung von Namen und entwickelt einen Definitionsansatz für den Begriff "Name", wobei der Unterschied zwischen Eigennamen und Appellativen im Mittelpunkt steht. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Die wichtigsten Themen sind: historische und moderne Theorien der Namenforschung (inkl. "Naturtheorie" und "Übereinkunftstheorie"), die Bedeutung von Namen (inklusive kontroverser Positionen), die Definition des Begriffs "Name", die Unterscheidung zwischen Eigennamen und Appellativen, sowie die Entwicklung der Namenforschung im Laufe der Zeit. Die Arbeit bezieht sich auf die Forschung von Kalverkämper, Hansack und Koß.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in folgende Kapitel: Ein Vorwort, ein Kapitel zu den Theorien der Namenforschung (unterteilt in historische und moderne Auffassungen), ein Kapitel zur Bedeutung von Namen, ein Kapitel zu Definitionsansätzen (auf phonetischer, morphologischer, syntaktischer und semantischer Ebene) und abschließende Bemerkungen und Ausblicke. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welche Definitionsansätze für den Begriff "Name" werden vorgestellt?
Der Text betrachtet "Name" auf verschiedenen Ebenen: der phonetisch-graphematischen (Laut- und Schriftbild), der morphematisch-lexematischen (Wortbildung und Wortbedeutung), der syntaktischen (Satzbau) und der semantischen Ebene (Bedeutungsinhalt). Dies ermöglicht eine umfassende Betrachtung des Begriffs.
Wie werden Eigennamen und Appellative im Text unterschieden?
Die Unterscheidung zwischen Eigennamen und Appellativen ist ein zentrales Thema des Textes. Es wird herausgearbeitet, wie sich diese beiden Kategorien in der historischen und modernen Namenforschung definieren und wie sie sich voneinander unterscheiden.
Welche Autoren werden im Text zitiert?
Der Text bezieht sich auf die Arbeiten von Kalverkämper, Hansack und Koß zur Namenforschung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Textinhalt?
Schlüsselwörter sind: Namenforschung, Eigenname, Appellativ, Nomen proprium, Nomen appellativum, historische Theorien, moderne Theorien, Bedeutung von Namen, Namensgebung, Sprachwissenschaft.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich akademisch mit Namenforschung auseinandersetzen möchten. Die strukturierte Darstellung und die Zusammenfassung der zentralen Themen machen ihn gut geeignet für wissenschaftliche Arbeiten.
- Quote paper
- Stud. phil. Annabelle Senff (Author), 2008, Historische und moderne Theorien des Namens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94520