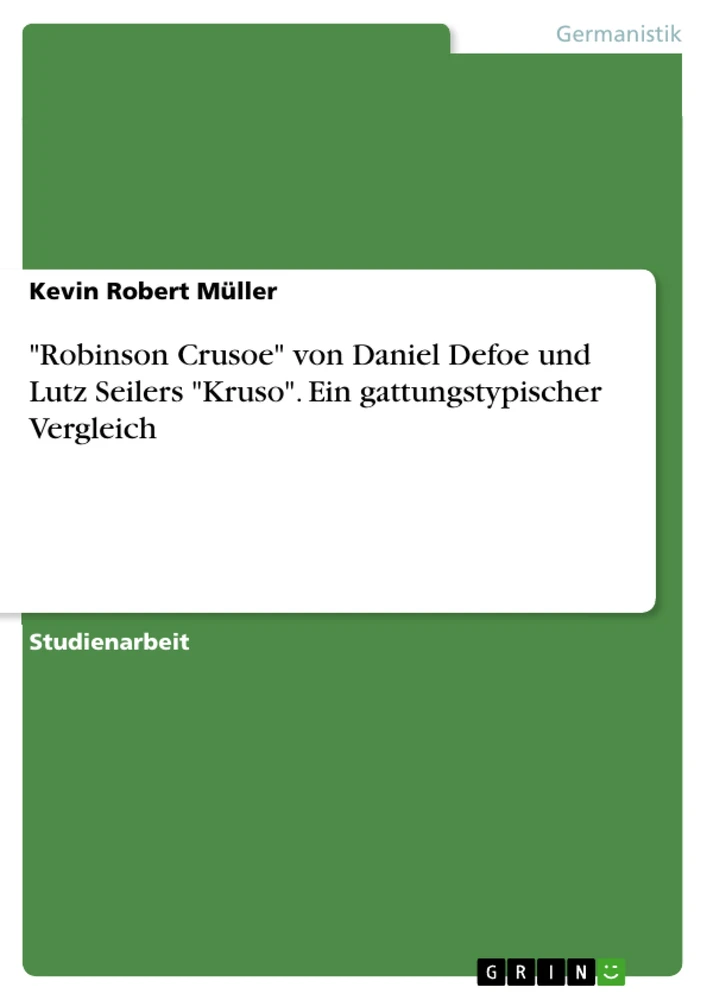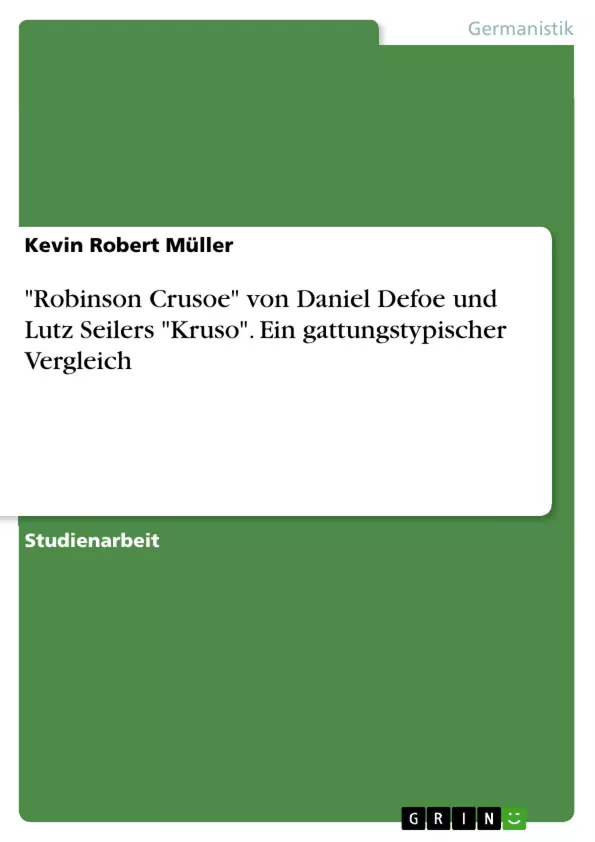In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, was sich genau hinter dem Begriff der Robinsonade verbirgt und auf welchen Füßen eine derartige Erzähltradition steht. Inwiefern verhält sich Defoes Roman als Paradigma des Genres? Die Bearbeitung der Thematik findet vor dem Hintergrund des literarischen Werkes "Kruso" von Lutz Seiler, welches im Jahr 2014 erschien, statt. Der Roman wurde unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.
Nachdem also zunächst nach Klärung des Robinsonadenbegriffs eine kurze Vorstellung Defoes Romans aus dem frühen 18. Jahrhundert folgt, wird in einem dritten Schritt die Auseinandersetzung mit Seilers Erfolgsroman einsetzen. Die Begründung der Jury des Buchpreises, Seiler habe eine packende Robinsonade geliefert, soll alsdann einer Prüfung unterzogen werden. Welche gattungstypischen Merkmale teilt Kruso mit "The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe", wie Defoes Roman im Original erschienen ist? Inwieweit lässt sich also der Buchpreisgewinner innerhalb der Erzähltradition der Robinsonade einfassen?
Nahezu dreihundert Jahre ist es her das Daniel Defoes Klassiker "Robinson Crusoe" 1719 erschien. Dass heute in den Literaturwissenschaften von der Gattung der Robinsonade (als Genre verstanden) die Rede ist, bezeugt den immensen künstlerischen wie auch kulturellen Stellenwert, den dieser innehat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist die Robinsonade? Eine Gattungsbestimmung
- Kruso und Crusoe - Parallelen und Gegensätze in der komparatistischen Analyse
- Gattungstypische Grundmuster
- Isolation
- Physische und psychische Überlebensbemühungen
- Die Reise ins Innere
- Die Gefährten der Robinsonfigur
- Fiktionale Autobiographie
- Das Motiv der Höhle und weitere Parallelen
- Gattungstypische Grundmuster
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gattung der Robinsonade, die durch Daniel Defoes "Robinson Crusoe" geprägt wurde. Ziel ist es, den Begriff der Robinsonade zu definieren und herauszufinden, welche Merkmale Defoes Roman als "Paradigma des Genre" auszeichnen. Der Roman "Kruso" von Lutz Seiler wird in die Analyse einbezogen, um zu überprüfen, inwieweit er gattungstypische Merkmale der Robinsonade aufweist.
- Die Definition der Robinsonade als literarische Gattung
- Die Merkmale von Defoes "Robinson Crusoe" als prototypische Robinsonade
- Der Vergleich von "Kruso" mit "Robinson Crusoe" hinsichtlich gattungstypischer Merkmale
- Die Analyse des Höhlenmotivs in beiden Romanen
- Die Relevanz der Robinsonade in der heutigen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der Robinsonade ein und stellt den historischen Kontext sowie die Relevanz des Genres für die heutige Literatur dar. Sie beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und skizziert den Aufbau der Analyse.
- Kapitel 2: Was ist die Robinsonade? Eine Gattungsbestimmung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition der Robinsonade als literarische Gattung und untersucht die wichtigsten Merkmale und Entwicklungslinien des Genres.
- Kapitel 3: Kruso und Crusoe - Parallelen und Gegensätze in der komparatistischen Analyse: In diesem Kapitel werden "Robinson Crusoe" und "Kruso" miteinander verglichen. Es wird untersucht, welche gattungstypischen Merkmale die beiden Romane teilen und wo sie sich voneinander unterscheiden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind Robinsonade, Gattung, Literatur, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Lutz Seiler, Kruso, Isolation, Überlebenskampf, Autobiographie, Intertextualität, Höhlenmotiv, Vergleichende Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Robinsonade?
Eine Robinsonade ist ein literarisches Genre, das durch Daniel Defoes Roman „Robinson Crusoe“ begründet wurde und Themen wie Isolation, Überlebenskampf und die Reise ins Innere behandelt.
Welcher moderne Roman wird in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit vergleicht den Klassiker von Defoe mit dem 2014 erschienenen und preisgekrönten Roman „Kruso“ von Lutz Seiler.
Welche gattungstypischen Merkmale teilen „Robinson Crusoe“ und „Kruso“?
Beide Werke weisen Parallelen in den Bereichen Isolation, physische und psychische Überlebensbemühungen sowie das Motiv der fiktionalen Autobiographie auf.
Welche Rolle spielt das „Höhlenmotiv“ in der Analyse?
Das Höhlenmotiv wird als eine der zentralen intertextuellen Parallelen zwischen Defoes Original und Seilers Werk untersucht.
Warum wird Defoes Roman als „Paradigma des Genres“ bezeichnet?
Da er 1719 die Grundmuster und Strukturen festlegte, auf denen die gesamte spätere Erzähltradition der Robinsonade basiert.
- Quote paper
- Kevin Robert Müller (Author), 2016, "Robinson Crusoe" von Daniel Defoe und Lutz Seilers "Kruso". Ein gattungstypischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947175