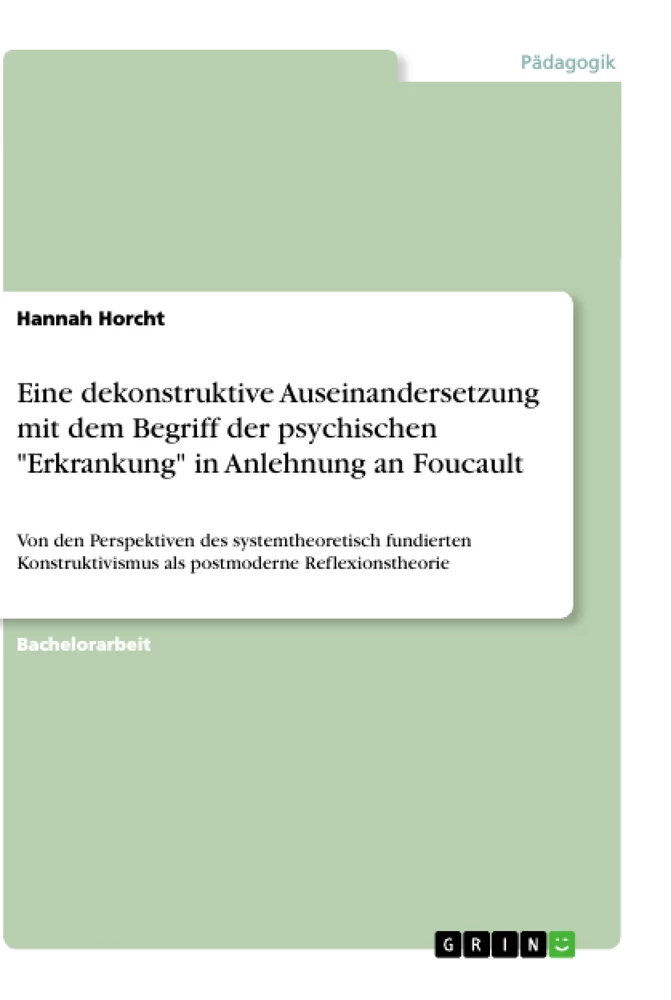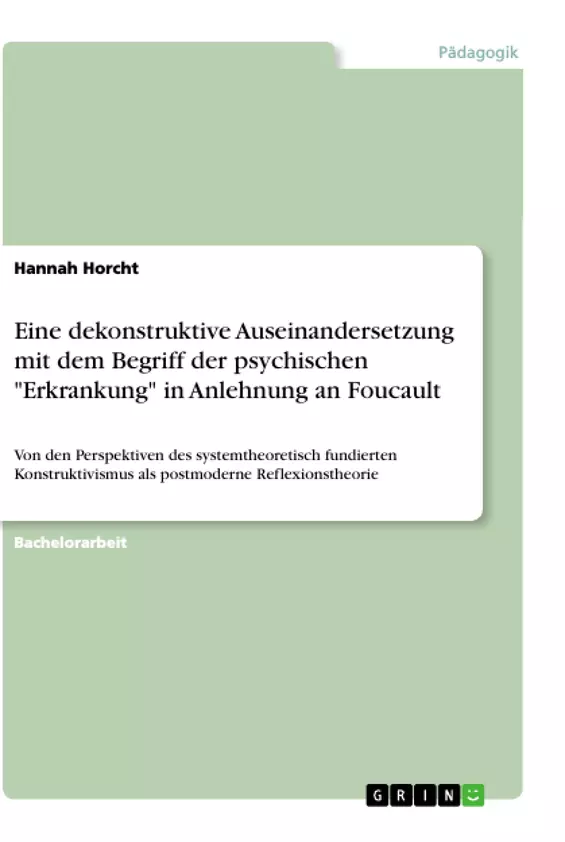Sind psychische Erkrankungen existent oder handelt es sich hierbei um soziale Konstruktionen, die lediglich dazu dienen, abweichendes Verhalten einzelner Menschen durch Medikalisierung in den Griff zu bekommen?
Vor allen Dingen die aus der französischen Philosophie kommende Debatte der Postmoderne, insbesondere aber zwei Persönlichkeiten des französischen Poststrukturalismus – Michel Foucault und Jacques Derrida – hinterließen bei der Autorin einen so nachhaltigen Eindruck, dass sie sich derer beider Denkanstöße als Grundlage innerhalb der Bachelorarbeit zunutze machen wollte.
Die Autorin hat sich demnach mit der zentralen Praxis der Dekonstruktion befasst, die in diesem Kontext nicht so sehr als explizite Methode zu verstehen ist, sondern vielmehr „als eine bestimmte kritische Haltung gegenüber jeglichen bestehenden Beschreibungen.
Das heißt, dass sich der Autor zwar innerhalb eines Begriffssystems aufgehalten hat, allerdings mit der Intention, genau dieses – in diesem konkreten Fall das der psychischen Krankheiten – aufzubrechen, es aus immer wieder neuen Blickwinkeln zu betrachten, die Kontexte zu verändern und so mit dem Sinn zu spielen; solange man noch auf der Seite der Vernunft steht, hat noch nicht wirklich eine Dekonstruktion stattgefunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Beziehungen zwischen konstruktivistischem Denken, Postmoderne und Dekonstruktion
- Das Phänomen der Selbstreferenz als zentraler Aspekt konstruktivistischen Denkens
- Zum Verhältnis zwischen Konstruktivismus und Postmoderne
- Die Postmoderne: Ein Eingeständnis an die Pluralität von Wirklichkeiten
- Vom Umgang des Konstruktivismus mit dem Verlust einer objektiven Wahrheit
- Dekonstruktion: Der Versuch einer Definition
- Der Wahnsinn existiert nur in einer Gesellschaft
- Die Geschichte von der ethnologischen Ausschließung des Irren
- Das Ausschließungssystem von der Arbeit
- Das Ausschließungssystem von der Familie
- Das Ausschließungssystem von der Rede
- Das Ausschließungssystem von dem gesellschaftlichen Spiel
- Foucault über den allumfassenden Ausschluss des Irren
- Der Versuch einer Analyse der Status-Veränderungen des Irren
- Die Geschichte von der ethnologischen Ausschließung des Irren
- Möglichkeiten und Perspektiven des systemtheoretisch fundiertem Konstruktivismus als postmoderne Reflexionstheorie
- Zum Begriff des problemdeterminierten Systems
- Was ist ein Problem ...?
- und wie kommen Probleme zustande?
- Sprechen wir doch von Problemen anstatt von Krankheiten: Über eine alternative Sicht der Dinge, die sich der Möglichkeit zur Veränderung widmet
- Zum Begriff des problemdeterminierten Systems
- Dekonstruktion als zentrales Thema therapeutischer Gespräche
- Die Verfremdung des Heimischen: Zum Prozess der Erörterung und des Aussprechens des >>Ungesagten<<
- Die Dekonstruktion von Geschichten, in denen Menschen leben
- Die Dekonstruktion moderner Machtpraktiken
- Die Dekonstruktion von Expertenwissen
- Vergessen wir nicht... die Neugier!
- Die Verfremdung des Heimischen: Zum Prozess der Erörterung und des Aussprechens des >>Ungesagten<<
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Begriff der psychischen Erkrankung und seiner Dekonstruktion im Kontext des konstruktivistischen Denkens und der Postmoderne. Das Ziel ist es, die konstruierte Natur des Begriffs aufzuzeigen und die Auswirkungen auf die Stigmatisierung und Ausgrenzung Betroffener zu beleuchten.- Dekonstruktion des Begriffs der psychischen Erkrankung
- Analyse der konstruktiven Natur von Wirklichkeit
- Kritik an Machtstrukturen und Diskursiven Praktiken
- Die Rolle des Konstruktivismus und der Postmoderne im Kontext der Dekonstruktion
- Möglichkeiten und Perspektiven einer Veränderung in der Wahrnehmung psychischer Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
- **Einführung:** Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die Motivation für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff der psychischen Erkrankung. Die Relevanz der Dekonstruktion im Kontext gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktionen wird herausgestellt.
- **Beziehungen zwischen konstruktivistischem Denken, Postmoderne und Dekonstruktion:** Dieses Kapitel behandelt die Kernelemente des Konstruktivismus, der Postmoderne und der Dekonstruktion und beleuchtet deren Beziehungen zueinander.
- **Der Wahnsinn existiert nur in einer Gesellschaft:** Dieser Abschnitt analysiert Foucaults Theorie des Wahnsinns als Ausschließungsphänomen und untersucht die historischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zur Konstruktion des Begriffs der psychischen Erkrankung führten.
- **Möglichkeiten und Perspektiven des systemtheoretisch fundiertem Konstruktivismus als postmoderne Reflexionstheorie:** Hier werden die Möglichkeiten und Perspektiven des Konstruktivismus als postmoderne Reflexionstheorie in Bezug auf die Wahrnehmung und Behandlung psychischer Erkrankungen diskutiert.
- **Dekonstruktion als zentrales Thema therapeutischer Gespräche:** Dieses Kapitel beleuchtet die Dekonstruktion als zentrale Praxis in therapeutischen Gesprächen und analysiert deren Bedeutung für den Umgang mit individuellen Geschichten, Machtstrukturen und Expertenwissen.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit zentralen Konzepten wie Dekonstruktion, Konstruktivismus, Postmoderne, psychische Erkrankung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Macht, Diskurs und therapeutische Gespräche. Die Analyse fokussiert auf die konstruktiven Prozesse, die zur Entstehung und Reproduktion des Begriffs der psychischen Erkrankung führen, und die Auswirkungen auf die Lebenswelt Betroffener.Häufig gestellte Fragen
Sind psychische Erkrankungen soziale Konstruktionen?
In Anlehnung an Foucault untersucht die Arbeit die These, dass „Wahnsinn“ oft ein Produkt gesellschaftlicher Ausschließungsprozesse ist, um abweichendes Verhalten zu normieren.
Was bedeutet „Dekonstruktion“ im Kontext der Psychologie?
Dekonstruktion (nach Derrida) bedeutet hier eine kritische Haltung, die bestehende Begriffe wie „Krankheit“ aufbricht, um deren Machtstrukturen und Entstehungskontexte sichtbar zu machen.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Analyse?
Foucault analysiert den Wahnsinn als Phänomen, das durch den Ausschluss von Arbeit, Familie und gesellschaftlichem Spiel definiert wird, statt als rein biologische Tatsache.
Was ist ein „problemdeterminiertes System“?
In der Systemtheorie entstehen Systeme durch die Kommunikation über ein Problem; die Arbeit schlägt vor, eher von Problemen als von Krankheiten zu sprechen, um Veränderung zu ermöglichen.
Wie kann Dekonstruktion in der Therapie helfen?
Therapeutische Gespräche können genutzt werden, um die „Geschichten“, in denen Menschen leben, und das Expertenwissen kritisch zu hinterfragen und so neue Perspektiven zu eröffnen.
- Quote paper
- Hannah Horcht (Author), 2014, Eine dekonstruktive Auseinandersetzung mit dem Begriff der psychischen "Erkrankung" in Anlehnung an Foucault, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/947879