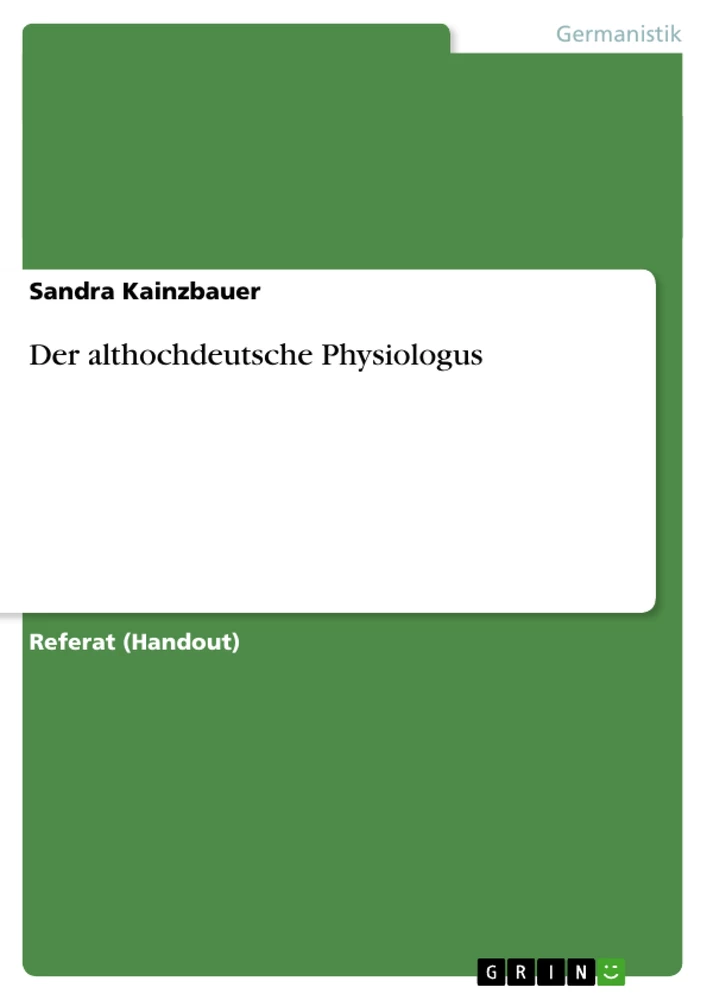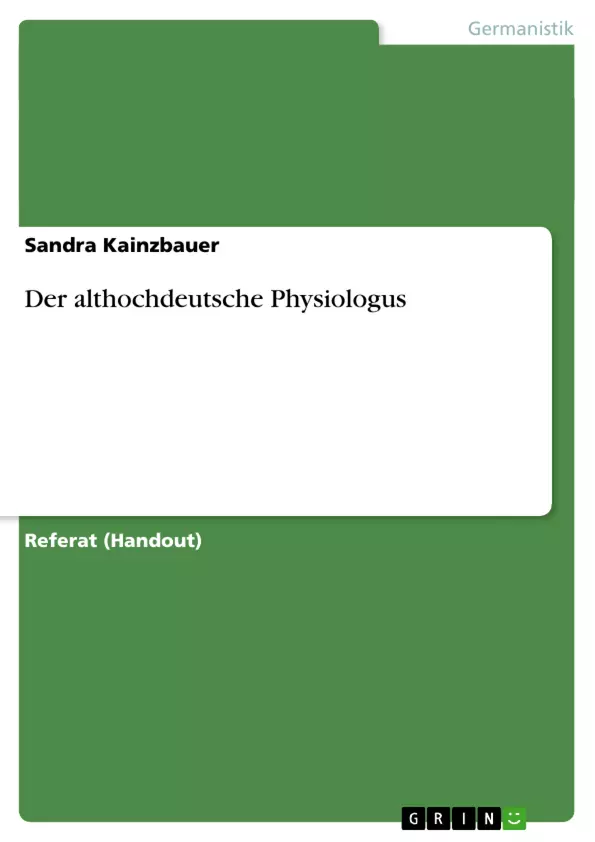Der Physiologus
Physiologus (gr., = der Naturkundige) wird die frühchristliche Bearbeitung einer Naturlehre in griechischer Sprache genannt. Der Physiologus beschreibt Pflanzen, Steine und Tiere und deutet allegorisch auf das Heilsgeschehen hin. Er geht von der geglaubten Wirklichkeit der Natur aus, die phantastischen Tiere und deren Eigenschaften sind ihm naturwissenschaftliche Realität. Er gibt sich nicht mit biologischen Tatsachen zufrieden, sondern er fragt nach deren Sinn. Denn Irdisches erhält nur Sinn durch seine Zuordnung zu dem einzigen und absoluten Wert, zu Gott.
Die Aussagen des Physiologus sind zum Großteil aus antiker Naturlehre und ägyptischem Götterglauben herleitbar und lassen sich aus zahlreichen Stellen der einschlägigen antiken Literatur belegen (bei Aristoteles, Plinius dem Älteren, Plutarch oder Aelian). Entstanden ist der Physiologus wahrscheinlich im Nahen Osten, in Ägypten, um 200 nach Christus. Der griechische Text ist in vier Fassungen überliefert, welche in einem Zeitraum von etwa 1000 Jahren entstanden sind. Übersetzungen sind erhalten in äthiopisch, syrisch, armenisch, koptisch, arabisch, georgisch, rumänisch, russisch, bulgarisch, serbisch und tschechisch. Dazu gibt es mehrfache lateinische Fassungen mit reicher Nachfolge in den romanisch-germanischen Volkssprachen: angelsächsisch, althochdeutsch und mittelhochdeutsch, flämisch, isländisch, französisch, provenzalisch, spanisch und italienisch.
Der Physiologus wurde im Mittelalter als Lehrbuch gelesen. Er wurde im naturgeschichtlichen Unterricht verwendet, diente aber auch als Erbauungsbuch.
Wichtige Fassungen des Physiologus:
Griechisch: 4 Fassungen, entstanden zwischen 2. und 12. Jahrhundert, überliefert in Handschriften des 10. - 17. Jahrhunderts.
Lateinisch: Entstehungszeit fraglich, erste lateinische Handschriften stammen aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Quelle: Handschriften der ersten griechischen Redaktion. Neben Übersetzungen einzelner Handschriften gibt es auch Vermischungen verschiedener Fassungen.
Verbreitetste Fassung: Dicta Johannis Chrysostomi de naturis bestiarum, wird als "Dicta-Version" bezeichnet. Davon existieren über 30 Handschriften vom 12. - 15. Jahrhundert, jedoch kein Druck. Entstehung: vermutlich im 11. Jahrhundert.
Versfassungen: Physiologus Theobaldi, älteste Handschrift aus dem 11. Jh., gelangt als einzige Physiologus-Fassung auch in den Druck. Große Bedeutung als Schulbuch im Mittelalter.
Viele bisher wenig beachtete Bearbeitungen, Begleitverse etc.
Deutsch: Übersetzungen sind nur aus dem 11. und 12. (Dicta-Version) sowie aus dem 15. Jahrhundert (Physiologus Theobaldi) überliefert.
Der althochdeutsche Physiologus:
Der althochdeutsche Physiologus ist die älteste Bearbeitung der Dicta-Version (Dicta Johannis Chrysostomi de naturis bestiarum).
Die Übersetzung ist eine freie, stark kürzende und vereinfachende Bearbeitung aus dem 11. Jahrhundert, und zwar aus dem alemannischen Sprachgebiet (Kennzeichen für das Alemannische: Assimilation von hs > ss, z. B. wasset; Assimilation von w > g, z. B. uzspiget).
Er zeigt bereits eine feste Syntax, z. B. die Endstellung des Verbs im Nebensatz.
Die Temporalformen werden anders verwendet als im Neuhochdeutschen, beispielsweise hat das Präteritum auch die Funktion des Plusquamperfekts und dient zur Darstellung der Vorzeitigkeit. (z. B. "sí daz obiz azzin. daz in got uerbôt." = Sie aßen das Obst, das ihnen Gott verboten hatte.)
Dasselbe gilt für das Präsens, welches auch zukünftige Handlungen darstellt. Die Funktionsbereiche der Tempora sind im Althochdeutschen größer als heute; es gibt kein Perfekt, Plusquamperfekt und Futur II.
Aus dem älteren Physiologus: Der Elefant
<DE ELEPHANTE> Só hêizzit ein tîer eleuas. daz ist ein hélfant. ter hebit mihela uerstannussida án ímo únde nehebit neheina lihhamhaftiga geruna. Tenne soser chînt hábin uuile, só uérit er mít sinemo uuîbe zé demo paradyse. dar dîu mandragora uuâsset. dáz ist chíndelina uúrz. so izzit dér helfant tîe uúrz unde sin uuîb. Vnde so sîu after dîu gehîen so phaet sîu. Tene so sîu berin sol gât siu in eina grûba. uôlla uuâzzeres. unde birit dar durih den drâchen. dér iro uáret. Ter helfant únde sîn uuîb bezeichenent adam unde euun. tîdir dirnun uuarin er sí daz obiz azzin. daz in got uerbôt. unde frémede uuâren uón allen unrehlihon gérunon. Unde dâr so sîu dáz âzzin. só uúrdin sîo uértribin án dáz êllende. tes kagaenuuartigen lîbes. Tîu grûba uólliu uuazzeres bezeichenet dáz ér chât. Saluum me fac, deus.
Lexikon:
hebit: Inf. = haben, haban, (haben) after: nachdem, danach
mihela: gro ß gehîen: vereinigen
uerstannussida: Verstand phaet: Inf. = phaen > fahan (empfangen)
nehebit neheina: hat keine (doppelte Negation!) berin: Inf. = beran (geb ä ren)
lihhamhaftiga leibliche, fleischliche uáret: Inf. = faren (nachstellen, auflauern)
geruna: Begierde dirnun: Jungfrauen
soser: sobald er (Synaloephe: sos - er) unrehlihon: unrechtlichen, b ö sen
uuile: Inf: wellen (wollen) êllende: Fremde, Verbannung
mandragora: Alraune (betäubende Pflanze) kagaenuuartigen: gegenw ä rtigen
chíndelina: kinderbringende (Pflanze) chât: chwedan > quedan (sagen)
Übersetzung:
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Physiologus?
Der Physiologus ist eine frühchristliche Bearbeitung einer Naturlehre in griechischer Sprache. Er beschreibt Pflanzen, Steine und Tiere und deutet sie allegorisch auf das Heilsgeschehen hin.
Woher stammen die Inhalte des Physiologus?
Die Aussagen des Physiologus stammen größtenteils aus antiker Naturlehre und ägyptischem Götterglauben und lassen sich aus zahlreichen Stellen der einschlägigen antiken Literatur belegen (Aristoteles, Plinius dem Älteren, Plutarch, Aelian).
Wann und wo ist der Physiologus entstanden?
Der Physiologus ist wahrscheinlich im Nahen Osten, in Ägypten, um 200 nach Christus entstanden.
In welchen Sprachen ist der Physiologus überliefert?
Der Physiologus ist in zahlreichen Sprachen überliefert, darunter Griechisch, Äthiopisch, Syrisch, Armenisch, Koptisch, Arabisch, Georgisch, Rumänisch, Russisch, Bulgarisch, Serbisch, Tschechisch, Lateinisch sowie in romanisch-germanischen Volkssprachen wie Angelsächsisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Flämisch, Isländisch, Französisch, Provenzalisch, Spanisch und Italienisch.
Wie wurde der Physiologus im Mittelalter verwendet?
Der Physiologus wurde im Mittelalter als Lehrbuch im naturgeschichtlichen Unterricht und als Erbauungsbuch gelesen.
Welche lateinischen Fassungen des Physiologus gibt es?
Es gibt mehrere lateinische Fassungen, wobei die verbreitetste Fassung Dicta Johannis Chrysostomi de naturis bestiarum ist, auch als "Dicta-Version" bezeichnet. Zudem gibt es Versfassungen wie den Physiologus Theobaldi.
Was ist der althochdeutsche Physiologus?
Der althochdeutsche Physiologus ist die älteste Bearbeitung der Dicta-Version (Dicta Johannis Chrysostomi de naturis bestiarum). Es handelt sich um eine freie, stark kürzende und vereinfachende Bearbeitung aus dem 11. Jahrhundert aus dem alemannischen Sprachgebiet.
Welche sprachlichen Besonderheiten weist der althochdeutsche Physiologus auf?
Der althochdeutsche Physiologus zeigt eine feste Syntax, wie z. B. die Endstellung des Verbs im Nebensatz. Die Temporalformen werden anders verwendet als im Neuhochdeutschen, beispielsweise hat das Präteritum auch die Funktion des Plusquamperfekts.
Was ist die Geschichte vom Elefanten im Physiologus?
Die Geschichte vom Elefanten im Physiologus schildert, wie Elefanten sich fortpflanzen und vergleicht diese mit Adam und Eva vor und nach dem Sündenfall.
Was bedeuten die im Lexikon des Elefanten-Textes genannten Wörter?
Das Lexikon erläutert die Bedeutung althochdeutscher Wörter wie "hebit" (haben), "mihela" (groß), "uerstannussida" (Verstand), "nehebit neheina" (hat keine), "lihhamhaftiga" (leibliche, fleischliche), "geruna" (Begierde) und weitere, die im Text über den Elefanten vorkommen.
- Citation du texte
- Sandra Kainzbauer (Auteur), 1998, Der althochdeutsche Physiologus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/94787