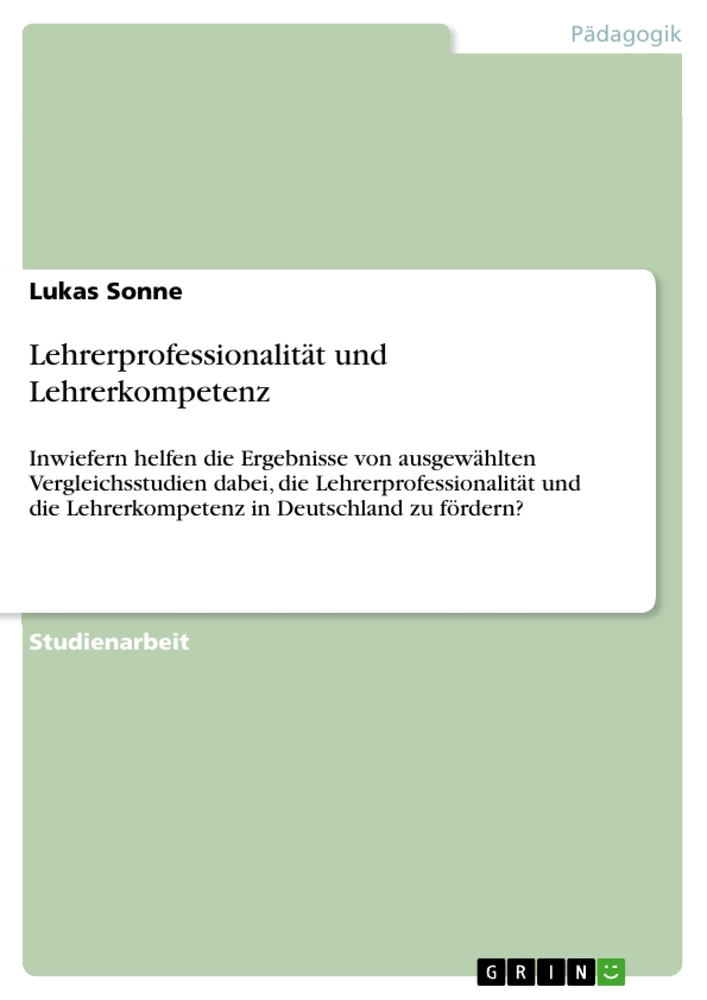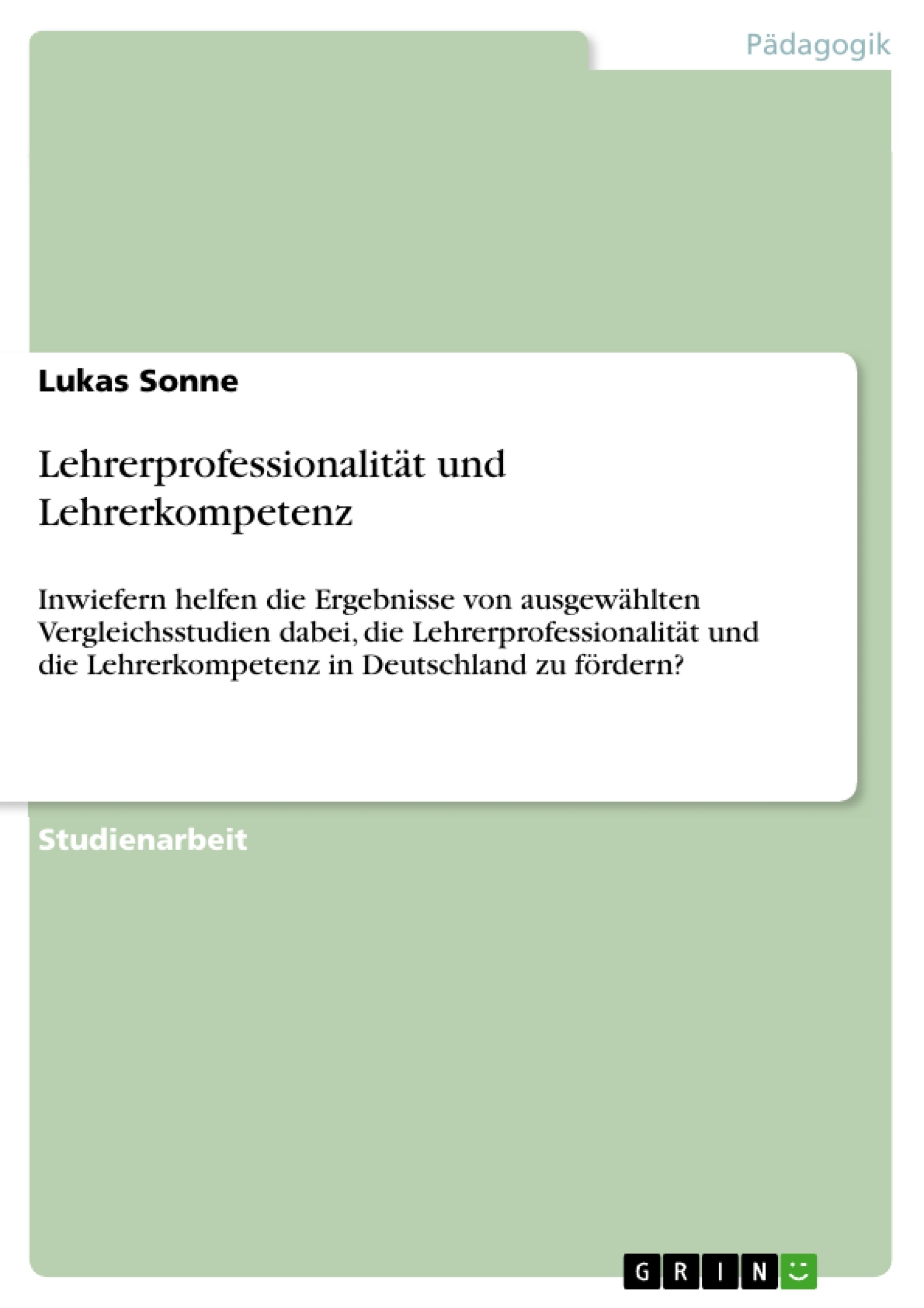In der folgenden Hausarbeit wird auf die Thematik der Lehrerprofessionalität und der Lehrerkompetenz eingegangen. Die empirische Forschung auf diesem Gebiet soll vorgestellt und ein Einblick in das umfangreiche Thema gegeben werden. Folgende Fragestellung soll hierbei beantwortet werden: „Inwiefern helfen die Ergebnisse von ausgewählten Vergleichsstudien dabei, die Lehrerprofessionalität und die Lehrerkompetenzen in Deutschland zu fördern?“
Um den Forschungsansätzen der Bildungswissenschaftler angemessen folgen zu können, wird zunächst der Begriff der Professionalität beleuchtet, die Komponenten professioneller Handlungskompetenz aufgezeigt und das Professionswissen von Lehrkräften modellartig veranschaulicht. Im darauffolgenden Kapiteln werden dann zwei große Studien zur Lehrerprofession und den Lehrerkompetenzen vorgestellt. Zum einen wird die „COACTIV“-Studie vorgestellt und zum anderen die Studie „TEDS-M“4. Es wird erklärt, auf was die jeweiligen Studien abzielen und wie diese methodisch durchgeführt wurden. Da diese Studien sehr umfangreich aufgearbeitet wurden und ihre Inhalte ganze Bücher füllen, können sie in dieser Hausarbeit nicht in ihrer ganzen Vielfalt dargelegt werden. Vielmehr sollen die methodischen Grundlagen vorgestellt und der Sinn und Zweck der Studien verdeutlicht werden. Somit werden dann im Anschluss die zentralen Ergebnisse der beiden Studien festgehalten. Abschließend wird im Fazit auf die Leitfrage eingegangen und festgestellt werden, inwieweit die Ergebnisse von COACTIV und TEDS-M dazu beitragen, die Lehrerprofessionalität zu fördern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Begriffe Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz
- Empirische Studien: COACTIV und TEDS-M
- Die COACTIV-Studie
- Die TEDS-M-Studie
- Zentrale Ergebnisse von COACTIV und TEDS-M
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beleuchtet die Thematik der Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz, wobei der Fokus auf den Erkenntnissen ausgewählter Vergleichsstudien liegt. Die zentrale Fragestellung lautet: „Inwiefern helfen die Ergebnisse von ausgewählten Vergleichsstudien dabei, die Lehrerprofessionalität und die Lehrerkompetenzen in Deutschland zu fördern?". Die Arbeit bietet einen Überblick über die empirische Forschung in diesem Bereich und untersucht, wie die Ergebnisse von COACTIV und TEDS-M zur Förderung der Lehrerprofessionalität beitragen können.
- Definition und Bedeutung von Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz
- Vorstellung der Vergleichsstudien COACTIV und TEDS-M, einschließlich ihrer methodischen Ansätze
- Analyse der zentralen Ergebnisse von COACTIV und TEDS-M im Hinblick auf ihre Relevanz für die Lehrerprofessionalität
- Diskussion der möglichen Auswirkungen der Studienergebnisse auf die Förderung der Lehrerprofessionalität in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz ein und stellt die zentrale Fragestellung der Hausarbeit vor. Sie verdeutlicht die Bedeutung des Themas im Kontext der aktuellen Bildungsdiskussion und erklärt den Fokus der Arbeit auf die Ergebnisse von Vergleichsstudien.
- Die Begriffe der Lehrerprofessionalität und der Lehrerkompetenz: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Definitionen und Konzepte von Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz. Es werden verschiedene Ansätze und Modelle vorgestellt, die unterschiedliche Aspekte professionellen Lehrerhandelns beleuchten. Dabei wird auch auf die Bedeutung von Fachwissen, fachdidaktischem Wissen und pädagogischem Wissen eingegangen.
- Empirische Studien: COACTIV und TEDS-M: Dieses Kapitel präsentiert die beiden Vergleichsstudien COACTIV und TEDS-M, die sich mit der Untersuchung von Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz befassen. Es werden die Forschungsziele, die methodischen Ansätze und die zentralen Fragestellungen der beiden Studien erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Lehrerprofessionalität, Lehrerkompetenz, Vergleichsstudien, COACTIV, TEDS-M, Fachwissen, fachdidaktisches Wissen, pädagogisches Wissen, Lehrerbildung, Bildungsqualität, Schulentwicklung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Lehrerprofessionalität?
Lehrerprofessionalität umfasst die Kombination aus Fachwissen, fachdidaktischem Wissen und pädagogischem Wissen, die für kompetentes Handeln im Unterricht notwendig ist.
Was untersuchte die COACTIV-Studie?
Die COACTIV-Studie analysierte die professionelle Kompetenz von Lehrkräften und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg der Schüler.
Welches Ziel verfolgte die TEDS-M-Studie?
TEDS-M ist eine internationale Vergleichsstudie, die die Wirksamkeit der Lehrerausbildung im Bereich Mathematik in verschiedenen Ländern untersucht hat.
Wie helfen Vergleichsstudien bei der Förderung der Lehrerkompetenz?
Die Ergebnisse liefern empirische Belege dafür, welche Wissensbereiche besonders gestärkt werden müssen, um die Qualität der Lehrerbildung in Deutschland zu verbessern.
Welche Rolle spielt fachdidaktisches Wissen?
Studien zeigen, dass reines Fachwissen nicht ausreicht; erst das fachdidaktische Wissen ermöglicht es Lehrkräften, komplexe Inhalte schülergerecht aufzubereiten.
- Quote paper
- Lukas Sonne (Author), 2018, Lehrerprofessionalität und Lehrerkompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950042