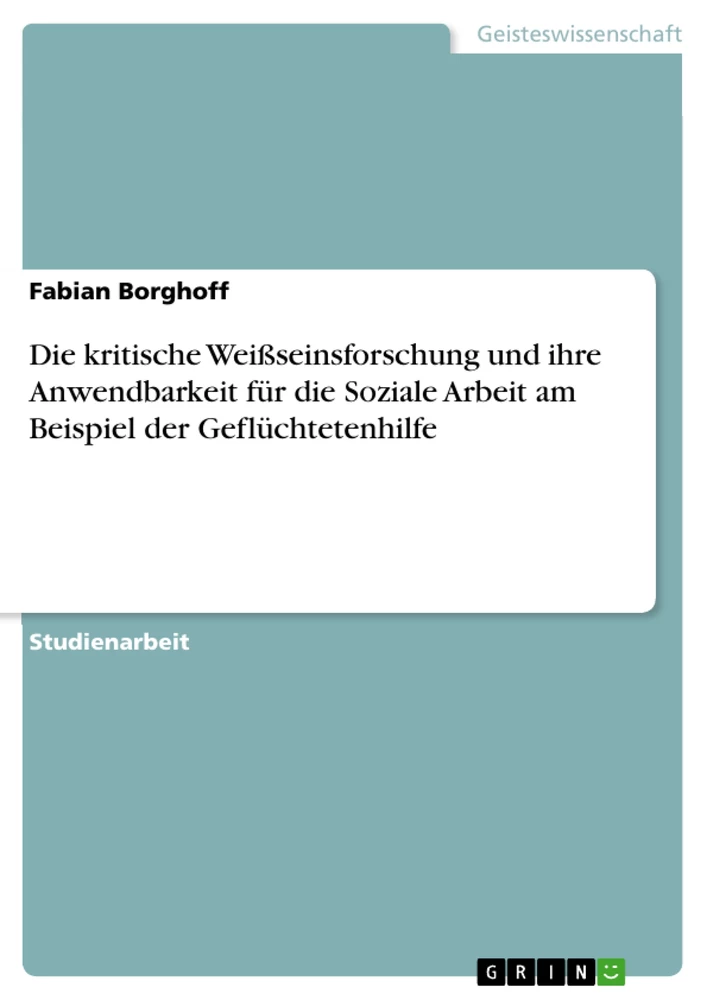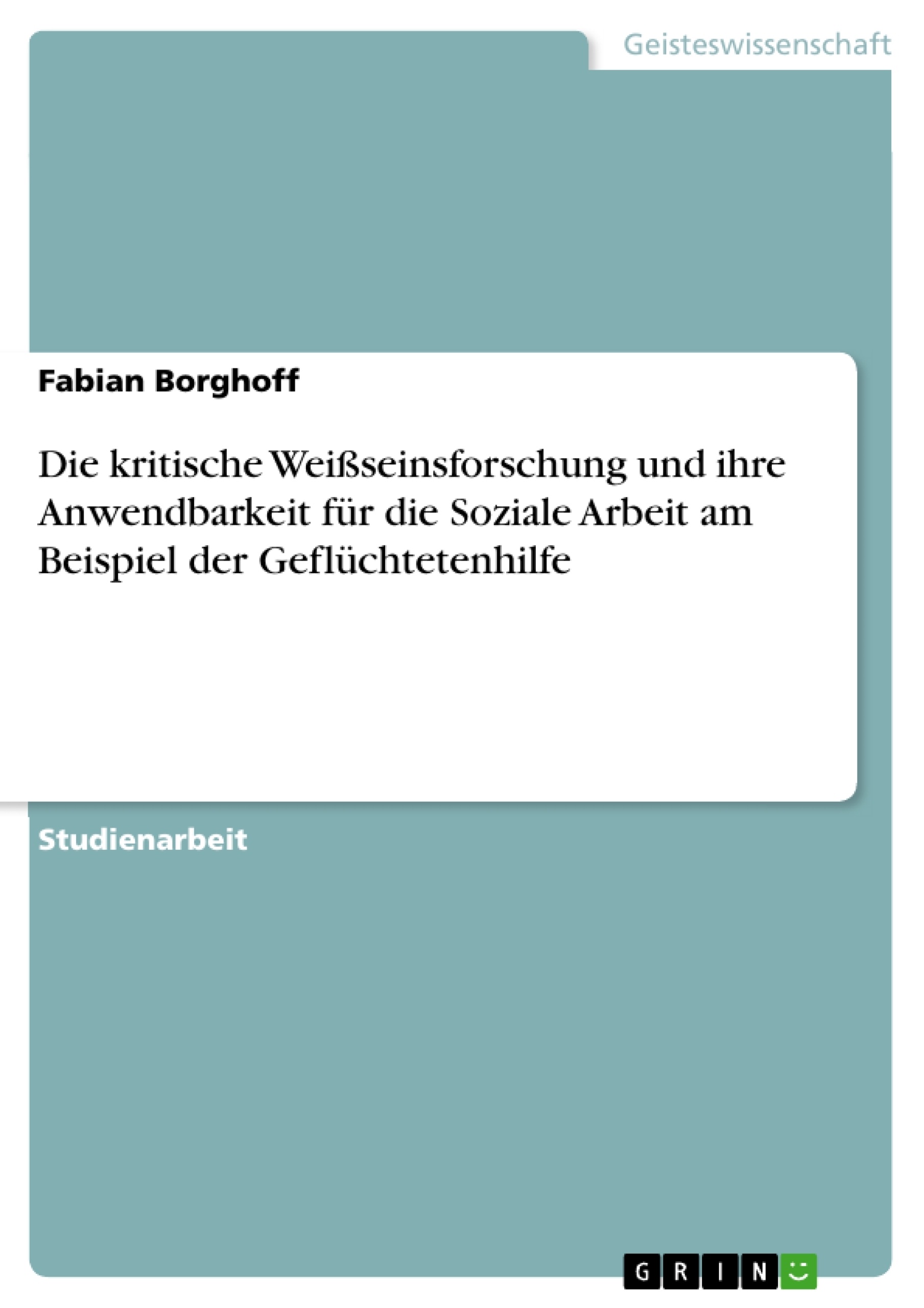Führte der Ansatz des kritischen Weißseins in antirassistischen und feministischen Bewegungen bereits zu angeregten Diskussionen, Selbstreflexionen von einzelnen Akteur*innen in ihren sozialen Gruppen, ist er in der Sozialen Arbeit bisher eher marginal, zumeist in ihren Bezugsdisziplinen, präsent. Um diesem Defizit zu begegnen, setzt sich die vorliegende Arbeit thematischen mit der theoretischen Anwendbarkeit der kritischen Weißseinsforschung für die Soziale Arbeit auseinander.
Hierzu soll zunächst die kritische Weißseinsforschung erläutert, ihre Kerninhalte dargelegt sowie ihre Entwicklungsgeschichte beschrieben werden. Konsequenterweise muss sie hierbei von ihren angloamerikanischen Wurzeln abgegrenzt und im deutschsprachigen Raum verortet werden. Dem folgt das zweite Kapitel, in welchem die Soziale Arbeit selektiv, am Beispiel der
Geflüchtetenhilfe auf ihre Anknüpfungspunkte für das kritische Weißsein als Analyseinstrument überprüft wird. Obgleich einer eigenständigen Analyse der Raum fehlt, kann somit doch die Legitimität der Frage ihrer Anwendbarkeit gestellt und im anschließenden Kapitel auf ihre Möglichkeiten und Grenzen kritisch überprüft und abschließend diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die kritische Weißseinsforschung
- Begriffsbestimmung
- Einordnung der kritischen Weißseinsforschung in die (kritische) Rassismusforschung
- Entstehungsgeschichte
- Besonderheiten im deutschsprachigen Raum
- Zentrale Aspekte
- Soziale Arbeit im Bereich der Geflüchtetenhilfe
- Begriffsbestimmung
- Adressat*innen
- Aufgaben
- Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes der kritischen Weißseinsforschung für die Soziale Arbeit mit Geflüchteten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Anwendbarkeit der kritischen Weißseinsforschung in der Sozialen Arbeit, insbesondere im Kontext der Geflüchtetenhilfe. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen der kritischen Weißseinsforschung, analysiert deren Relevanz für die Soziale Arbeit und diskutiert die Potenziale und Grenzen dieses Ansatzes.
- Definition und Einordnung der kritischen Weißseinsforschung
- Analyse der Funktionsweise von Weißsein als hegemoniales System
- Bedeutung der kritischen Weißseinsforschung für die (kritische) Rassismusforschung
- Anknüpfungspunkte und Anwendungsmöglichkeiten der kritischen Weißseinsforschung in der Sozialen Arbeit
- Möglichkeiten und Grenzen des kritischen Weißseinsansatzes in der Geflüchtetenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik der kritischen Weißseinsforschung ein und verdeutlicht die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit. Sie stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit dar.
Das erste Kapitel beleuchtet die kritische Weißseinsforschung. Es werden verschiedene Definitionen und Perspektiven auf den Begriff "Weißsein" vorgestellt, die Funktionsweise von Weißsein als hegemoniales System erläutert und die Einordnung der kritischen Weißseinsforschung in die (kritische) Rassismusforschung diskutiert.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Soziale Arbeit im Bereich der Geflüchtetenhilfe. Es werden die Adressat*innen und Aufgaben der Sozialen Arbeit in diesem Kontext beschrieben und die potenziellen Anknüpfungspunkte für den Einsatz der kritischen Weißseinsforschung als Analyseinstrument beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern der kritischen Weißseinsforschung, der (kritischen) Rassismusforschung, der Sozialen Arbeit, der Geflüchtetenhilfe und der Intersektionalität. Im Fokus stehen die Auseinandersetzung mit hegemonialen Machtstrukturen, die Dekonstruktion von Rassismus und die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins in der Sozialen Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist kritische Weißseinsforschung?
Ein Forschungsansatz, der Weißsein nicht als Norm, sondern als hegemoniales Machtsystem analysiert, das Privilegien und rassistische Strukturen schafft.
Warum ist dieser Ansatz für die Soziale Arbeit relevant?
Er hilft Sozialarbeiter*innen, eigene Privilegien und unbewusste rassistische Denkmuster in der Arbeit mit Adressat*innen (z.B. Geflüchteten) zu reflektieren.
Was sind die Besonderheiten der Weißseinsforschung in Deutschland?
Im Gegensatz zu den USA muss sie im Kontext der spezifisch deutschen Geschichte und der hiesigen Formen von Alltagsrassismus verortet werden.
Wie wird Weißsein als „hegemoniales System“ verstanden?
Es beschreibt eine gesellschaftliche Ordnung, in der weiße Menschen strukturell begünstigt werden, oft ohne dass ihnen diese Privilegierung bewusst ist.
Wo liegen die Grenzen dieses Ansatzes in der Geflüchtetenhilfe?
Grenzen liegen oft in der rein theoretischen Auseinandersetzung ohne praktische Handlungskonsequenzen oder in der Abwehrhaltung der privilegierten Akteur*innen.
- Citar trabajo
- Fabian Borghoff (Autor), 2017, Die kritische Weißseinsforschung und ihre Anwendbarkeit für die Soziale Arbeit am Beispiel der Geflüchtetenhilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950100