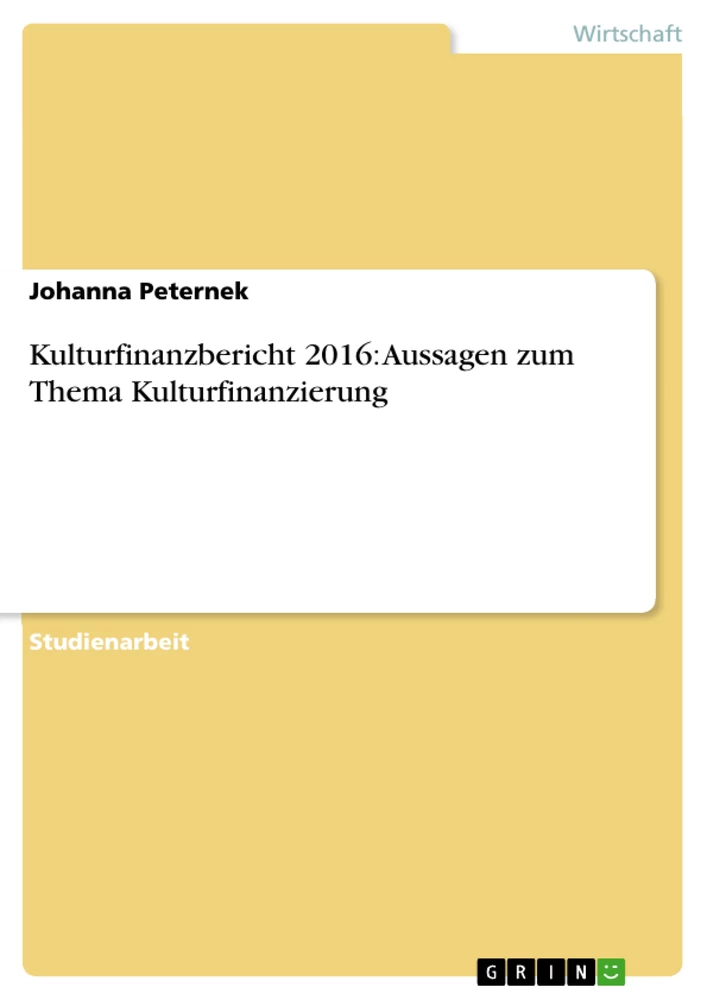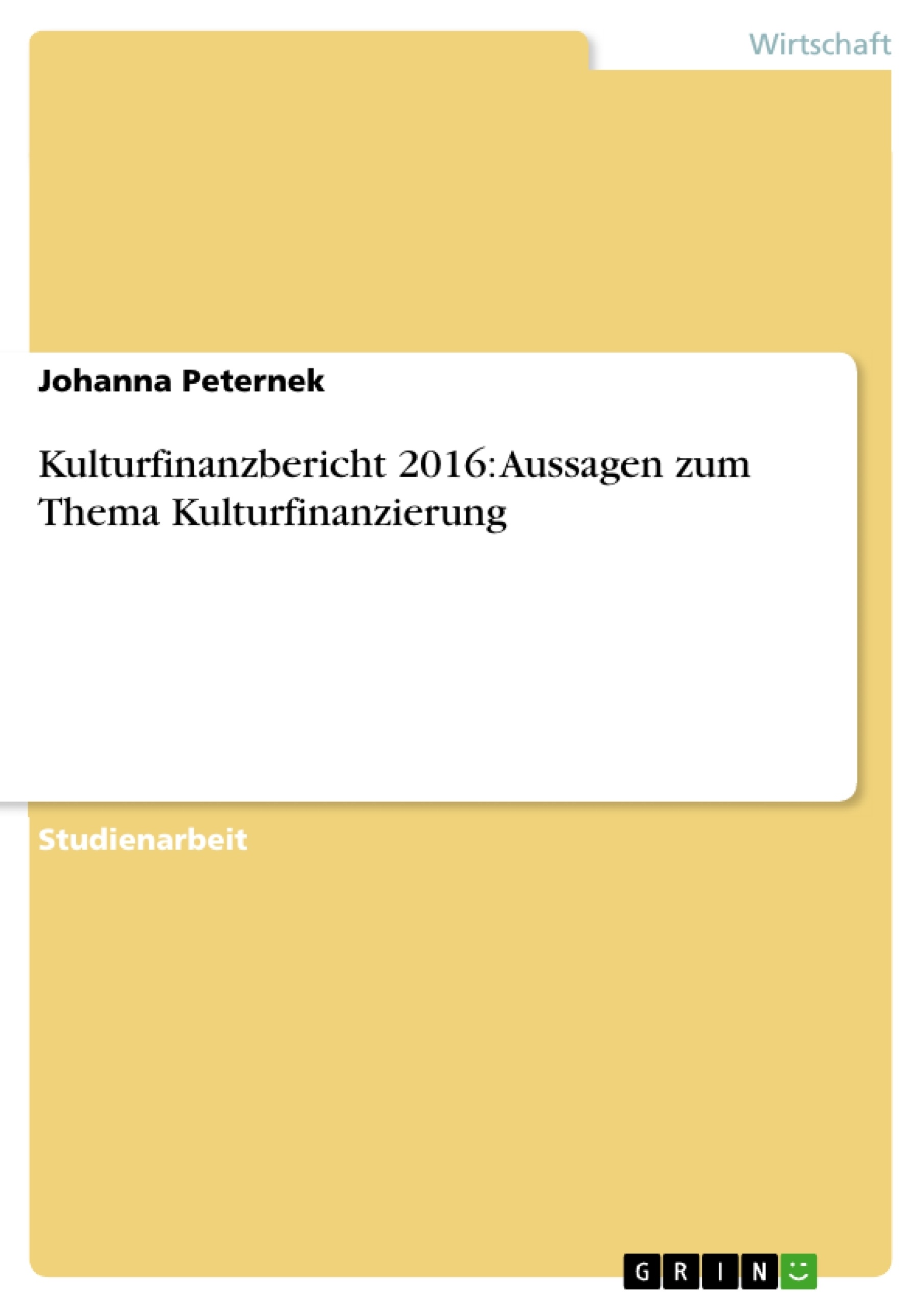"Kultur beginnt im Herzen jedes einzelnen." (Johann Nepomuk Nestroy)
Goethe, Schiller, Bach und Beethoven: Die deutsche Kulturgeschichte hat seit vielen Jahrhunderten bedeutende Namen und berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht. Im Dezember 2016 wurde die deutsche Theater- und Orchesterlandschaft sogar für die UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes nominiert. Ihren Ursprung hat diese Vielfalt in den zahlreichen deutschen Kleinstaaten des 17. und 18. Jahrhunderts, denn in anderen Ländern konzentrierte sich das kulturelle Leben in einer zentralen Hauptstadt.
Dabei ist Kultur in Deutschland traditionell ein symbolisch hoch aufgeladener Begriff, der sich über die Jahrhunderte hinweg veränderte. Die "Kulturnation" ging einst der "Staatsnation" voraus und oft wurde Kultur zur Sphäre des Politischen in ein distanziertes Verhältnis gesetzt: beispielsweise gegen autokratische Fürsten oder gegen die Parlamentspolitik. Willy Brandts Aufruf „Mehr Demokratie wagen!“ und Hilmar Hoffmanns Postulat „Kultur für alle“ waren in den 1970er Jahren Anstoß für eine wohlfahrtsstaatliche Erweiterung des deutschen Kulturgedankens: Kunst und Kultur sollte durch die Ergänzung einer sozialen Ebene die „Herzen jedes einzelnen“ (angelehnt an Nestroys Formulierung) ergreifen und den Alltag der Bürgerinnen und Bürger mit gestalten.
Mit einem erweiterten Kulturbegriff vergrößerte sich schließlich auch die Finanzierungsverantwortung der öffentlichen Hand, die historisch bedingt fest im Bewusstsein der Politik verankert ist. Überblick über die öffentlichen Kulturausgaben gibt seit über zehn Jahren der sog. Kulturfinanzbericht, der gemeinsam von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder herausgegeben wird. Die Verfasser sehen darin ein „Bekenntnis zum besonderen Stellenwert der Kultur in unserer Gesellschaft“.
Ist die Kultur in Deutschland also zu einer realen, mit der Politik versöhnten Gestaltungsgröße geworden? Inwiefern finden sich die Dimensionen des weit gefassten Kulturbegriffs in der Ausgabenstruktur der öffentlichen Kulturfinanzierung wieder? Dieser Frage wird anhand der veröffentlichten Zahlen im Kulturfinanzbericht 2016 mit vorliegender Arbeit nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Deutsche Kulturpolitik im Zeichen eines weiten Kulturbegriffs
- Historischer Hintergrund: Deutschland als „Kulturnation“
- Identität, Macht und Geltung durch Kulturbegriffe
- Kultur als Teil des Demokratisierungsprozesses
- Aussagen zur Kulturfinanzierung laut Kulturfinanzbericht 2016
- Wer finanziert?
- Was wird finanziert?
- Wo wird finanziert?
- Auswertung der Aussagen des Kulturfinanzberichts 2016
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung des deutschen Kulturbegriffs und der daraus resultierenden Ausgestaltung der Kulturpolitik. Sie untersucht, inwieweit sich die Dimensionen eines weit gefassten Kulturverständnisses in der Ausgabenstruktur der öffentlichen Kulturfinanzierung widerspiegeln. Besonderes Augenmerk liegt auf den Aussagen des Kulturfinanzberichts 2016.
- Der Wandel des deutschen Kulturbegriffs von der „Kulturnation“ zur „sozialen Kultur“
- Die Rolle der öffentlichen Hand in der Kulturfinanzierung
- Die Bedeutung des Kulturfinanzberichts 2016 für die Analyse der aktuellen Kulturpolitik
- Die Finanzierung von Kulturinstitutionen und -projekten durch Bund, Länder und Kommunen
- Die Relevanz von Kunst und Kultur für die Gesellschaft und ihre Förderung im Kontext der Wohlfahrtsstaatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den deutschen Kulturbegriff und seine Entwicklung im historischen Kontext vor. Sie zeigt auf, wie der Kulturbegriff im Laufe der Zeit erweitert wurde und welche Bedeutung er für die deutsche Politik und Gesellschaft hat.
Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Hintergrund der deutschen „Kulturnation“ und zeichnet den Wandel des Kulturbegriffs im Kontext von Identität, Macht und Geltung nach. Hierbei werden die Rolle des Bildungsbürgertums, die Verknüpfung von Kultur und Nation sowie die Entwicklung des Kulturbegriffs im Demokratisierungsprozess thematisiert.
Kapitel 3 untersucht die Aussagen des Kulturfinanzberichts 2016 hinsichtlich der Kulturfinanzierung. Es analysiert, wer die Kultur finanziert, was finanziert wird und wo die Gelder eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
Kulturpolitik, Kulturfinanzierung, Kulturbegriff, Kulturnation, Kulturfinanzbericht, öffentliche Kulturfinanzierung, deutsche Kulturgeschichte, Soziokultur, Kulturförderung, Kulturlandschaft, Kunst, Literatur, Theater, Orchester, Museen, Bildungsbürgertum, Demokratisierungsprozess, Bundeshaushalt, Landeshaushalt, Kommunalhaushalt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kulturfinanzbericht?
Ein gemeinsamer Bericht der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der einen detaillierten Überblick über die öffentlichen Kulturausgaben in Deutschland gibt.
Wer finanziert die Kultur in Deutschland hauptsächlich?
Die Kulturfinanzierung liegt in der Verantwortung der öffentlichen Hand, aufgeteilt auf Bund, Länder und insbesondere die Kommunen.
Was bedeutet der Begriff „Kulturnation“ im deutschen Kontext?
Der Begriff beschreibt die historische Entwicklung Deutschlands, in der eine gemeinsame kulturelle Identität der Gründung eines gemeinsamen Nationalstaates vorausging.
Welche kulturellen Bereiche werden öffentlich gefördert?
Gefördert werden unter anderem Theater, Orchester, Museen, Bibliotheken sowie die Denkmalpflege und die Soziokultur.
Wie hat sich der Kulturbegriff seit den 1970er Jahren verändert?
Durch Impulse wie „Kultur für alle“ wurde der Kulturbegriff um eine soziale und wohlfahrtsstaatliche Ebene erweitert, was auch die Finanzierungsverantwortung vergrößerte.
- Citation du texte
- Johanna Peternek (Auteur), 2018, Kulturfinanzbericht 2016: Aussagen zum Thema Kulturfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950383