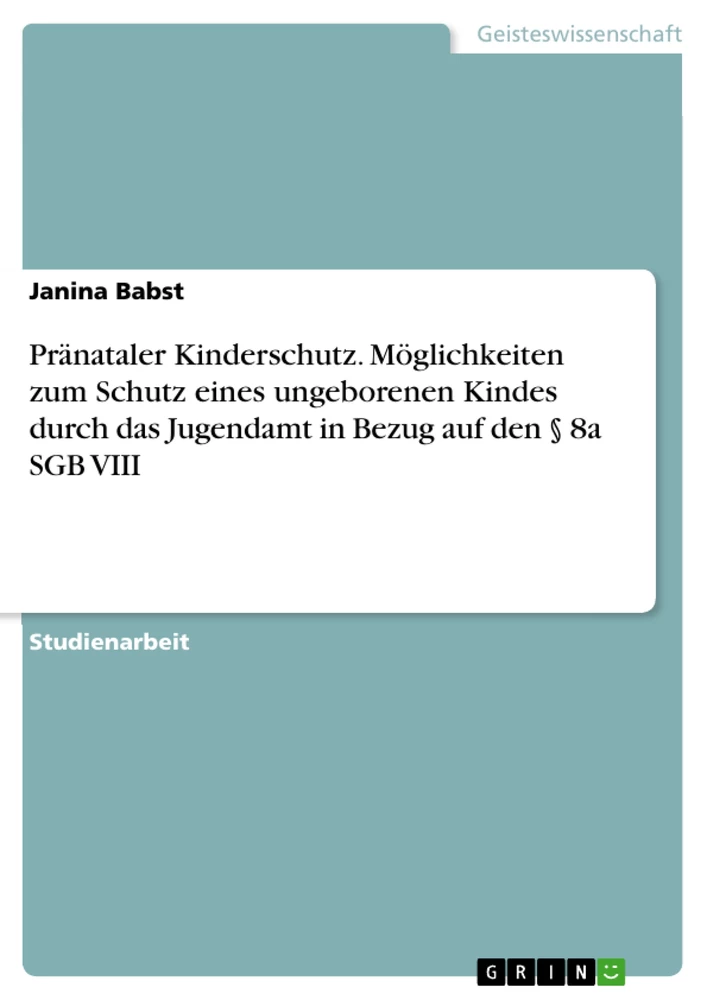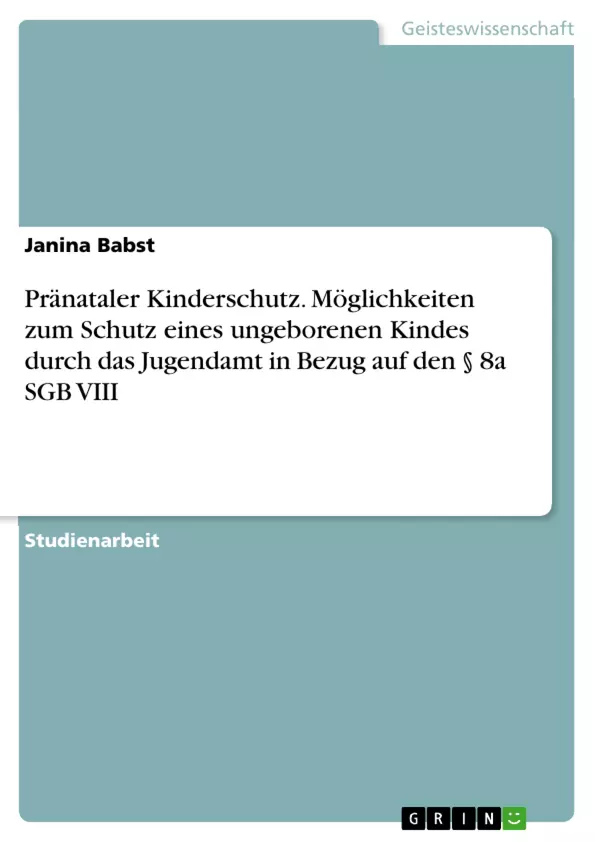In der Arbeit soll die Fragestellung bearbeitet werden, inwiefern auf den pränatalen Kinderschutz geachtet wird und welche Möglichkeiten dem Jugendamt bei einer pränatalen Gefährdung zur Verfügung stehen.
Um dieses Thema zu erarbeiten, wird der Autor deduktiv vorgehen. Es wird anhand einer Literaturrecherche der Verlauf des standardisierten Verfahrens nach § 8a SGB VIII auf den Einzelfall der Gefährdung bei einem ungeborenen Kind angewendet. Zunächst wird hierfür das standardisierte Verfahren einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII erläutert. Hierbei wird zuerst auf die gewichtigen Anhaltspunkte bei einer Kindeswohlgefährdung eingegangen, um sich dann der Beratung mit mehreren Fachkräften zu widmen. Im Anschluss geht der Autor auf mögliche Hilfsmöglichkeiten seitens des Jugendamtes ein, um sich am Ende auf das Gerichtsverfahren und eine mögliche Inobhutnahme zu konzentrieren.
Bei der Anwendung des Gefährdungsprozesses auf den Einzelfall des ungeborenen Kindes wird zunächst auf die Rechtsbestimmungen in der Sozialgesetzgebung sowie im Zivilrecht eingegangen. Hiernach werden die Möglichkeiten der Leistungen für Schwangere nach dem achten Sozialgesetzbuch erläutert und in diesem Zuge auf die „Frühen Hilfen“ eingegangen. Zum Ende setzt sich der Autor mit den gerichtlichen Gegebenheiten auseinander und wird hierbei insbesondere auf den § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eingehen.
„Pränataler Kinderschutz“ ist wiederkehrend und seit mehreren Jahren ein Thema, welches in der Politik und in der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert wird. Dennoch finden Schwangere und ungeborene Kinder nur begrenzt im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Erwähnung. Auch sind nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Abwendung einer Gefährdung eines ungeborenen Kindes vorhanden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der staatliche Schutzauftrag bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII
- 2.1 Gewichtige Anhaltspunkte nach § 8a Abs. 1 SGB VIII
- 2.2 Gefährdungseinschätzung mit mehreren Fachkräften nach § 8a Abs.1 SGB VIII
- 2.3 Möglichkeiten Vermittlung von Hilfen nach § 8a Abs. 1 SGB VIII
- 2.4 Anrufung des Familiengerichts nach § 8a SGB Abs. 2 VIII in Bezug auf den § 1666 BGB
- 2.5 Inobhutnahme gemäß § 42 SGB VIII
- 3. Prüfung des § 8a SGB VIII bei einer pränatalen Gefährdung
- 3.1 Rechtsbestimmungen in der Sozialgesetzgebung und im Zivilrecht
- 3.2 Gefährdungen für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder
- 3.3 Vermittlung von Hilfen an Schwangere nach dem achten Sozialgesetzbuch
- 3.4 Berücksichtigung eines ungeborenen Kindes in § 8a SGB VIII und bei familiengerichtlichen Verfahren
- 3.5 Frühe Hilfen
- 4. Fazit mit eigener Stellungnahme
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema des pränatalen Kinderschutzes und untersucht die Möglichkeiten des Jugendamtes, ein ungeborenes Kind im Hinblick auf § 8a SGB VIII zu schützen. Ziel ist es, die Anwendbarkeit des standardisierten Verfahrens nach § 8a SGB VIII auf den Einzelfall einer pränatalen Gefährdung zu analysieren und die vorhandenen Möglichkeiten des Jugendamtes in diesem Kontext aufzuzeigen.
- Standardisiertes Verfahren nach § 8a SGB VIII bei pränataler Kindeswohlgefährdung
- Anwendbarkeit von Rechtsbestimmungen in der Sozialgesetzgebung und im Zivilrecht
- Möglichkeiten der Hilfestellung für Schwangere
- Berücksichtigung ungeborener Kinder im § 8a SGB VIII und in gerichtlichen Verfahren
- Frühe Hilfen als präventive Maßnahme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des pränatalen Kinderschutzes ein und stellt die Fragestellung der Hausarbeit dar. Kapitel 2 erläutert den staatlichen Schutzauftrag bei einer Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII, wobei die gewichtigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung, die Gefährdungseinschätzung mit mehreren Fachkräften, die Möglichkeiten der Hilfestellung und das Verfahren zur Anrufung des Familiengerichts beschrieben werden. Kapitel 3 widmet sich der Prüfung des § 8a SGB VIII im Kontext einer pränatalen Gefährdung und untersucht die relevanten Rechtsbestimmungen, die Gefährdungen für Schwangere und ihre ungeborenen Kinder, die Hilfestellungsmöglichkeiten für Schwangere und die Berücksichtigung ungeborener Kinder in § 8a SGB VIII und in familiengerichtlichen Verfahren. Des Weiteren werden die "Frühen Hilfen" als präventive Maßnahme vorgestellt.
Schlüsselwörter
Pränataler Kinderschutz, § 8a SGB VIII, Kindeswohlgefährdung, Jugendamt, Gefährdungseinschätzung, Hilfestellung, Inobhutnahme, Rechtsbestimmungen, Schwangere, ungeborenes Kind, Familiengericht, Frühe Hilfen.
- Quote paper
- Janina Babst (Author), 2020, Pränataler Kinderschutz. Möglichkeiten zum Schutz eines ungeborenen Kindes durch das Jugendamt in Bezug auf den § 8a SGB VIII, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/950406