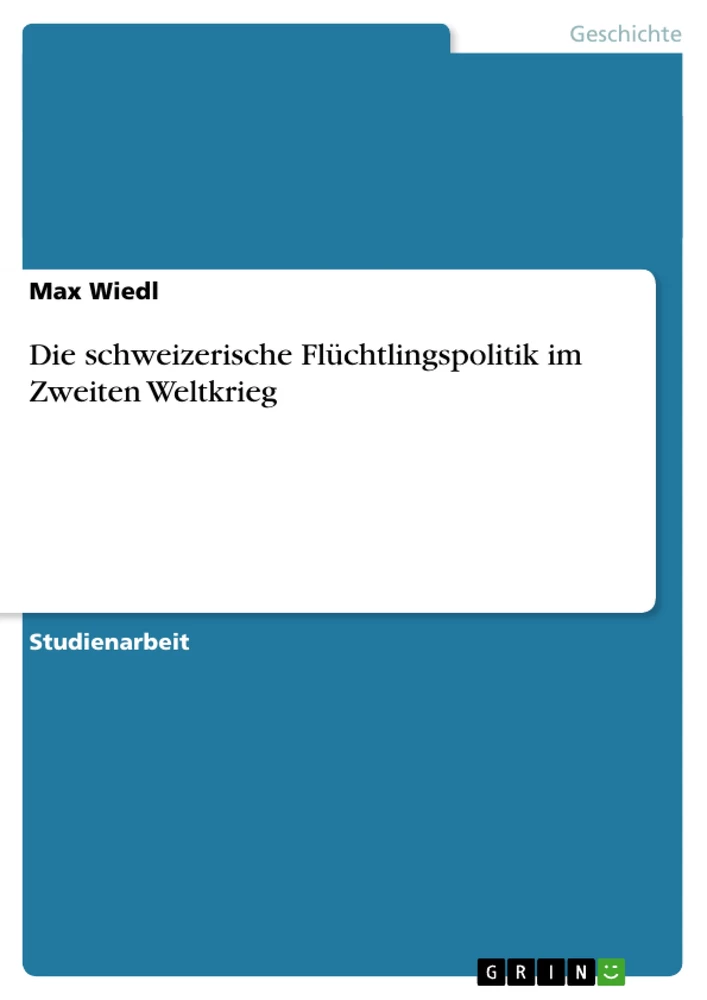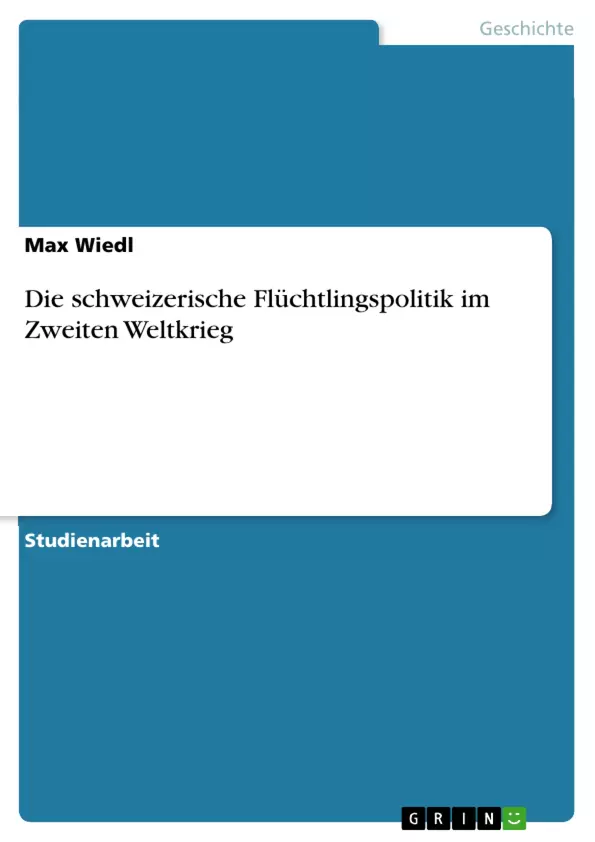Inmitten des tobenden Zweiten Weltkriegs, als Europa in Dunkelheit versank, präsentierte sich die Schweiz als ein Leuchtfeuer der Neutralität und humanitären Tradition. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich ein komplexes Dilemma: Wie konnte ein kleines Land seine Grenzen schützen und gleichzeitig den Verfolgten Schutz bieten? Diese tiefgründige Analyse enthüllt die Zerrissenheit der schweizerischen Flüchtlingspolitik jener Zeit, ein Balanceakt zwischen Mitgefühl und Abschreckung. Die Untersuchung beleuchtet, wie der grassierende Überfremdungsdiskurs und wirtschaftliche Ängste die Entscheidungen der Behörden beeinflussten, während gleichzeitig das Wissen um die Gräueltaten des Holocaust immer lauter wurde. Erfahren Sie, wie die Schweiz, hin- und hergerissen zwischen humanitären Idealen und nationalen Interessen, sich dazu entschied, ihre Grenzen für viele zu schliessen, während sie gleichzeitig Zehntausende rettete. Entdecken Sie die Rolle von Schlüsselpersonen, von Heinrich Rothmund, dem Chef der Polizeiabteilung, bis hin zu den unermüdlichen Verfechtern der Menschlichkeit in Kirchen und Hilfswerken, deren Bemühungen das Schlimmste verhinderten. Diese kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit wirft ein neues Licht auf die Frage der Verantwortung, der moralischen Komplexität und des bleibenden Erbes der Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg. Untersucht werden die gesetzlichen Grundlagen des Asylrechts, die behördlichen Weisungen und deren Umsetzung an den Grenzen, sowie die oft restriktive Praxis gegenüber jüdischen Flüchtlingen. Beleuchtet werden die Zahlen der Aufgenommenen und der Abgewiesenen, die Betreuung der Flüchtlinge in Lagern und Heimen, die Frage der Weiterreise und des Dauerasyls, sowie die Finanzierung durch Bund und Hilfswerke. Abschliessend wird die Aufarbeitung der Flüchtlingspolitik in der Nachkriegszeit und die anhaltende Bedeutung dieser historischen Ereignisse für die heutige Zeit analysiert. Eine bewegende und aufschlussreiche Lektüre über ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte, das bis heute nachwirkt und zur Reflexion über aktuelle Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik anregt.
Die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg
von Guido Koller
Zusammenfassung :
Für zahlreiche Juden war die für ihre humanitäre Tradition bekannte Schweiz ein Zufluchtsort im Herzen Europas. Die Behörden indessen sahen ihre Hauptaufgabe darin, den Schweizer Arbeitsmarkt zu schützen und sogenannte « wesensfremde Elemente » möglichst abzuwehren. Bis zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Krieges hielten sich die Behörden an den Grundsatz, die Schweiz sei kein Asyl- sondern nur ein Transitland. So wurden im Sommer 1942 die Grenzen geschlossen, obwohl die Behörden von der Todesgefahr der die Juden ausgesetzt waren durchaus Kenntnis hatten. Die Verfechter der humanitären Tradition erreichten indessen, dass Kinder, Familien mit Kleinkindern und ältere Menschen eine Einreisebewilligung erhielten. Die Schweiz nahm 65'000 Zivilflüchtlinge, 104'000 Militär- und 66'000 « Grenzflüchtlinge » auf. Die genaue Zahl der Zurückgewiesenen ist nicht bekannt. Indes ergaben historische Ermittlungen, dass nachweislich über 30'000 Asylsuchende weggewiesen wurden, darunter eine bedeutende Anzahl Juden und Jüdinnen.
Die systematische Verfolgung der jüdischen Bevölkerung und die Schweiz
Die Nationalsozialisten planten und verwirklichten die Auslöschung des europäischen Judentums in drei Phasen, die mit Entrechtung und Vertreibung in der Vorkriegszeit und Vernichtung in der Kriegszeit umschrieben werden. In allen drei Phasen versuchte die jüdische Bevölkerung, der systematischen Verfolgung durch Emigration oder Flucht zu entrinnen. Die neutrale Schweiz mit ihrer humanitären und asylpolitischen Tradition war als Nachbarland Deutschlands inmitten Europas ein wichtiges Fluchtziel.
Der Überfremdungsdiskurs und das Wissen um die Vernichtung der Juden
Die schweizerische Flüchtlingspolitik ist im Spannungsfeld zwischen dem Überfremdungsdiskurs und dem Wissen um die Verfolgung und Vernichtung der Juden anzusiedeln. Die Eidg. Fremdenpolizei sah im Gefolge der Weltwirtschaftskrise ihre Hauptaufgabe darin, den schweizerischen Arbeitsmarkt zu schützen und sogenannte "wesensfremde Elemente" abzuwehren. Die nazistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik vermochte diese Haltung nicht zu brechen. Die Schweiz sah sich gegenüber den Verfolgten nicht als Asyl-, sondern als Transitland und schloss bei Kriegsausbruch die Grenzen. Obschon sich im Sommer und Herbst 1942 die Informationen verdichteten, dass den Juden das Schlimmste widerfuhr, blieben die Grenzen für sie grundsätzlich geschlossen. Die Verfechter einer humanitären Tradition der Schweiz in Kirchen, Hilfswerken und Parteien erreichten indessen, dass Familien, Kinder, Alte und Kranke aufgenommen wurden.
Das Asylrecht und seine gesetzlichen Grundlagen
Völkerrechtlich bestanden nur wenige Ansätze, den Schutz von Verfolgten zu gewährleisten. Die Schweiz hatte 1937 zwar ein Völkerbunds-Abkommen unterzeichnet, das es verbot, politische Flüchtlinge nach Deutschland abzuschieben. Die Verpflichtung blieb aber wirkungslos, da die Schweiz zwischen 1933 und 1945 nur 644 Personen als politische Flüchtlinge anerkannte.
Ein ausformuliertes Asylgesetz kannte die Schweiz nicht. Zwar übertrug die Bundesverfassung die Asylgewährung dem Bundesrat. Das Asylrecht galt aber nicht als Rechtsanspruch eines Schutzsuchenden, sondern als Recht der Schweiz, einem Verfolgten auch gegen den Einwand eines anderen Staates Schutz zu gewähren. Es war demnach primär Bestandteil der neutralen Staatsmaxime.
Vor dem Krieg teilten sich Bund und Kantone die asylrechtlichen Kompetenzen. Die Kantone konnten gemäss Ausländergesetz von 1931 Emigranten vorläufige Aufenthaltsbewilligungen erteilen. Die Bundesbehörden gaben dabei die flüchtlingspolitischen Leitlinien vor. Entscheidend für die Abweisung jüdischer Flüchtlinge war die Unterscheidung zwischen Flüchtlingen aus "rassischen" respektive "wirtschaftlichen Gründen" und politischen Flüchtlingen. Für die Anerkennung letzterer war seit 1933 die Bundesanwaltschaft zuständig. Nach Kriegsbeginn wurden die Kompetenzen auf Bundesebene zentralisiert. Die gesetzliche Grundlage war der Bundesratsbeschluss (BRB) vom 17. Oktober 1939 zur Ausschaffung oder Internierung illegal eingereister Personen. Die Konkretisierung dieser gesetzlichen Vorgabe erfolgte fortan durch Weisungen des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements (EJPD). Die wichtigste Behörde in der Ausgestaltung der flüchtlingspolitischen Praxis war die Polizeiabteilung unter ihrem Chef Dr. Heinrich Rothmund.
Die behördlichen Weisungen
Zwischen 1933 und 1938 verhängten die Behörden keine Restriktionen gegen die Einreise von Juden und Gegnern des nationalsozialistischen Regimes, ermöglichten ihnen in der Regel jedoch nur einen vorläufigen Aufenthalt. Da im August 1938 die Weiterreise erschwert und die Rückkehr nach Deutschland und Österreich unmöglich geworden war, verhängte das EJPD eine Grenzsperre gegen jüdische Flüchtlinge aus Österreich und initiierte die Einführung des Juden-Stempels in deutschen Pässen. Der Bundesrat stimmte am 4. Oktober 1938 der Vereinbarung mit Deutschland zu, die die Einreise von Juden der Visumspflicht unterwarf. Am 5. September 1939 folgte die Einführung der generellen Visumspflicht. Restriktive Ausreisebestimmungen Deutschlands und die Visumspflicht für die Schweiz liessen die Einreisen gegenüber der Vorkriegszeit vorerst stark zurückgehen. Eine Ausnahme war die Fluchtbewegung beim Zusammenbruch der französischen Verteidigung im Frühsommer 1940. Die Polizeiabteilung reagierte in Absprache mit General Henri Guisan am 18. Juni 1940 mit der Anordnung an die Grenzorgane, Angehörige der Internationalen Brigaden und der französischen Détachements de travailleurs, in die zumeist politische und jüdische Flüchtlinge aus Deutschland rekrutiert wurden, zurückzuweisen, Frauen und Kinder aus der grenznahen Bevölkerung Frankreichs dagegen aufzunehmen.
Am 4. August 1942 beschloss der Bundesrat, jüdische Flüchtlinge vermehrt wegzuweisen. Er reagierte damit auf die zahlenmässig kleine, aber anhaltend wachsende Fluchtbewegung aus den heutigen Benelux-Staaten, wo die deutschen Besatzer mit der Deportation der jüdischen Bevölkerung begonnen hatten. Die Polizeiabteilung verhängte am 13. August 1942 eine Grenzsperre, die sie nach öffentlichen Protesten wieder lockerte. Die Proteste hatten auch zur Folge, dass Bundesrat Eduard von Steiger die Genfer Behörden am 29. August 1942 mündlich anwies, Flüchtlinge aus Frankreich, wo die Deportation der ausländischen Juden eingesetzt hatte, vorerst nicht mehr zurückzuweisen.
Die Polizeiabteilung begegnete der Unsicherheit über die geltende Praxis am 26. September 1942 mit einer neuen Weisung. Demnach galten Juden nach wie vor als "Flüchtlinge aus Rassegründen" und waren somit als nichtpolitische Flüchtlinge wegzuweisen. Dagegen sollten Familien, Kinder, Alte und Kranke aus humanitären Gründen aufgenommen werden. Kirchen und Hilfsorganisationen konnten zudem ihnen bekannte Personen, die besonders gefährdet waren, auf Non-Refoulement-Listen setzen lassen. Am 29. Dezember 1942 wurden diese Weisungen verschärft, um die steigenden Aufnahmezahlen wieder zu senken. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Italien sowie der Aufnahme und Wegweisung Tausender im September und Oktober 1943 wies Heinrich Rothmund die Grenzorgane am 3. Dezember 1943 an, jüdische Flüchtlinge nicht mehr wegzuweisen. Damit nahm er die Weisung vom 12. Juli 1944 vorweg, die vorsah, alle "Ausländer, die aus politischen oder andern Gründen wirklich an Leib und Leben gefährdet sind", aufzunehmen.
Die Umsetzung der Weisungen durch die Grenzorgane
Die zivilen Grenzorgane verfügten allein nicht über genügend Kräfte, um die restriktiven Weisungen durchzusetzen. Deshalb wurden die militärischen Territorialkommandos eingeschaltet, die zusammen mit dem durch Soldaten verstärkten Grenzwachtkorps die Weisungen des EJPD durchführten. Das Vorgehen der Grenzorgane hing auch von lokalen Gegebenheiten ab. So suchte beispielsweise das Westschweizer Grenzwachtkommando durch direkte Kontakte mit französischen und deutschen Behörden die Einreise von jüdischen Flüchtlingen in die Schweiz zu verhindern. Die Bundesbehörden duldeten auch die Vereinbarungen, die kantonale und militärische Stellen in Genf und im Wallis mit dem benachbarten Département de la Haute-Savoie zur Überstellung von illegal in die Schweiz eingereisten Flüchtlingen nach Frankreich abgeschlossen hatten. Die Polizeiabteilung autorisierte dieses Vorgehen im Januar 1943, als sie die Auslieferung von Flüchtlingen, die nicht "schwarz" zurückgewiesen werden konnten, an französische, italienische oder deutsche Grenzorgane guthiess.
Aufgenommene und weggewiesene Flüchtlinge: Die Zahlen
Zwischen 1939 und 1950 hat die Schweiz 55'000 Zivil-, 104'000 Militär- und 66'000 "Grenzflüchtlinge" aufgenommen, die überwiegende Mehrheit gegen Kriegsende. Schon vor Kriegsausbruch waren 10'000 "Emigranten", worunter 6'600 Juden, eingereist. Unter den insgesamt 235'000 Aufgenommenen waren 27'900 jüdische Verfolgte. Unter Beizug der 60'000 Kinder, die vom Roten Kreuz für Erholungsaufenthalte in schweizerische Familien vermittelt wurden, steigt die Zahl der aufgenommenen Personen auf 295'000, die Carl Ludwig 1957 in seinem offiziellen Bericht zur Flüchtlingspolitik genannt hat.
Die genaue Zahl der weggewiesenen Flüchtlinge ist nicht bekannt. Die Grenzbehörden hatten ab Sommer 1942 die Instruktion, Wegweisungen zu registrieren. Die Meldungen sind nicht vollständig überliefert, so dass heute noch 24'400 anonym registrierte Wegweisungen nachweisbar sind. Die von Carl Ludwig genannte Zahl von 10'000 Weggewiesenen umfasst allein diejenigen Flüchtlinge, die aufgrund von Einvernahmeprotokollen namentlich bekannt waren. Die Eidg. Fremdenpolizei hat ausserdem 14'500 im Ausland gestellte Einreisegesuche von Schutzsuchenden abgelehnt. Die Schweizer Behörden haben demnach während des Krieges nachweislich über 30'000 Asylsuchenden die Einreise in die Schweiz verweigert. Unter ihnen war eine grosse, aber nicht näher zu beziffernde Zahl Juden und Jüdinnen. Aber auch viele aus Deutschland entwichene polnische und russische Zwangsarbeiter sowie Italiener und Franzosen, die sich der Zwangsarbeit oder dem Kriegsdienst in Deutschland zu entziehen suchten, sind darin enthalten.
Die Betreuung, die Frage der Weiterreise, das Dauerasyl und die Finanzierung
Flüchtlinge wurden mehrheitlich in Arbeitslagern und Heimen interniert, andere von Verwandten oder Bekannten aufgenommen. Die Kirche vermittelte zahlreiche Freiplätze. Neben der Ungewissheit über das Schicksal von Angehörigen litten die Flüchtlinge am stärksten unter der Trennung der Familien. Eine vom Bund 1944 eingesetzte unabhängige Flüchtlingskommission vermittelte zwischen ihnen und den Behörden. Sie konnte Spannungen, die teilweise von ungenügend qualifizierten Lagerleitern mitverursacht worden waren, mildern. Die Zentralleitung der Heime und Lager, die im Auftrag des Bundes die Unterbringung der zivilen Flüchtlinge organisierte, lockerte ab 1944 die starke Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Mitbestimmung in den Lagern. Viele jugendliche Flüchtlinge profitierten von einer Ausbildung in der Schweiz.
Der starke Druck, die Schweiz zu verlassen, lastete schwer auf den durch Verfolgung und den Verlust von Angehörigen traumatisierten jüdischen Flüchtlingen. Es war für viele schlechterdings unvorstellbar, in ihr Herkunftsland, das sie und ihre Angehörige bis auf den Tod verfolgt oder den Verfolgern preisgegeben hatte, zurückzukehren. Es war jenen unter ihnen, die zu alt oder zu krank waren, um in Israel oder in den USA ein neues Leben aufzubauen, denn auch eine grosse Erleichterung, als durch den Beschluss des Bundesrates vom 7. März 1947 das Dauerasyl geschaffen wurde. 1'345 vorwiegend ältere Flüchtlinge konnten davon profitieren. Insgesamt blieben bis 1950 rund 10'000 Flüchtlinge in der Schweiz.
In die Kosten für den Aufenthalt und die Weiterreise der Flüchtlinge teilten sich der Bund und die privaten Hilfswerke. Der Bund gab zwischen 1939 und 1950 rund 127 Millionen SFr aus. Am 1. April 1946 beschloss der Bundesrat, auf eine Rückvergütung durch die einzelnen Länder zu verzichten. Eindrücklich sind auch die Aufwendungen des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), dessen Hilfswerk zwischen 1934 und 1950 rund 61 Millionen SFr für die Betreuung jüdischer Flüchtlinge aufwendete. Über 9 Millionen SFr brachte der SIG durch Sammlungen in der Schweiz auf, 42 Millionen SFr durch Spenden jüdischer Organisationen in den USA.
Die Flüchtlingspolitik und ihre Nachgeschichte
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg" von Guido Koller?
Der Text fasst die Schweizer Flüchtlingspolitik während des Zweiten Weltkriegs zusammen. Er behandelt die Spannung zwischen humanitären Traditionen und dem Wunsch, den Arbeitsmarkt zu schützen und "wesensfremde Elemente" abzuwehren. Er behandelt die Entscheidung, die Grenzen zu schließen, selbst angesichts des Wissens über die Verfolgung der Juden, sowie die Umstände, unter denen bestimmte Gruppen (Kinder, Familien) doch aufgenommen wurden. Er beleuchtet die Anzahl der aufgenommenen und abgewiesenen Flüchtlinge und auch die Betreuung der aufgenommenen Flüchtlinge.
Welche Phasen der Judenverfolgung werden im Zusammenhang mit der Schweizer Flüchtlingspolitik erwähnt?
Der Text erwähnt drei Phasen der Verfolgung: Entrechtung und Vertreibung in der Vorkriegszeit und Vernichtung in der Kriegszeit.
Was war der "Überfremdungsdiskurs" und wie beeinflusste er die Flüchtlingspolitik?
Der "Überfremdungsdiskurs" bezog sich auf die Angst vor zu vielen Ausländern und der Bewahrung des Schweizer Arbeitsmarktes, was dazu führte, dass sogenannte "wesensfremde Elemente" abgewehrt wurden. Dies beeinflusste die Flüchtlingspolitik negativ, da die Behörden sich primär auf den Schutz des Arbeitsmarktes konzentrierten und nicht auf die Not der Verfolgten.
Wie war das Asylrecht in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs geregelt?
Die Schweiz hatte kein ausformuliertes Asylgesetz. Die Asylgewährung galt als Recht der Schweiz und Bestandteil der neutralen Staatsmaxime. Die Kantone konnten vorläufige Aufenthaltsbewilligungen erteilen. Entscheidend war die Unterscheidung zwischen "rassischen" bzw. "wirtschaftlichen" und politischen Flüchtlingen. Nach Kriegsbeginn wurden die Kompetenzen auf Bundesebene zentralisiert.
Was war der "Juden-Stempel" und welche Rolle spielte die Schweiz dabei?
Die Schweiz initiierte die Einführung des "Juden-Stempels" in deutschen Pässen im Jahr 1938, um die Einreise von Juden zu erschweren.
Was war der Bundesratsbeschluss vom 4. August 1942?
Der Bundesrat beschloss am 4. August 1942, jüdische Flüchtlinge vermehrt wegzuweisen. Dies geschah als Reaktion auf die wachsende Fluchtbewegung aus den Benelux-Staaten.
Wer war Dr. Heinrich Rothmund und welche Rolle spielte er bei der Ausgestaltung der Flüchtlingspolitik?
Dr. Heinrich Rothmund war der Chef der Polizeiabteilung und spielte eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung der flüchtlingspolitischen Praxis. Er war maßgeblich an den restriktiven Weisungen beteiligt.
Wie viele Flüchtlinge nahm die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs auf und wie viele wurden abgewiesen?
Die Schweiz nahm etwa 55.000 Zivil-, 104.000 Militär- und 66.000 "Grenzflüchtlinge" auf. Die genaue Zahl der Abgewiesenen ist nicht bekannt, aber es sind nachweislich über 30.000 Asylsuchende abgewiesen worden, darunter eine bedeutende Anzahl Juden und Jüdinnen.
Wie wurden die Flüchtlinge in der Schweiz betreut?
Flüchtlinge wurden in Arbeitslagern und Heimen interniert oder von Verwandten aufgenommen. Die Kirche vermittelte Freiplätze. Eine unabhängige Flüchtlingskommission vermittelte zwischen Flüchtlingen und Behörden. Ab 1944 wurden die Einschränkungen in den Lagern gelockert.
Was war das "Dauerasyl" und wann wurde es eingeführt?
Das "Dauerasyl" wurde am 7. März 1947 eingeführt und ermöglichte es vorwiegend älteren Flüchtlingen, dauerhaft in der Schweiz zu bleiben. 1.345 Flüchtlinge profitierten davon.
Wie wurde die Flüchtlingspolitik nach dem Krieg aufgearbeitet?
Die Aufarbeitung begann 1954 mit der Veröffentlichung des Berichts von Professor Carl Ludwig. Weitere wichtige Beiträge leisteten Alfred A. Häsler und Jacques Picard.
Wer war Carl Ludwig und was war der Inhalt seines Berichts?
Carl Ludwig erstellte im Auftrag der Regierung einen umfassenden Bericht über die Flüchtlingspolitik der Schweiz zwischen 1933 und 1950. Sein Bericht ist eine sachliche Dokumentation, auch wenn die Wegweisungszahlen inzwischen revidiert werden mussten.
- Citar trabajo
- Max Wiedl (Autor), 1998, Die schweizerische Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95048