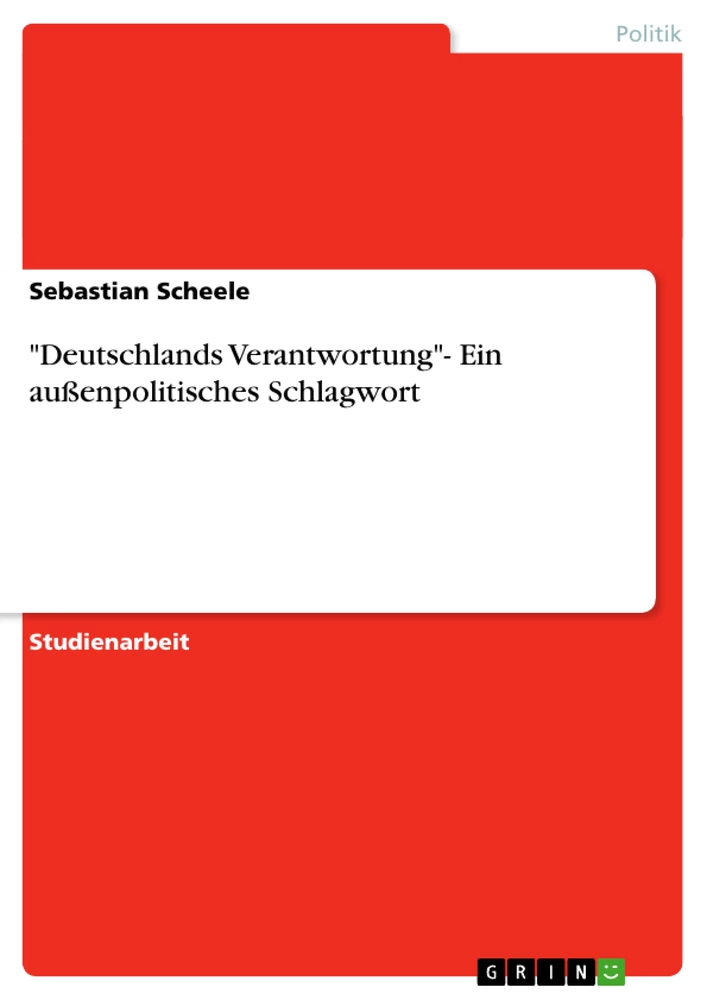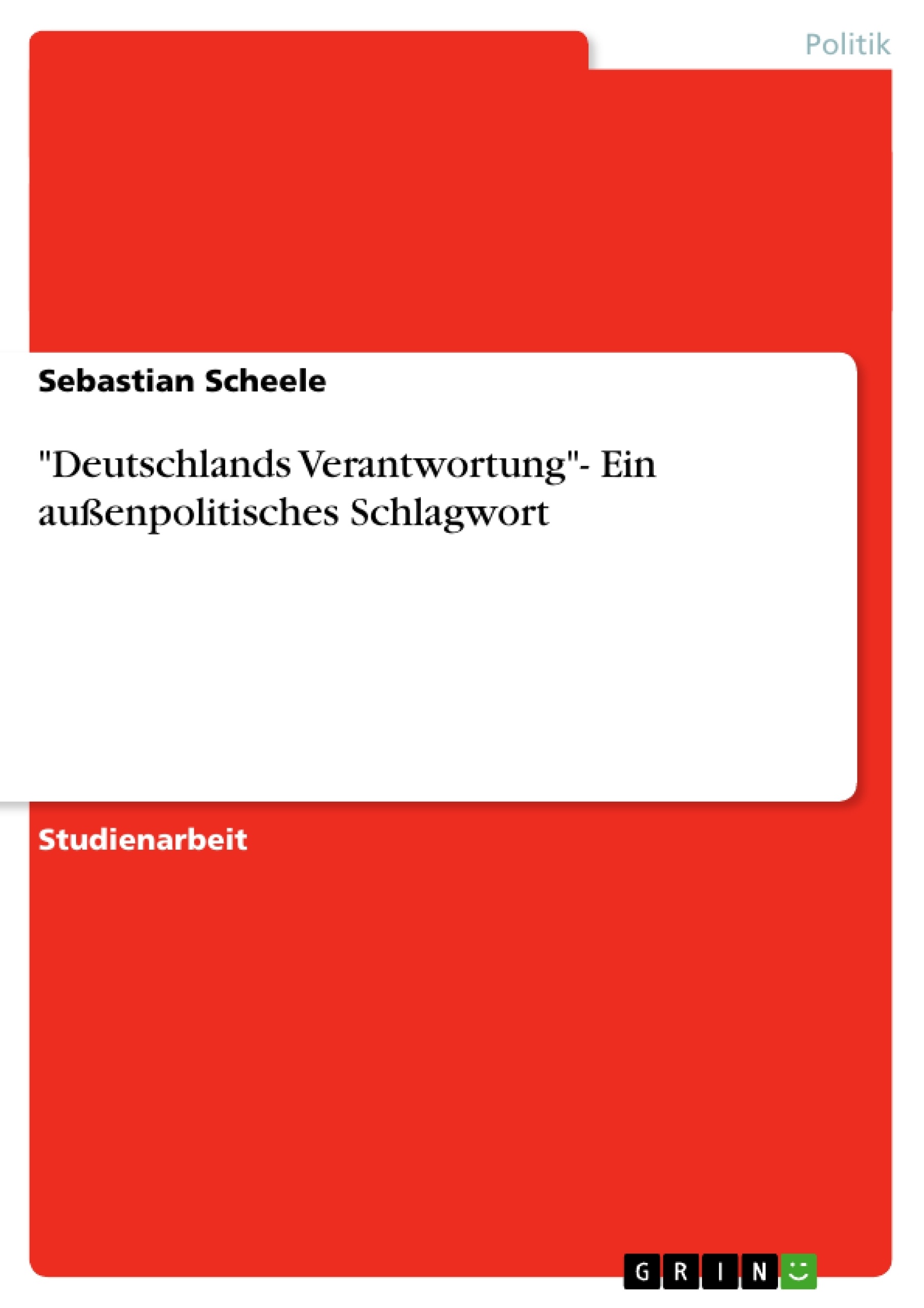Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Die "gewachsene Verantwortung" Deutschlands nach der Wiedervereinigung
3. Grammatische Dimensionen des Begriffs Verantwortung
3.1 Subjekt der Verantwortung- Wer?
3.2 Objekt der Verantwortung -Wofür?
3.3 Instanz der Verantwortung - Wem gegenüber?
4. Dimensionen des Begriffs Verantwortung im außenpolitischen Kontext
4.1 Subjekt der Verantwortung- der Nationalstaat
4.2 Objekt der Verantwortung
4.2.1 Verantwortung für andere Territorien
4.2.2 Verantwortung als Umschreibung für Einfluß
4.2.3 Verantwortung für moralische Werte
4.3 Instanz der Verantwortung
4.3.1 Verantwortung gegenüber inländischen Interessengruppen
4.3.2 Verantwortung für moralische Werte
- gegenüber einem kollektiven Gewissen
- gegenüber Bündnispartnern
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Vorwort
"Verantwortung" ist ein schillernder Begriff. Er erzeugt positive Assoziationen; wer sich auf "Verantwortung" beruft, wird für "verantwortungsvoll" gehalten. Gleichzeitig klingen immer "Verpflichtungen" mit.
Der Begriff, ursprünglich aus der spätmittelalterlichen Gerichtssprache kommend, wurde in den 1930er Jahren zu einem Schlüsselbegriff der Ethik. Seitdem ist er "in das Zentrum eth. und ethisch-polit. Diskurse, aber auch der polit. und publizist. Rhetorik getreten[...]" (Brockhaus 1994:122). Besonders in der Diskussion um Deutschlands Außenpolitik nach der Wiedervereinigung taucht der Begriff häufig auf.
Dient er dort nur zur moralischen Aufwertung von eigenen Interessen oder kann er einen Leitfaden staatlichen Handelns abgeben?
Da die Implikationen des Begriffs in den tagespolitischen Diskussionen meist nicht offengelegt werden, sondern vielmehr eine Unantastbarkeit des Begriffs (und der mit ihm begründeten Handlungen) angestrebt zu werden scheint, halte ich es für spannend, diesen Begriff auf seine "Alltagstauglichkeit", seine Aussagekraft hin abzuklopfen. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg vor einigen Monaten war so oft an so herausgehobener Stelle (z.B. als Motto des SPD- Sonderparteitages am 12.4.99 in Bonn) von Verantwortung die Rede, daß sich eine Analyse geradezu aufdrängte.
2. Die "gewachsene Verantwortung" Deutschlands nach der Wiedervereinigung
In einem Punkt sind sich die meisten Publikationen zu Deutschlands Rolle nach der Wiedervereinigung einig, nämlich daß seine Verantwortung gewachsen sei. Schon am 3. Oktober 1990 verkündete der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl: "Wir wissen, daß wir mit der Vereinigung auch größere Verantwortung in der Völkergemeinschaft insgesamt übernehmen." (zitiert nach Kaiser 1994: 1)
Teilweise wird auch von Deutschlands "neuer" Verantwortung gesprochen (so etwa Kaiser 1994: 8), mit der Begründung, daß sich durch den plötzlichen Zuwachs an Bevölkerung, Staatsgebiet, Wirtschaftskraft und den Zugewinn an nationaler Souveränität nach dem Abschluß des "Zwei-Plus-Vier-Vertrags" ein grundlegender Neubeginn in der Außenpolitik ergebe: " Die Rolle Deutschlands nach der Vereinigung unterscheidet sich fundamental von der Rolle der BRD und hat die Akteursqualität des neuen Deutschland außerordentlich vergrößert." (Woyke 1997: 12)
Kreile bemerkt zu dieser Argumentation, daß zur Begründung der gewachsenen Verantwortung "Größen angeführt [werden], die normalerweise Machtressourcen bezeichnen" (Kreile 1996: 5). Teilweise wird hier eine direkte Kausalität gesehen: "Die Übernahme größerer internationaler Verantwortung resultierte einmal aus dem Erlangen der völkerrechtlichen Souveränität, zum anderen aber aufgrund der geostrategischen Position Deutschlands im Herzen Europas." (Woyke 1997: 20)
Daß die nationalen Machtressourcen enorm gewachsen sind, ist unbestritten, auch wenn man die Belastung der öffentlichen Haushalte durch Transferleistungen in die neuen Bundesländer einbezieht. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Zuwachs an Macht und Zuwachs an Verantwortung keineswegs so offensichtlich oder selbstverständlich, vielmehr gilt es nun, diesen argumentativen Brückenschlag genauer zu untersuchen.
3. Grammatische Dimensionen des Begriffs Verantwortung
Es stellt sich die Frage, ob man an Schlagworte der politischen Diskussion grammatisch-präzise Maßstäbe anlegen sollte. Allerdings scheint mir dies sinnvoll, um eine ansonsten moralisch stark aufgeladene Diskussion wieder auf sachliche Grundlagen zu stellen.
Um das Wort "Verantwortung" sinnvoll benutzen zu können, bedarf es dreier Angaben:
1. Wer ist verantwortlich?
2. Wofür ist er verantwortlich?
3. Wem ist er verantwortlich, welche Instanz kann Rechenschaft fordern?
3.1 Das Subjekt der Verantwortung
Jemand kann Verantwortung selbst eingegangen sein oder sie kann ihm von anderen zugewiesen worden ein. Grundsätzlich kann man nur verantwortlich handeln, wenn einem mehrere Handlungsmöglichkeiten offenstehen.
3.2 Das Objekt der Verantwortung
Was als Gegenstand von Verantwortung gelten kann, beruht auf zwei Bedingungen:
- einem normativen Urteil, also der Unterscheidung zwischen Gut/ Böse bzw. Güter/ Übel, konkreter: der Unterscheidung zwischen einem zu verhindernden/ zu erhaltenden Ereignis.
- einem Zurechnungsurteil, daß also ein Ereignis (z.B. das Wohlergehen des Objekts der Verantwortung) einem bestimmten Akteur (eben dem Subjekt) kausal oder auch intentional zugerechnet werden kann.
3.3 Die Instanz der Verantwortung
Wer Verantwortung trägt, ist verantwortlich gegenüber einer Instanz, er muß ihr Rechenschaft ablegen. Diese Instanz kann sowohl juristischer als auch (metaphysischer oder) psychologischer Natur sein.
4. Dimensionen des Begriffs Verantwortung im außenpolitischen Kontext
4.1 Subjekt der Verantwortung- der Nationalstaat
Wenn im Zusammenhang mit Außenpolitik von Verantwortung die Rede ist (zumal von "Deutschlands Verantwortung") , wird wie selbstverständlich der Nationalstaat als Subjekt der Verantwortung vorausgesetzt. Diese Grundannahme setzt den Blickwinkel des Realismus voraus. Wer diesen nicht teilt, wird den Nationalstaat als alleinigen Handlungsträger anzweifeln und auf die vielen einzelnen Akteure verwiesen, die am außenpolitischen Handeln mitwirken (vgl. Bühl 1994: 176ff).
4.2 Objekt der Verantwortung
Wenn auch aus vielen verschiedenen politischen Richtungen an Deutschlands Verantwortung appelliert wird, besteht über den Inhalt dieser Verantwortung "keinerlei Einvernehmen" (Kaiser 1994: 1). Die Frage "Verantwortung wofür?" wird folglich auf verschiedenste Arten behandelt, es lassen sich drei Kategorien ausmachen:
4.2.1 Verantwortung für andere Territorien
Manchmal wird als Objekt der Verantwortung ein bestimmtes Territorium genannt, so z.B. "Verantwortung für Europa und die Welt" (Volker Rühe, zitiert nach Kreile 1996: 6) oder "Verantwortung für die Dritte Welt" (Rühe 1994: 10). Eine direkte Verantwortlichkeit für diese Territorien oder Staaten, ein solches "nicht-reziprokes Verhältnis" (Kreile 1996: 6), das fast an die "Bürde das weißen Mannes" (Rudyard Kipling) erinnert, kann wohl nicht gemeint sein, vielmehr scheint einfach die Formulierung unglücklich gewählt oder ungenau zu sein, weshalb ich diesen Fall für vernachlässigbar halte. Die tatsächliche Bedeutung dieses Sprachgebrauchs dürfte sich unter die Fälle 4.2.2 oder 4.2.3 subsumieren lassen.
4.2.2 Verantwortung als Umschreibung für Einfluß
Oft hat man den Eindruck, daß nicht um Verantwortung für etwas Bestimmtes gemeint ist, sondern Verantwortung an sich, mit anderen Worten Mitwirkung, Einfluß oder Macht. Zum Beispiel kommt Karl Kaiser auf die "neuen Verantwortungen des vereinten Deutschlands" (Kaiser 1994: 8) zu sprechen in einem Abschnitt, der von der Notwendigkeit handelt, eigene Interessen zu vertreten und sich nicht hinter den außenpolitischen Partnern zu verstecken, oder Helga Haftendorn schlußfolgert in einem mit "Die Übernahme internationaler Verantwortung" überschriebenen Kapitel: "Nur so wird Deutschland in internationalen Fragen mitführungsfähig sein und als Mitführungsmacht von seinen Partnern respektiert werden." (Haftendorn 1994: 150).
Solche Kontexte legen die Vermutung nahe, "daß die 'Verantwortung' Deutschlands bemüht wird, um neue Ansprüche mit einer Aura der Uneigennützigkeit zu umgeben [...]" (Kreile 1996: 5). Bei einem solchen Gebrauch des Wortes "Verantwortung" greift die Frage "Verantwortung wofür?" ins Leere, es können höchstens Politikfelder aufgezeigt werden, in denen Deutschland Einfluß ausübt oder nach Meinung des jeweiligen Autors/ der jeweiligen Autorin ausüben sollte, z.B. "in den Bereichen der westeuropäischen Integration, des friedlichen Wandels zwischen Ost und West und der Bemühung um weltwirtschaftliche und währungspolitische Kooperation" (Kaiser 1994:11).
4.2.3 Verantwortung für moralische Werte
Aussagekräftiger ist schließlich die dritte Form des Gebrauchs von Verantwortung, bei der als Objekt der Verantwortung universelle moralische Werte genannt werden, die es durchzusetzen gelte, z.B. "Mitverantwortung für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt" (Volker Rühe, zitiert nach Kreile 1996: 6) oder "für die Bewahrung der natürlichen Umwelt und für die dauerhafte Entwicklung in den Ländern des Südens" (Regierungsprogramm der SPD 1994, zitiert nach Kreile 1996: 6).
Besonders konkret bestimmbar wird diese Verantwortung, wenn sie sich auf die Aufrechterhaltung oder Durchsetzung institutionalisierter moralischer Werte bezieht, also auf die Aufrechterhaltung dieser Institution. Beispiele hierfür sind Pflichten, die Deutschland in Organisationen wie der NATO oder der UN eingegangen ist oder Verpflichtungen auf die Menschenrechten oder das Völkerrecht. (vgl. Kaiser 1994: 12f)
4.3 Instanz der Verantwortung
Als Instanzen, vor denen sich Deutschland zu verantworten hat, kommen verschiedenste Akteure in Frage, entsprechend den verschiedenartigen Objekten der Verantwortung (siehe 4.2).
4.3.1 Verantwortung gegenüber inländischen Interessengruppen
Entsprechend der unter 4.2.2 beschriebenen Bedeutung von Verantwortung als Umschreibung für Einfluß muß auch die Instanz eine sein, die an deutscher Einflußnahme interessiert ist und fehlende Interessenverfolgung verurteilt. Diese Instanz dürfte sich folglich innerhalb Deutschlands finden lassen (Opposition, Wähler, Medien, Interessengruppen z.B. in der Wirtschaft), was einmal mehr die Problematik der Vorstellung von Nationalstaaten als alleinigen Akteuren der Außenpolitik verdeutlicht.
4.3.2 Verantwortung für moralische Werte
Zu 4.2.3 ist eine weitere Unterteilung zu treffen: zwischen Verantwortung im "starken", juristischen Sinn und Verantwortung im moralischen Sinn. Diese Unterscheidung deckt sich mit der zwischen "Erwartungen und Rollenzuweisungen von Partnern im westlichen Bündnis" und der "Wertbindung deutscher Außenpolitik" (Kreile 1996: 4).
Dementsprechend gibt es zwei verschiedene Instanzen der Verantwortlichkeit: Zum einen die Bündnispartner Deutschlands, die auf die Erfüllung der Bündnispflichten pochen, zum anderen das eigene Gewissen. Dieses "nationale Gewissen" kann natürlich nicht als Einheit gedacht werden, vielmehr es ist abhängig von Medienaufmerksamkeit, bei deren Entstehung wiederum viele Faktoren mitwirken wie (visuelle) Vermittelbarkeit oder zufällige Gleichzeitigkeit mit anderen Medienereignissen. Mit anderen Worten: Problematisch an diesem Mechanismus ist, "daß das moralische Gewissen der Menschheit weitgehend fernsehgesteuert und dementsprechend selektiv ist" (Kreile 1996: 11). Da in allen Nationen diese Medienmechanismen greifen, so daß die Erwartungen anderer Nationen genauso wechselhaft sein und irrational zustande kommen können wie das eigene "nationale Gewissen", sollten diese Erwartungen konkretisiert werden: Klar definiert sind die Erwartungen an die einzelnen Bündnispartner, wenn sie sich auf die Vertragstexte und somit auf die Bündnispflichten beziehen.
Es ist also festzuhalten, "daß die 'internationale Verantwortung' Deutschlands dort am präzisesten bestimmt wird, wo sie als Inbegriff von Erwartungen und Rollenzuweisungen der Bündnispartner in der NATO und der Europäischen Union steht." (Kreile 1996: 5) und die Instanz der Rechtfertigung folglich die Bündnispartner sind.
5. Fazit
Wie dargelegt, bezieht sich der einzig präzise Gebrauch von Verantwortung in der Außenpolitik auf die Verantwortung gegenüber den Bündnispartnern, die Bündnispflichten mitzutragen. Dieser Gebrauch bewegt sich nicht mehr auf dem wackeligen Boden eines moralischen Appells, sondern beruft sich auf eine längst eingegangene und anerkannte Pflicht.
Im Rückgriff auf Kapitel 2 kann man den Begriff der gewachsenen Verantwortung Deutschlands nun ausfüllen: Durch den Zuwachs an Machtressourcen aller Art hat Deutschland in internationalen Organisationen und Beziehungen ein größeres Gewicht bekommen, was zur Folge hat, daß es stärker beachtet wird, auch unter dem Aspekt einer (eventuell negativen) Vorbildfunktion. Diese herausgehobene Position macht ein verantwortungsvolles Handeln nötig, verantwortlich für die Legitimation der Organisation, um keinen Präzedenzfall für Pflichtvernachlässigung abzugeben und die Handlungsbereitschaft anderer, weniger einflußreicher Mitgliedsstaaten dadurch zu schwächen.
Unbedingt beachtet werden muß: Die Verantwortung für die Erfüllung der Bündnispflichten und die Wahrung der vertraglich festgehalten Grundwerte ist nicht nach Belieben erfüll- oder ignorierbar, sie gilt durchgehend. Das heißt auch, daß sie nicht nur in Krisenzeiten gilt. Wenn folglich Verantwortung als Begründung für außenpolitische Handlungen herangezogen wird, muß sie ernst genommen werden, also als langfristige Verpflichtung und nicht zur kurzfristigen Legitimation von punktuellem Aktionismus. Das Berufen auf Verantwortung in Krisensituationen ist nicht glaubhaft, wenn diese Verantwortung im Tagesgeschäft ignoriert wird, besonders, wenn in den Krisensituationen nur die Auswirkungen von Prozessen bekämpft werden, die man selber lange übersehen oder sogar beschleunigt hat: "Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik steht zudem auf dem Spiel, wenn sie Menschenrechte und demokratische Reformen in 'schwachen' Staaten mit geringer Verhandlungsmacht fordert, sie in anderen Staaten aber der Sicherung künftiger Exportmärkte unterordnet." (Brenke 1995: 59).
So können durchaus Konflikte auftreten zwischen wirtschaftlichen Interessen und langfristig verantwortungsvollem Handeln, z. B. wenn "[...] first world states faced the dilemma of, on the one hand, continuing their exploitation of the developing nations and, on the other, needing stable political conditions in these countries." (Gutjahr 1994: 17).
In diesem Sinne gilt es, sich der Verantwortung im "Tagesgeschäft" bewußt zu werden, denn natürlich gibt es abseits der neuen Herausforderungen und spektakulären Aktionen, für deren Legitimation der Begriff Verantwortung meist herangezogen wird, noch die "alten" Aufgaben und Tätigkeiten, z.B. die alltäglichen diplomatischen Beziehungen, die Gremien in internationalen Regierungsorganisationen oder die Handelsbeziehungen zu anderen Nationen. Diese schon "vorhandene Gestaltungsmacht" (Woyke 1997: 23) Deutschlands sollte also verantwortungsbewußt eingesetzt werden, im Sinne einer "gewissenhaften Pflichten- und Folgenabwägung in konflikthaften Entscheidungen" (Brockhaus, 1994:122), was beim Konsens des Strebens nach Stabilität durch Demokratie und Menschenrechte heißt, sich mit diesen "alltäglichen" zivilen Maßnahmen für Stabilität einzusetzen.
Diese Verantwortung ist nicht von der Hand zu weisen, unabhängig davon, wie man beim Versagen dieser Maßnahmen einem Konflikt beikommen will, ob man also darüber hinaus für Militärinterventionen einer international legitimierten Organisation (und Deutschlands Beteiligung daran) plädiert oder ob man prinzipiell für gewaltfreie Lösungen eintritt.
Erst auf dem Fundament dieser Einsicht kann dann weiter diskutiert werden, durch welche Maßnahmen man dieser Verantwortung im Krisenfall nachkommt, wie Deutschland dann seine Pflichten erfüllt. In dieser Diskussion ist das Wort Verantwortung dann allerdings fehl am Platz.
6. Literaturverzeichnis
N.N.: "Verantwortung", in: Brockhaus-Enzyklop ä die in 24 Bd., Bd. 23, S.122ff, Mannheim 1994.
Cremer, Uli: Neue NATO- neue Kriege?, Hamburg 1998.
Czempiel, Ernst-Otto: "Folgerungen aus den beiden Weltkriegen und dem Ost-West-Konflikt für die deutsche Politik", in: Bl ä tter f ü r deutsche und internationale Politik, 3/1998, S.329-337.
Gutjahr, Lothar: German Foreign and Defense Policy after Unification, London 1994.
Kaiser, Karl/ Maull, Hans W. (Hrsg.): Deutschlands neue Au ß enpolitik, München 1994-98.
Darin besonders:
Band 1, Grundlagen (1994):
Bühl, Walter L.: "Gesellschaftliche Grundlagen der deutschen Außenpolitik", S. 175-201.
Haftendorn, Helga: "Gulliver in der Mitte Europas. Internationale
Verflechtung und nationale Handlungsmöglichkeiten", S. 129- 152.
Kaiser, Karl: "Das vereinigte Deutschland in der internationalen Politik", S. 1-14.
Band 2, Herausforderungen (1995):
Becher, Klaus: "Nationalitätenkonflikte auf dem Balkan", S. 137-155. Brenke, Gabriele: "Entwicklung und Unterentwicklung. Trends und Herausforderungen", S. 43-59.
Kreile, Michael: "Verantwortung und Interesse in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik", in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 5/1996, S. 3- 11.
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Verantwortung f ü r Frieden und Freiheit (CD-ROM), Bonn 1999.
Rühe, Volker: Deutschlands Verantwortung, Berlin 1994.
Schöllgen, Gregor: Die Au ß enpolitik der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1999.
Siedschlag, Alexander: Die aktive Beteiligung Deutschlands an milit ä rischen Aktionen zur Verwirklichung Kollektiver Sicherheit, Frankfurt 1995.
Woyke, Wichard: "Von der Orientierungslosigkeit zur Konzeption- die Außenpolitik des vereinten Deutschland", in: Politische Bildung, 1/1997, S. 9-25.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kernpunkt des Vorworts?
Das Vorwort stellt fest, dass "Verantwortung" ein vielschichtiger Begriff ist, der sowohl positive Assoziationen als auch Verpflichtungen hervorruft. Er wurde in den 1930er Jahren zu einem Schlüsselbegriff der Ethik und taucht häufig in Diskussionen über Deutschlands Außenpolitik nach der Wiedervereinigung auf. Es wird die Frage aufgeworfen, ob der Begriff lediglich zur moralischen Aufwertung eigener Interessen dient oder als Leitfaden für staatliches Handeln dienen kann. Angesichts der häufigen Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg wird eine Analyse seiner Aussagekraft gefordert.
Was besagt die "gewachsene Verantwortung" Deutschlands nach der Wiedervereinigung?
Die meisten Publikationen sind sich einig, dass Deutschlands Verantwortung nach der Wiedervereinigung gewachsen ist, da die Wiedervereinigung einen grundlegenden Neubeginn in der Außenpolitik aufgrund des Zuwachses an Bevölkerung, Staatsgebiet, Wirtschaftskraft und nationaler Souveränität darstellt. Dieser Zuwachs an Machtressourcen wird oft als direkte Ursache für die gestiegene Verantwortung gesehen. Der Zusammenhang zwischen Macht und Verantwortung wird jedoch genauer untersucht.
Welche grammatikalischen Dimensionen hat der Begriff "Verantwortung"?
Um den Begriff "Verantwortung" sinnvoll zu verwenden, sind drei Angaben erforderlich: Wer ist verantwortlich (Subjekt), wofür ist er verantwortlich (Objekt), und wem ist er verantwortlich, welche Instanz kann Rechenschaft fordern (Instanz). Das Objekt der Verantwortung basiert auf einem normativen Urteil (Gut/Böse) und einem Zurechnungsurteil (kausaler Zusammenhang zwischen Ereignis und Akteur). Die Instanz der Verantwortung kann juristischer, metaphysischer oder psychologischer Natur sein.
Wie wird der Nationalstaat als Subjekt der Verantwortung im außenpolitischen Kontext betrachtet?
Im außenpolitischen Kontext wird der Nationalstaat oft als selbstverständliches Subjekt der Verantwortung vorausgesetzt. Dies setzt den Blickwinkel des Realismus voraus, der jedoch von anderen Akteuren in Frage gestellt wird. Die Frage "Verantwortung wofür?" wird unterschiedlich beantwortet, wobei drei Kategorien erkennbar sind: Verantwortung für andere Territorien, Verantwortung als Umschreibung für Einfluss und Verantwortung für moralische Werte.
Welche Arten von Objekten der Verantwortung werden unterschieden?
Es werden drei Kategorien unterschieden: Verantwortung für andere Territorien (oft unglücklich gewählte Formulierung), Verantwortung als Umschreibung für Einfluss (eigene Interessen durchsetzen) und Verantwortung für moralische Werte (Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Menschenrechte, Völkerrecht). Die letztgenannte Kategorie ist am aussagekräftigsten.
Welche Instanzen der Verantwortung werden im außenpolitischen Kontext unterschieden?
Die Instanzen der Verantwortung variieren je nach Objekt. Bezüglich Verantwortung als Umschreibung für Einfluss ist die Instanz innerhalb Deutschlands zu finden (Opposition, Wähler, Medien, Interessengruppen). Bezüglich Verantwortung für moralische Werte wird unterschieden zwischen Verantwortung im juristischen Sinne (Bündnispflichten) und Verantwortung im moralischen Sinne (eigenes Gewissen). Die Erwartungen der Bündnispartner sind klar definiert und beziehen sich auf die Vertragstexte.
Was ist das Fazit der Analyse des Begriffs "Verantwortung" in der deutschen Außenpolitik?
Der präziseste Gebrauch von Verantwortung bezieht sich auf die Verantwortung gegenüber den Bündnispartnern, die Bündnispflichten mitzutragen. Der Zuwachs an Machtressourcen Deutschlands führt zu größerer Beachtung in internationalen Organisationen, was ein verantwortungsvolles Handeln nötig macht, um die Legitimation der Organisation zu wahren und keinen Präzedenzfall für Pflichtvernachlässigung zu schaffen. Verantwortung muss ernst genommen werden, also als langfristige Verpflichtung und nicht zur kurzfristigen Legitimation von punktuellem Aktionismus. Auch im "Tagesgeschäft" sollte Deutschland seine Gestaltungsmacht verantwortungsbewusst einsetzen.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Es werden verschiedene Werke zitiert, darunter Werke von Brockhaus, Cremer, Czempiel, Gutjahr, Kaiser/Maull, Kreile, Rühe, Schöllgen, Siedschlag und Woyke. Eine detaillierte Auflistung befindet sich im Literaturverzeichnis.
- Citar trabajo
- Sebastian Scheele (Autor), 1999, "Deutschlands Verantwortung"- Ein außenpolitisches Schlagwort, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95080