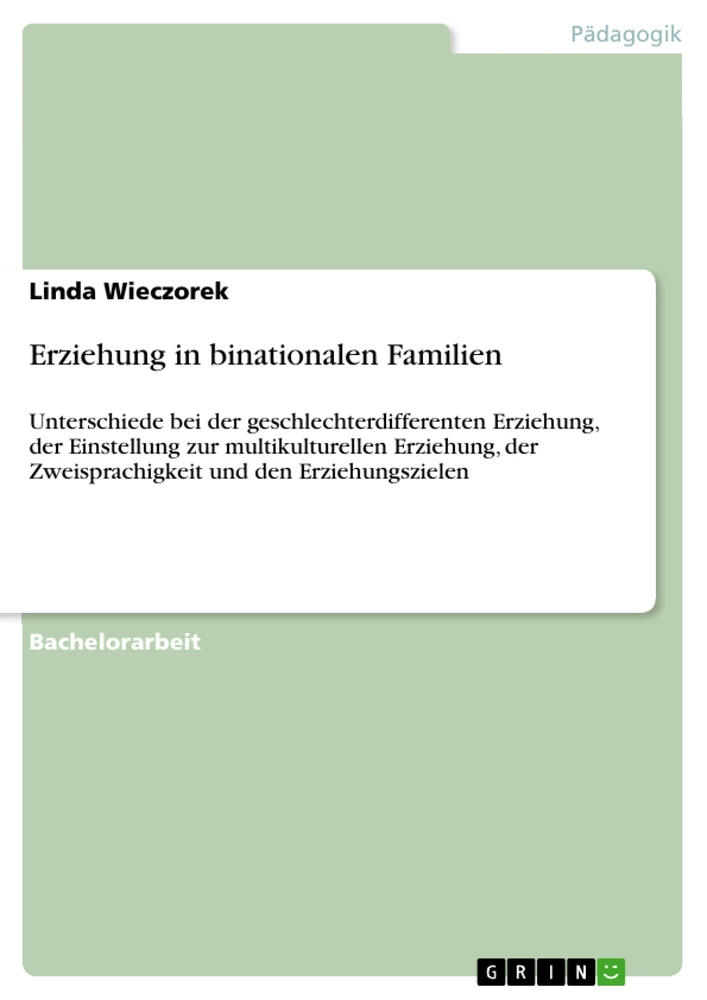Die Arbeit thematisiert die Erziehung in binationalen Familien. Im Besonderen soll untersucht werden, inwiefern sich die Erziehungsschwerpunkte von deutsch-deutschen, deutsch-europäischen und deutsch-islamischen Paaren in den Aspekten der Erziehungsziele, der geschlechterdifferenten Erziehung, der Einstellung zur multikulturellen Erziehung und dem mehrfachen Spracherwerb unterscheiden.
Vor allem in den letzten Jahren sind die internationale Mobilität sowie das weltweit Migrations- und Fluchtgeschehen weiter stark angestiegen. Deutschland gilt seit den Fünfzigerjahren aufgrund der florierenden Wirtschaft, dem hohen Lebensstandard und des gut funktionierenden Sozialsystems, als eines der bevorzugten Einwanderungsländer. Auch heute wollen viele Menschen als Arbeitnehmer, Fachkräfte oder Selbstständige in Deutschland arbeiten. Im Rahmen der Arbeitsmigration kommen ebenfalls viele junge Menschen, um eine Ausbildung zu absolvieren oder zu studieren. Binationale Freundschaften, Beziehungen und Familien gewinnen zunehmend an Bedeutung. Die damit verbundene Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus binationalen Familien wird mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus gleichkulturellen Familien verglichen und bildet den Gegenstand dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Binationale Familien in Deutschland
- Erziehung und Erziehungsstile
- Bedeutung von Fähigkeiten und Kompetenzen
- Das Forschungsfeld: Binationale Erziehung
- Zur Situation von Menschen mit binationalem Hintergrund
- Forschungsstand
- Erziehung in monokulturellen und binationalen Familien
- Erziehungsziele
- Geschlechterdifferente Erziehung von Jungen und Mädchen
- Einstellungen zur multikulturellen Erziehung
- Erziehung zur Zweisprachigkeit
- Erziehung in binationalen und monokulturellen Familien im Vergleich
- Trends
- Verschiedenheiten
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Erziehung in binationalen Familien und vergleicht sie mit der Erziehung in monokulturellen Familien. Dabei werden die Schwerpunkte auf die Erziehungsziele, die geschlechterdifferente Erziehung, die Einstellung zur multikulturellen Erziehung und den Spracherwerb gelegt. Die Arbeit möchte einen Einblick in die Herausforderungen und Chancen der Erziehung in binationalen Familien geben und die Bedeutung von Integration im Rahmen der Migrationsgesellschaft beleuchten.
- Erziehungsziele in binationalen Familien
- Geschlechterdifferente Erziehung in binationalen Familien
- Einstellungen zur multikulturellen Erziehung in binationalen Familien
- Spracherwerb in binationalen Familien
- Integration von binationalen Familien in die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas "Erziehung in binationalen Familien" im Kontext der Migrationsgesellschaft in Deutschland hervorhebt. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem theoretischen Hintergrund, wobei die Familienform binationaler Familien vorgestellt und ihre Relevanz für die Integration beleuchtet wird.
Das dritte Kapitel betrachtet die Erziehung in monokulturellen und binationalen Familien hinsichtlich der Erziehungsziele, der geschlechterdifferenten Erziehung, der Einstellungen zur multikulturellen Erziehung und der Erziehung zur Zweisprachigkeit. Im vierten Kapitel werden die Erziehungspraktiken beider Familienmodelle verglichen und auf Trends und Unterschiede geprüft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter "Erziehung", "binationale Familien", "Migrationsgesellschaft", "Integration", "Erziehungsziele", "Geschlechterdifferenz", "multikulturelle Erziehung" und "Spracherwerb".
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die Erziehung in binationalen Familien von monokulturellen Familien?
Binationale Familien stehen oft vor der Herausforderung, unterschiedliche kulturelle Erziehungsziele, Sprachen und Traditionen zu vereinen, während monokulturelle Familien meist auf einem geteilten kulturellen Hintergrund aufbauen.
Welche Rolle spielt die Zweisprachigkeit in binationalen Familien?
Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit ist ein zentrales Ziel. Sie wird oft als Chance für die Identitätsbildung und die Kommunikation mit beiden Herkunftskulturen gesehen, erfordert aber konsequente Strategien der Eltern.
Gibt es Unterschiede bei den Erziehungszielen je nach Herkunft der Partner?
Die Arbeit untersucht, wie sich Ziele zwischen deutsch-deutschen, deutsch-europäischen und deutsch-islamischen Paaren unterscheiden, insbesondere im Hinblick auf Autonomie, Gehorsam und religiöse Werte.
Wie wird die geschlechterdifferente Erziehung in diesen Familien gehandhabt?
Es wird analysiert, ob binationale Familien traditionellere oder modernere Rollenbilder an ihre Söhne und Töchter vermitteln und wie kulturelle Prägungen diese Entscheidungen beeinflussen.
Welchen Beitrag leisten binationale Familien zur Integration?
Binationale Familien gelten oft als Brückenbauer zwischen Kulturen. Ihr Alltag fördert multikulturelle Kompetenzen, die in einer modernen Migrationsgesellschaft wie Deutschland von großer Bedeutung sind.
- Citar trabajo
- Linda Wieczorek (Autor), 2018, Erziehung in binationalen Familien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951123