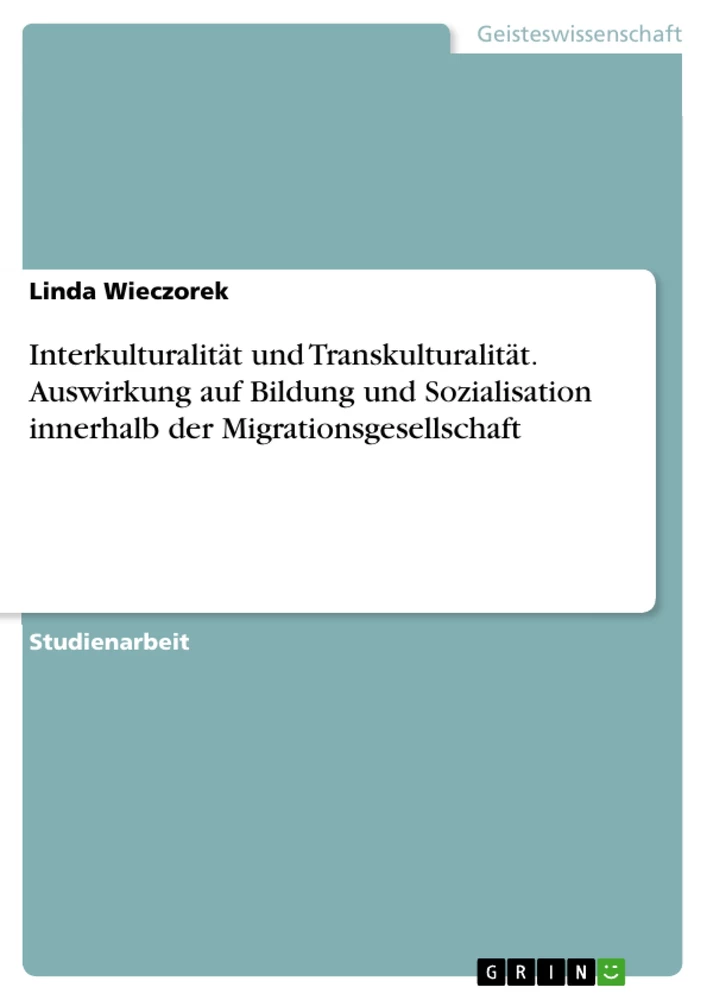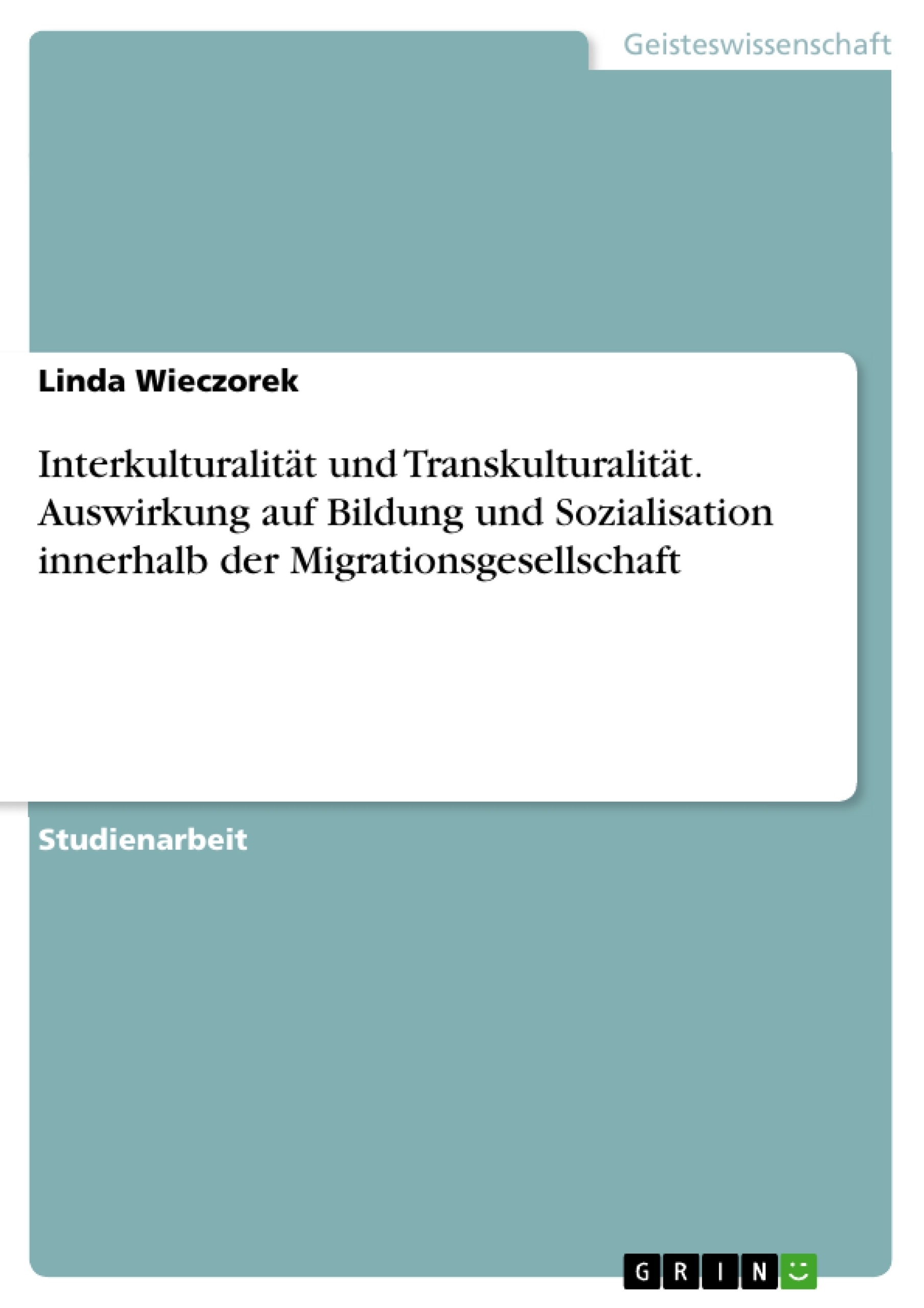Die Arbeit thematisiert die Auswirkungen der Interkulturalität sowie der Transkulturalität auf Bildung und Sozialisation innerhalb der Migrationsgesellschaft. Hierbei gilt es zunächst die Begriffe der Kultur sowie der Transkulturalität zu definieren und anschließend die soziale Situation Deutschlands hinsichtlich der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu erfassen. Im darauffolgenden Abschnitt wird das Buch „Unter deutschen Betten“ von Justyna Polanska, auf welches im anschließenden Abschnitt der Ausarbeitung Bezug genommen wird, vorgestellt. Im Anschluss wird die Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag sowie die Auswirkungen dieser auf den schulischen Bereich erörtert. Abschließend werden die Kernaussagen zusammengefasst, kritisch reflektiert und durch einen Ausblick erweitert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von kulturellen Begrifflichkeiten
- Definition Kultur
- Transkulturalität Definition
- Soziale Situation in Deutschland
- Transkulturalität
- „Unter deutschen Betten“
- Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag
- Transkulturelle Auswirkungen im schulischen Bereich
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Auswirkungen von Interkulturalität und Transkulturalität auf Bildung und Sozialisation in der Migrationsgesellschaft Deutschlands. Sie definiert die Begriffe Kultur und Transkulturalität und analysiert die soziale Situation in Deutschland im Hinblick auf die Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Die Arbeit beleuchtet zudem die Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag sowie deren Auswirkungen auf den schulischen Bereich.
- Definition und Abgrenzung von Kultur und Transkulturalität
- Soziale Situation von Migranten in Deutschland
- Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag
- Transkulturelle Herausforderungen im Bildungssystem
- Entwicklung einer Globalkultur durch Globalisierung und Migration
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Transkulturalität in der modernen, von Migration und Globalisierung geprägten deutschen Gesellschaft ein. Sie hebt die Bedeutung von Interkulturalität und Transkulturalität für die Integration von Migranten und die Bewältigung von Differenzverhältnissen in pädagogischen Bereichen hervor. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und kündigt die zentralen Themen an, die im Folgenden behandelt werden.
Definition von kulturellen Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel definiert zunächst den Begriff „Kultur“ als die Gesamtheit geteilter Verhaltensweisen, Vorstellungen, Einstellungen, Werte und Traditionen innerhalb einer Menschengruppe. Es werden die Herausforderungen der Begegnung mit anderen Kulturen und das Potential für Missverständnisse und Konflikte, beispielsweise im Kontext religiöser Praktiken wie der Vollverschleierung, erörtert. Anschließend wird der Begriff „Transkulturalität“ definiert als der Versuch, kulturelle Selbstverständlichkeiten im Kontext von Globalisierung und Migration in Frage zu stellen und über traditionelle Kulturbegriffe hinauszugehen. Der Abschnitt beleuchtet die Vernetzung von Kulturen durch Migration und Globalisierung und diskutiert die Unterschiede zwischen Transkulturalität, Multikulturalität und Interkulturalität.
Soziale Situation in Deutschland: (Anmerkung: Da der bereitgestellte Text keine explizite Beschreibung der sozialen Situation in Deutschland liefert, kann hier nur eine allgemeine Aussage getroffen werden.) Dieses Kapitel würde im vollständigen Text die soziale Situation in Deutschland hinsichtlich der Bevölkerung mit Migrationshintergrund beschreiben. Es würde statistische Daten, sozioökonomische Faktoren und gesellschaftliche Herausforderungen im Kontext der Integration von Migranten beleuchten.
Transkulturalität: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung und den Auswirkungen der Transkulturalität. Es analysiert beispielsweise den Roman "Unter deutschen Betten" von Justyna Polanska und untersucht die Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag sowie die transkulturellen Herausforderungen im schulischen Bereich. Die verschiedenen Unterkapitel würden konkrete Beispiele und Fallstudien liefern, die die Komplexität des Themas verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Transkulturalität, Interkulturalität, Migration, Globalisierung, Kultur, Integration, Bildung, Sozialisation, Migrationsgesellschaft, kulturelle Vielfalt, Identität, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Transkulturalität in der deutschen Migrationsgesellschaft
Was ist der Inhalt des Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Transkulturalität in Deutschland. Er enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen von Interkulturalität und Transkulturalität auf Bildung und Sozialisation in der deutschen Migrationsgesellschaft. Der Text definiert die Begriffe „Kultur“ und „Transkulturalität“ und beleuchtet die soziale Situation von Migranten in Deutschland, die Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag sowie die Herausforderungen im Bildungssystem.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von kulturellen Begrifflichkeiten (inkl. Definition von Kultur und Transkulturalität), Soziale Situation in Deutschland, Transkulturalität (mit Unterkapiteln zu "Unter deutschen Betten", Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag und transkulturellen Auswirkungen im schulischen Bereich) und Fazit (nicht explizit im Preview aufgeführt, aber impliziert).
Was sind die zentralen Themen des Textes?
Die zentralen Themen sind die Definition und Abgrenzung von Kultur und Transkulturalität, die soziale Situation von Migranten in Deutschland, die Vereinbarkeit von Transkulturalität und Alltag, transkulturelle Herausforderungen im Bildungssystem und die Entwicklung einer Globalkultur durch Globalisierung und Migration. Der Text untersucht, wie diese Themen miteinander verwoben sind und welche Auswirkungen sie auf die deutsche Gesellschaft haben.
Wie werden Kultur und Transkulturalität definiert?
„Kultur“ wird als die Gesamtheit geteilter Verhaltensweisen, Vorstellungen, Einstellungen, Werte und Traditionen innerhalb einer Menschengruppe definiert. „Transkulturalität“ wird als der Versuch beschrieben, kulturelle Selbstverständlichkeiten im Kontext von Globalisierung und Migration in Frage zu stellen und über traditionelle Kulturbegriffe hinauszugehen. Der Text hebt die Unterschiede zwischen Transkulturalität, Multikulturalität und Interkulturalität hervor.
Welche Rolle spielt der Roman „Unter deutschen Betten“?
Der Roman „Unter deutschen Betten“ von Justyna Polanska dient als Beispiel im Kapitel über Transkulturalität, um die praktische Umsetzung und Auswirkungen von Transkulturalität zu veranschaulichen. Der Text analysiert, wie der Roman die Komplexität des Themas verdeutlicht.
Welche Aspekte der sozialen Situation in Deutschland werden behandelt?
Der Text kündigt an, die soziale Situation in Deutschland hinsichtlich der Bevölkerung mit Migrationshintergrund zu beschreiben, inklusive statistischer Daten, sozioökonomischer Faktoren und gesellschaftlicher Herausforderungen im Kontext der Integration von Migranten. Im vorliegenden Preview werden diese Aspekte jedoch nicht detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für den Text?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Transkulturalität, Interkulturalität, Migration, Globalisierung, Kultur, Integration, Bildung, Sozialisation, Migrationsgesellschaft, kulturelle Vielfalt und Identität.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text richtet sich an Leser, die sich akademisch mit dem Thema Transkulturalität in der deutschen Migrationsgesellschaft auseinandersetzen möchten. Die Sprache und der Aufbau deuten auf eine wissenschaftliche oder universitäre Zielgruppe hin.
- Arbeit zitieren
- Linda Wieczorek (Autor:in), 2018, Interkulturalität und Transkulturalität. Auswirkung auf Bildung und Sozialisation innerhalb der Migrationsgesellschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951156