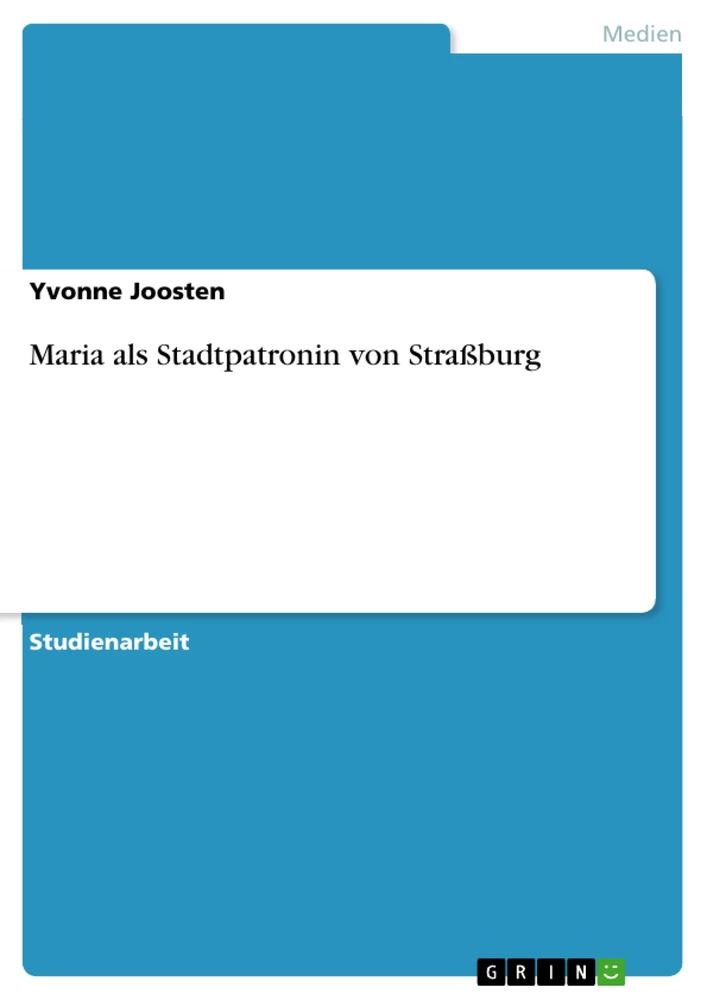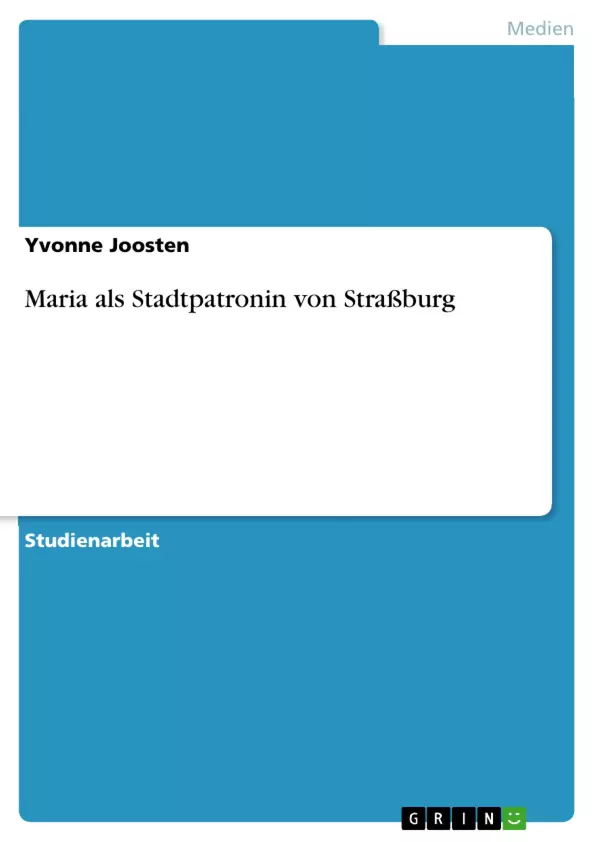Maria war vom 13. Jahrhundert bis Anfang des 16. Jahrhunderts die Stadtpatronin von Straßburg. Die Bürger der Stadt wählten sie zur Schutzherrin, um sich von der Herrschaft des Straßburger Bischofs zu befreien. Im Mittelpunkt des Ringens um bürgerliche Autonomie stand das Liebfrauenmünster. Indem die bischöfliche Marienkirche symbolisch durch den Marienaltar in eine Bürgerkirche umgewandelt wurde, glückte die kommunale Umformulierung ehemals geistlicher Sinnangebote.
Mit der Übernahme der Bauverwaltung und der Gründung des dem Altar angeschlossenen Liebfrauenwerks flossen dem Stadtrat genügend Gelder zu, um die Geschicke der Stadt und den Bau der Kirche weitgehend bestimmen zu können.
Mit der Marienkirche als Ort der Identifikation und Integration hatte sich der Stadtrat des Konsenses und der Loyalität der Bürger versichert. Indem das Marienbild auf den Herrschaftszeichen der Stadtgemeine – Siegel, Münzen, Stadtrechtsdruck und Heerfahne – abgebildet wurde, nutzten und verstärkten die städtischen Führungsgruppen die verbindende Kraft des Marienkults.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Straßburger Stadtpatrozinium Marias anhand der zentralen Elemente der Marienverehrung wie Marienstatue, Stadtsiegel und Münzen, Stadtrechtsdruck, Stadtbanner und dem Marienzyklus am Südquerhausportal unter Einbeziehung der wichtigsten geschichtlichen Ereignisse der besprochenen Zeit, die Straßburg und das Münster betreffen, zu veranschaulichen und außerdem an ihnen die Bedingungen, die zur kommunalen Umformulierung führten, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Straßburg
- 3. Das Straßburger Münster
- 4. Maria als Stadtpatronin von Straßburg
- 4.1. Marienstatue im Münster mit Marienaltar und -kapelle
- 4.2. Stadtsiegel und Münzen
- 4.3. Stadtrechtsdruck, Stadtbanner
- 4.4. Der Marienzyklus am Südquerhausportal des Straßburger Münsters
- 5. Mit Maria von der Bischofsstadt zur Bürgerstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Straßburger Stadtpatrozinium Marias im Kontext der städtischen Autonomiebestrebungen im Mittelalter. Sie analysiert die Rolle Marias als Symbol der städtischen Identität und Integration und beleuchtet die Strategien der städtischen Führungsgruppen, den Marienkult für ihre politischen Ziele zu nutzen.
- Die Entwicklung des Straßburger Stadtpatroziniums Marias
- Die Bedeutung des Liebfrauenmünsters für die städtische Identität
- Der Einsatz von Marienbildern auf städtischen Herrschaftszeichen
- Der Kampf der Straßburger Bürger um Autonomie vom Bischof
- Die Rolle des Marienkults im Prozess der kommunalen Umformulierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These vor: Maria fungierte vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert als Stadtpatronin Straßburgs, wobei der Marienkult entscheidend für den Kampf der Bürger um Unabhängigkeit vom Bischof und die Etablierung städtischer Autonomie war. Der Fokus liegt auf der symbolischen Umdeutung der bischöflichen Marienkirche in eine Bürgerkirche durch den Marienaltar und die damit verbundene Aneignung von Macht und Ressourcen durch den Stadtrat. Die Nutzung des Marienkults zur Konsolidierung der städtischen Identität und des Gemeinschaftsgefühls wird als zentrales Element der Argumentation hervorgehoben.
2. Straßburg: Dieses Kapitel gibt einen kurzen historischen Überblick über Straßburg, von der römischen Gründung als Argentoratum bis zur Entwicklung zur Freien Kaiserstadt im 14. Jahrhundert. Es beschreibt die geographische Lage der Stadt an der Ill und betont ihre mehr als 2000-jährige Geschichte. Die Erlangung politischer Rechte im 13. Jahrhundert und der anschließende wirtschaftliche Aufschwung werden erwähnt, wobei der Kampf der Bürger gegen den Klerus als wichtiger Kontext für das Verständnis des Stadtpatroziniums Marias dargestellt wird.
3. Das Straßburger Münster: Das Kapitel beschreibt die Baugeschichte des Straßburger Münsters, beginnend mit dem Bau eines dreischiffigen ottonischen Münsters im Jahr 1015. Der Bau des Südquerhauses um 1220, die Fertigstellung des Langhauses 1275 und der Bau der Westfassade ab 1277 werden detailliert beschrieben. Die Amtszeit des Bischofs Walter von Geroldseck und seine Konfrontation mit den Autonomiebestrebungen der Bürger werden im Kontext der Münsterbaugeschichte beleuchtet, was die komplexen Machtverhältnisse zwischen Bischof und Bürgern verdeutlicht. Der Bau des Münsters wird somit als Schauplatz und Symbol des Machtstreits dargestellt.
4. Maria als Stadtpatronin von Straßburg: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Marienverehrung in Straßburg und deren Bedeutung für die städtische Identität. Es untersucht die Marienstatue im Münster, den Marienaltar und die Marienkapelle als zentrale Elemente des Marienkults. Die Abbildung Marias auf Stadtsiegeln, Münzen, dem Stadtrechtsdruck und dem Stadtbanner verdeutlicht die strategische Nutzung des Marienkults durch die städtischen Führungsgruppen zur Stärkung der kommunalen Identität und zur Legitimation ihrer Herrschaft. Der Marienzyklus am Südquerhausportal wird als weiteres Beispiel für die Verknüpfung von Religion und städtischer Politik dargestellt.
5. Mit Maria von der Bischofsstadt zur Bürgerstadt: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und verdeutlicht, wie die Bürger Straßburgs den Marienkult für ihre politischen Ziele nutzten, um sich von der bischöflichen Herrschaft zu befreien und die eigene städtische Autonomie zu etablieren. Es betont die Rolle des Liebfrauenmünsters als Ort der Identifikation und Integration der Bürgerschaft und die symbolische Umwandlung der bischöflichen Marienkirche in eine Bürgerkirche.
Schlüsselwörter
Straßburg, Maria, Stadtpatrozinium, Marienkult, Mittelalter, Stadtautonomie, Bischof, Bürger, Liebfrauenmünster, Stadtsiegel, Münzen, Stadtrechtsdruck, Stadtbanner, Marienzyklus, kommunale Umformulierung, politische Identität, kulturelles Gedächtnis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Maria als Stadtpatronin von Straßburg"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle Marias als Stadtpatronin von Straßburg im Mittelalter und deren Bedeutung für den Kampf der Bürger um städtische Autonomie gegenüber dem Bischof. Sie analysiert, wie der Marienkult strategisch genutzt wurde, um die städtische Identität zu stärken und die politische Unabhängigkeit zu erreichen.
Welche Aspekte des Marienkults werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Manifestationen des Marienkults in Straßburg, darunter die Marienstatue im Münster, den Marienaltar und die Marienkapelle. Sie untersucht auch die Darstellung Marias auf Stadtsiegeln, Münzen, dem Stadtrechtsdruck und dem Stadtbanner. Der Marienzyklus am Südquerhausportal des Münsters wird ebenfalls analysiert.
Welche Bedeutung hat das Straßburger Münster in der Arbeit?
Das Straßburger Münster spielt eine zentrale Rolle, da es als Schauplatz des Machtstreits zwischen Bischof und Bürgern und als Symbol der städtischen Identität fungiert. Die Arbeit untersucht die symbolische Umdeutung der bischöflichen Marienkirche in eine Bürgerkirche durch den Marienaltar und die Aneignung von Macht und Ressourcen durch den Stadtrat.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Marienkult und städtischer Autonomie dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass der Marienkult ein entscheidendes Element im Kampf der Straßburger Bürger um Autonomie vom Bischof war. Die strategische Nutzung des Marienkults diente der Stärkung der kommunalen Identität und der Legitimation der Herrschaft des Stadtrats. Die Umwandlung der bischöflichen Marienkirche in eine Bürgerkirche symbolisiert diesen Prozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die These und den Fokus der Arbeit vor; Kapitel 2 (Straßburg) gibt einen historischen Überblick über die Stadt; Kapitel 3 (Das Straßburger Münster) beschreibt die Baugeschichte des Münsters; Kapitel 4 (Maria als Stadtpatronin von Straßburg) analysiert verschiedene Aspekte der Marienverehrung; Kapitel 5 (Mit Maria von der Bischofsstadt zur Bürgerstadt) fasst die Ergebnisse zusammen und verdeutlicht die Nutzung des Marienkults für politische Ziele.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Straßburg, Maria, Stadtpatrozinium, Marienkult, Mittelalter, Stadtautonomie, Bischof, Bürger, Liebfrauenmünster, Stadtsiegel, Münzen, Stadtrechtsdruck, Stadtbanner, Marienzyklus, kommunale Umformulierung, politische Identität, kulturelles Gedächtnis.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studierende im Bereich der mittelalterlichen Geschichte, der Religionsgeschichte und der Stadtgeschichte gedacht. Sie ist aufgrund ihrer strukturierten und professionellen Analyse von Themen besonders für akademische Zwecke geeignet.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses Dokument stellt lediglich eine Zusammenfassung und einen Überblick über die Arbeit dar.
- Quote paper
- Yvonne Joosten (Author), 2012, Maria als Stadtpatronin von Straßburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951352