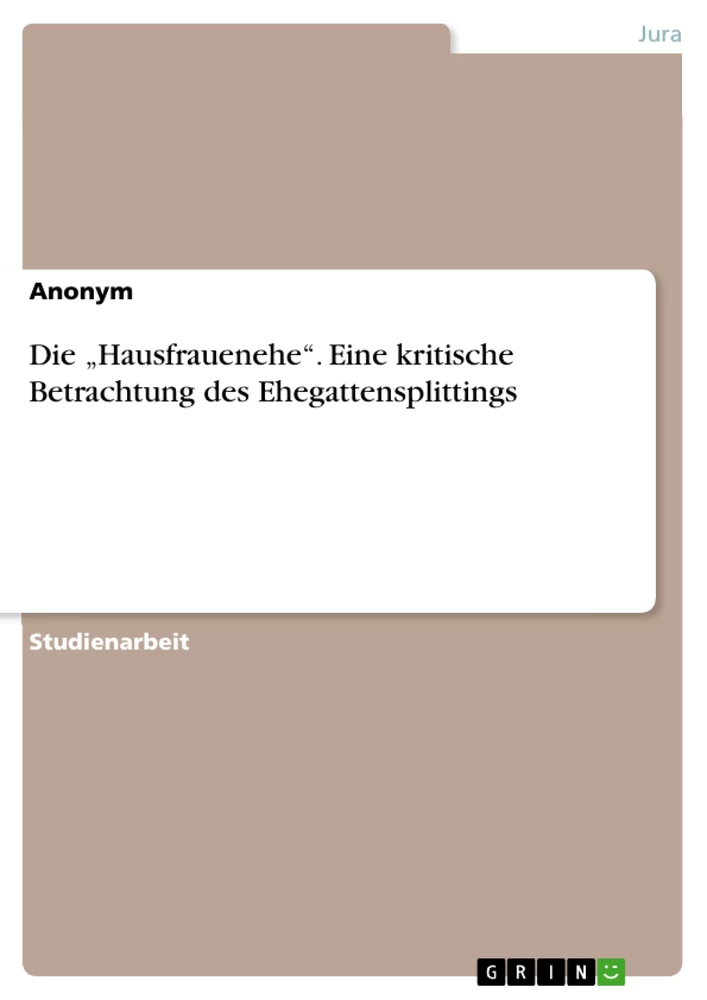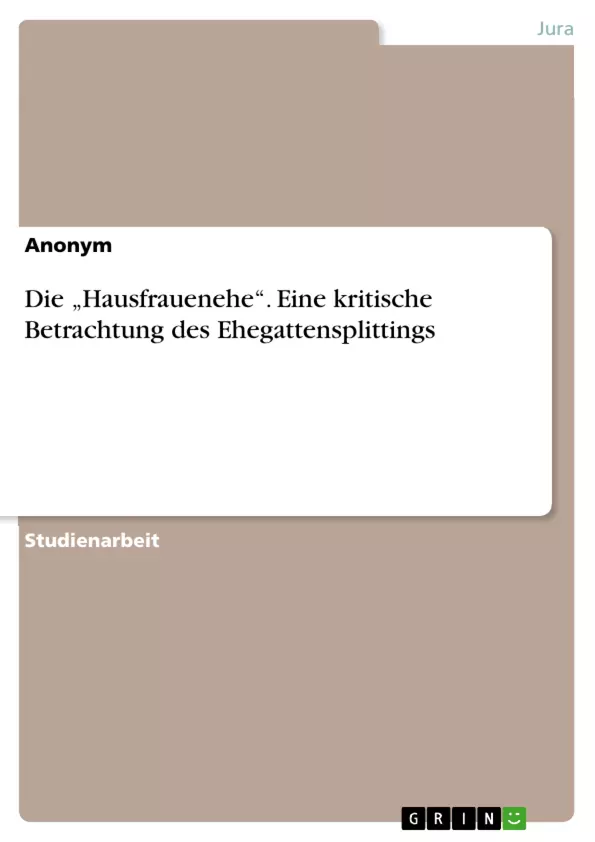Die Arbeit beantwortet die Frage, warum die „Hausfrauenehe“ überhaupt als Voraussetzung für das Ehegattensplitting gesehen wird. Schon lange gibt es immer wieder Debatten über Änderungen und Alternativen des seit fast 60 Jahren erhaltene Ehegattensplitting. Eines der Argumente gegen das Ehegattensplitting ist die Förderung der Alleinverdiener-Ehe, auch umgangssprachlich „Hausfrauenehe“ genannt. Dadurch wird auch ein Fehlanreiz für Frauen gesetzt, der signalisiert, dass ihre Erwerbstätigkeit sich weniger lohne als die des Ehemannes. Genau mit diesen zwei Kritikpunkten, das vorgegebene Rollenmodell und der Fehlanreiz zur Nichterwerbstätigkeit der Ehefrau, setzt sich die vorliegende Arbeit kritisch auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Ehegattensplitting
- Die Zusammenveranlagung von Ehegatten
- Beschluss des Bundestages am 17. 01. 1957
- Das Splittingverfahren nach §§26, 26b, 32a EstG
- Der Splittingeffekt
- Rechenbeispiele
- Diskussion über das Profitieren am Ehegattensplitting durch die „Hausfrauenehe“
- Das vorgesehene Rollenmodell
- Folgen für die Erwerbstätigkeit der Ehefrau
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert kritisch das Ehegattensplitting und seine Auswirkungen auf die sogenannte „Hausfrauenehe“. Dabei wird untersucht, ob das Ehegattensplitting ein traditionelles Rollenmodell fördert und Frauen von der Erwerbstätigkeit abhält.
- Analyse des Ehegattensplittings und seiner historischen Entwicklung
- Kritik am Ehegattensplitting als Instrument zur Förderung der „Hausfrauenehe“
- Beurteilung der Auswirkungen des Ehegattensplittings auf die Erwerbstätigkeit von Frauen
- Diskussion des Spannungsfelds zwischen traditionellem Rollenmodell und moderner Gleichstellung
- Bewertung des Ehegattensplittings im Kontext der Steuergerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Ehegattensplittings ein und stellt die Relevanz der Arbeit im Kontext aktueller politischer Debatten dar. Sie skizziert die Problematik der „Hausfrauenehe“ und die Kritikpunkte, die in der vorliegenden Arbeit im Fokus stehen.
- Das Ehegattensplitting: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Ehegattensplittings und erläutert das Splittingverfahren nach §§26, 26b, 32a EStG. Es analysiert den „Splittingeffekt“ und die damit verbundenen finanziellen Vorteile für bestimmte Ehemodelle. Rechenbeispiele sollen das Verständnis des Splittingverfahrens und seine Auswirkungen auf unterschiedliche Einkommensverhältnisse verdeutlichen.
- Diskussion über das Profitieren am Ehegattensplitting durch die „Hausfrauenehe“: Dieses Kapitel untersucht das Ehegattensplitting im Hinblick auf seine Auswirkungen auf das Rollenmodell in der Ehe. Es analysiert die Verbindung zwischen dem Ehegattensplitting und der „Hausfrauenehe“ sowie die Folgen für die Erwerbstätigkeit der Ehefrau.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen des Ehegattensplittings, der „Hausfrauenehe“, dem Rollenmodell in der Ehe, der Erwerbstätigkeit von Frauen, dem Steuerrecht und der Steuergerechtigkeit. Sie analysiert die Auswirkungen des Ehegattensplittings auf die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Bedeutung des traditionellen Rollenverständnisses im Kontext des modernen Steuerrechts.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter dem Begriff „Hausfrauenehe“ verstanden?
Umgangssprachlich bezeichnet die „Hausfrauenehe“ ein Ehemodell, bei dem ein Partner (meist der Ehemann) das Familieneinkommen allein erwirtschaftet, während der andere Partner (meist die Ehefrau) nicht erwerbstätig ist.
Warum steht das Ehegattensplitting in der Kritik?
Kritiker argumentieren, dass das Ehegattensplitting die Alleinverdiener-Ehe fördert und Fehlanreize für Frauen setzt, da sich deren eigene Erwerbstätigkeit finanziell oft weniger lohnt.
Was ist der sogenannte Splittingeffekt?
Der Splittingeffekt bezeichnet den steuerlichen Vorteil, der durch die Zusammenveranlagung von Ehegatten entsteht, insbesondere wenn die Einkommen der Partner weit auseinanderliegen.
Welche gesetzlichen Grundlagen regeln das Splittingverfahren?
Das Splittingverfahren ist im Einkommensteuergesetz (EStG) in den Paragrafen §§ 26, 26b und 32a verankert.
Seit wann existiert das Ehegattensplitting in Deutschland?
Das Ehegattensplitting wurde am 17. Januar 1957 durch einen Beschluss des Bundestages eingeführt und besteht seit fast 60 Jahren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Die „Hausfrauenehe“. Eine kritische Betrachtung des Ehegattensplittings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/951792