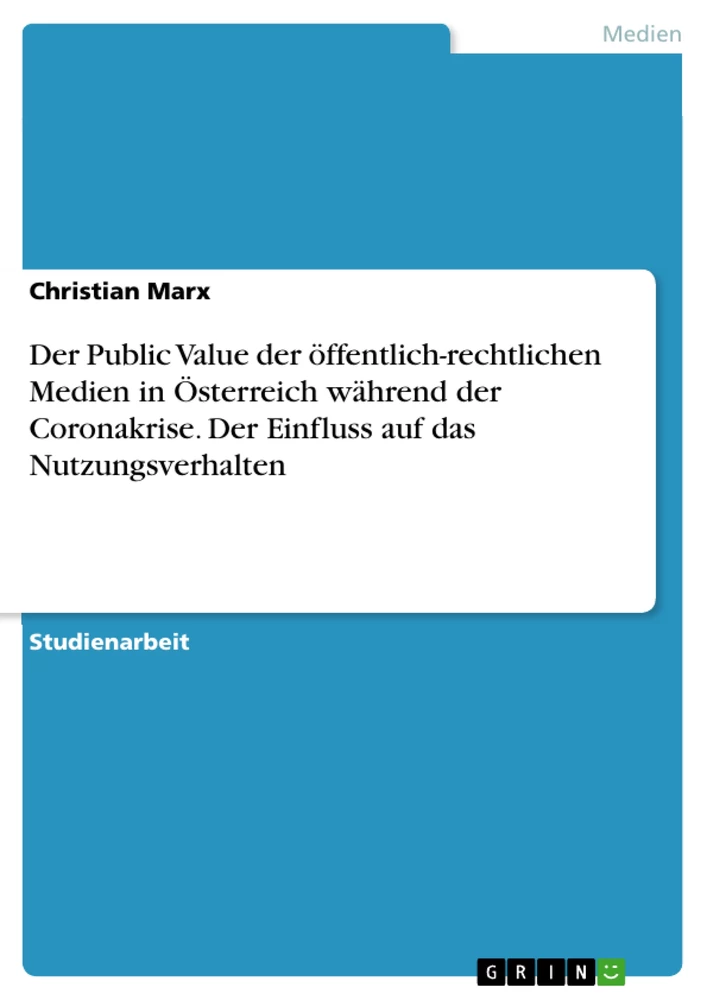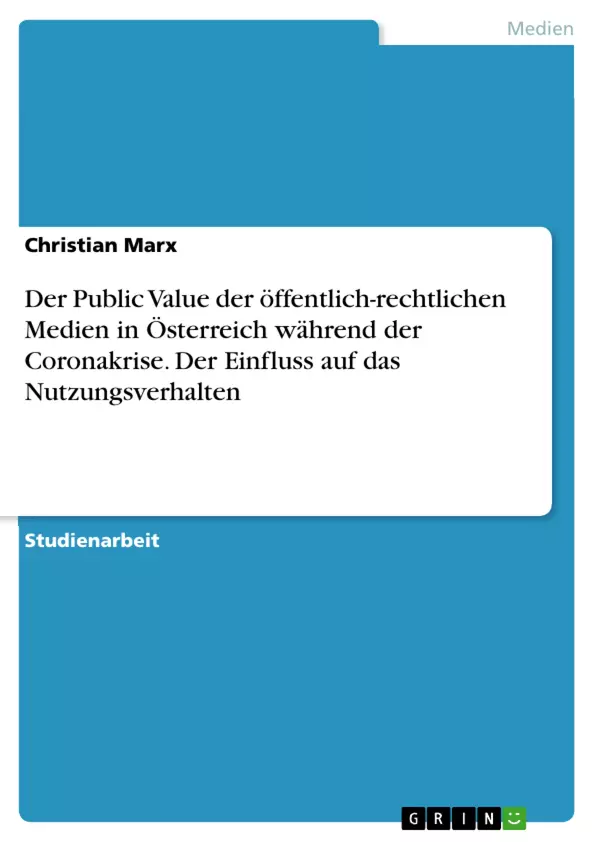Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Mediennutzungsverhalten in der Coronakrise in Österreich mithilfe empirischer, qualitativer Interviews zu beleuchten. Es ist sowohl für die Gesellschaft als solches, aber auch für die sendenden Medienanstalten wichtig zu wissen, wie sich das Mediennutzungsverhalten in Krisenzeiten, besonders im aktuellen Aspekt der Coronakrise äußert. Dabei ist dies für die zukünftige strategische Ausrichtung als auch der Programmplanung unumgänglich. Daraus soll der Nutzen gezogen werden, dass mit der Beantwortung der folgend gestellten Forschungsfrage mögliche Perspektiven für Public Value in der Zeit nach Krise herausgearbeitet werden: Inwiefern beeinflusst die Coronakrise das Mediennutzungsverhalten von öffentlich-rechtlichen Inhalten in Österreich?
Daraus resultiert die Subforschungsfrage: Welche Finanzierungsmethoden für Medieninhalte werden bevorzugt?
Als Methode zur Beantwortung der gestellten Forschungsfragen wurde die Form von qualitativen Interviews gewählt. Zusätzlich sollen die aus den Interviews gewonnen Erkenntnisse anhand einer Literaturarbeit theoretisch verortet werden. Ein genauer Überblick über die Erhebung wird in weiterer Folge in Punkt fünf gegeben.
Gerade in Zeiten wie diesen, inmitten der COVID19-Pandemie, weltweiten Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen scheint eine unabhängige, freie Berichterstattung wichtiger als je zuvor. Im März 2018 stimmten die Schweizerinnen und Schweizer im Rahmen einer Volksabstimmung darüber ab, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk SRG und in weiterer Folge seine Finanzierung abgeschafft werden soll. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese Diskussion auch über Deutschland und Österreich bzw. intensivierte Diese.
Noch nicht allzu lange ist es her, als sich ein österreichischer Politiker, damals noch Mitglieder der amtierenden Bundesregierung, mit einem öffentlich-rechtlichen Journalisten ein breites, mediales Gefecht lieferte. Der Streit endete vor Gericht: Damit ist die Debatte über die Inhalte und die Notwendigkeit eines öffentlich-rechtlichen Senders und der Public Value auch wieder in der breiten Masse in Österreich angekommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung in das Forschungsproblem
- 3. Forschungsziel
- 3.1 Forschungsfragen
- 4. Agenda Setting & Public Value
- 4.1 Agenda Setting Ansatz
- 4.1.1 Medienagenda vs. Publikumsagenda
- 4.2 Wirkungsverläufe in der Medienwirkungsforschung
- 4.2.1 Kumulationsmodell
- 4.1 Agenda Setting Ansatz
- 5. Methodik & Auswertung
- 5.1 Interviews, Setting & Auswertung
- 5.2 Ergebnisse der Analyse
- 5.3 Resümee
- 6. Beantwortung der Forschungsfragen
- 7.1 Ausblick
- 8. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Medienagenda von österreichischen, öffentlich-rechtlichen Medien in Bezug auf die COVID-19 Pandemie. Sie untersucht, wie die Medieninhalte diese Krise abbilden und welche Rolle der Public Value für die Rezipientinnen und Rezipienten spielt. Die Studie befasst sich auch mit der persönlichen Einschätzung der Berichtungsqualität der Medien.
- Medienagenda und Public Value in der Coronakrise
- Medienwirkung und Agenda Setting Ansatz
- Analyse der Publikumsagenda durch leitfadengestützte Interviews
- Bedeutung des ORF als öffentlich-rechtlicher Sender
- Perspektiven für weiterführende Forschung in diesem Themengebiet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz einer unabhängigen und freien Berichterstattung in Krisenzeiten heraus und beleuchtet die aktuelle Debatte über die Notwendigkeit öffentlich-rechtlicher Sender im Kontext der COVID-19 Pandemie. Kapitel 2 definiert den Begriff Public Value und die Rolle des ORF als Stiftung des öffentlichen Rechts. Kapitel 4 erläutert den Agenda Setting Ansatz und die Unterscheidung zwischen Medienagenda und Publikumsagenda. Kapitel 5 beschreibt die Methodik und Auswertung der Studie, inklusive der Analyse leitfadengestützter Interviews. Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 5.2 präsentiert, während Kapitel 5.3 ein Resümee der Ergebnisse bietet. Kapitel 6 befasst sich mit der Beantwortung der Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Public Value, Öffentlich-rechtliche Medien, Österreich, COVID-19 Pandemie, Medienagenda, Publikumsagenda, Agenda Setting, Medienwirkungsforschung, ORF, Interviewanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste die Coronakrise die Mediennutzung in Österreich?
Die Arbeit untersucht mittels qualitativer Interviews, inwiefern die Krise das Interesse an öffentlich-rechtlichen Inhalten und die Bewertung der Berichterstattungsqualität verändert hat.
Was bedeutet "Public Value" im Zusammenhang mit dem ORF?
Public Value bezeichnet den gesellschaftlichen Mehrwert, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch unabhängige Information und Bildungsaufträge erbringt.
Was ist der "Agenda Setting"-Ansatz?
Dieser Ansatz beschreibt, wie Medien durch die Auswahl von Themen beeinflussen, welche Probleme die Öffentlichkeit als besonders wichtig wahrnimmt (Medienagenda vs. Publikumsagenda).
Warum ist die Finanzierungsdebatte der Medien in der Arbeit relevant?
In Krisenzeiten wird die Notwendigkeit und Finanzierung unabhängiger Medien wie des ORF oder der Schweizer SRG verstärkt öffentlich diskutiert.
Welche Methode wurde für die Untersuchung gewählt?
Die Forschungsfragen wurden durch leitfadengestützte qualitative Interviews beantwortet und theoretisch in die Medienwirkungsforschung eingebettet.
- Quote paper
- Christian Marx (Author), 2020, Der Public Value der öffentlich-rechtlichen Medien in Österreich während der Coronakrise. Der Einfluss auf das Nutzungsverhalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/952080