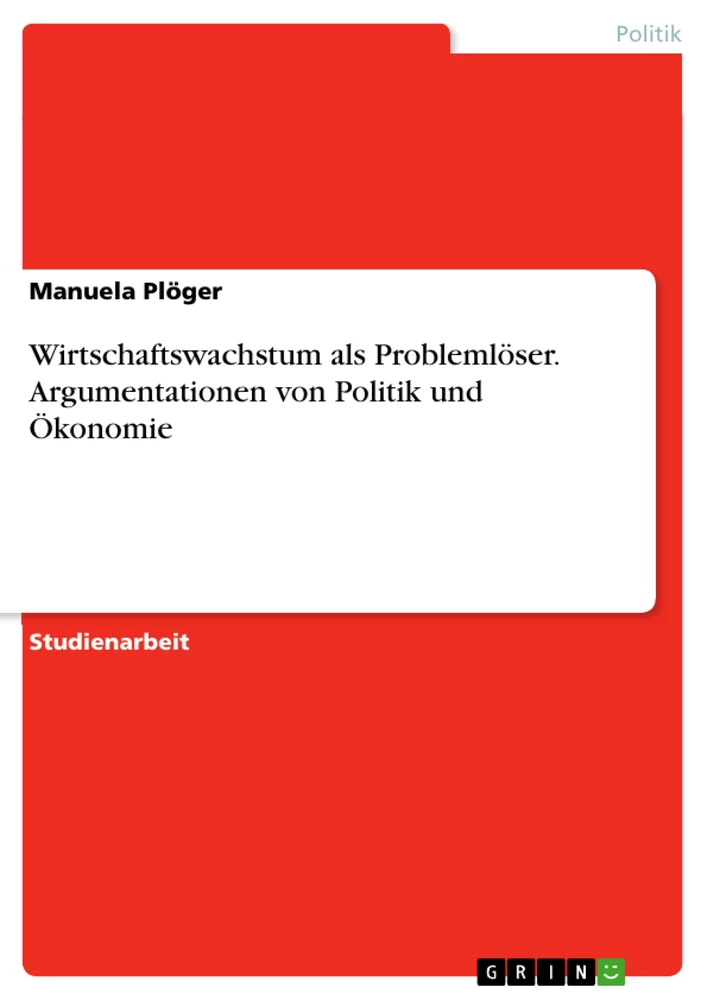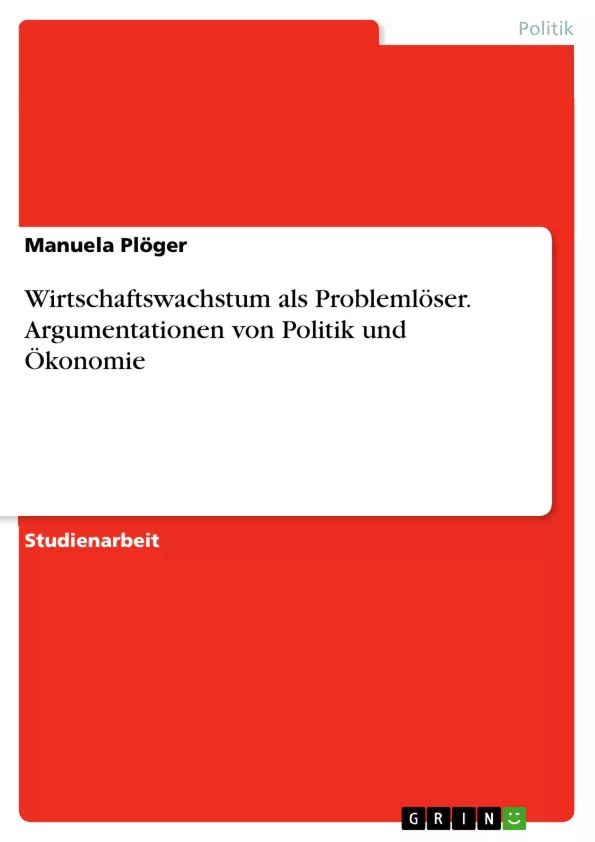In der Arbeit sollen die aus Sicht der Politik und Ökonomie relevanten Begründungen für Wirtschaftswachstum herausgearbeitet werden. Es soll untersucht werden, inwieweit die Lösung grundlegender Probleme nur auf Basis des Wirtschaftswachstums möglich ist und ob die damit zusammenhängenden Versprechen auch eingelöst werden. Damit verbunden ist auch die Frage nach der Plausibilität der angenommenen Zusammenhänge und somit auch nach der Legitimität des Wachstumsglaubens.
Zu Beginn der Arbeit wird zunächst Wirtschaftswachstum definiert und beschrieben, wie es gemessen wird. Da Wachstum und Wohlstandssteigerung oft zusammen gedacht werden, folgt anschließend eine Auseinandersetzung mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) als geeigneten Wirtschafts- und Wohlstandsindikator. Dabei wird der Frage nachgegangen, was die Wirtschaftsleistung eines Landes über den Wohlstand der Menschen aussagen kann und was nicht. In dem Zusammenhang werden einige Kritikpunkte herausgearbeitet, warum eine Gleichsetzung von Wachstum und Wohlstand problematisch ist.
Im Anschluss daran wird knapp die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands seit Beginn der Industrialisierung umrissen, um einerseits die gegenwärtige Lage besser einordnen zu können und andererseits, um die im dritten Kapitel dargestellten Argumente für die Notwendigkeit des Wirtschaftswachstums und Wachstumsbegründungen besser nachvollziehen zu können. Den verschiedenen Gründen, die aus Sicht von Wachstumsbefürworter*innen für weiteres Wachstum angeführt werden, werden Argumente und empirische Belege, die aus Sicht der Kritiker*innen dagegen sprechen, gegenübergestellt, bevor zum Abschluss ein Fazit gezogen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftswachstum: Das BIP
- Das BIP als Wachstums- und Wohlstandsindikator
- Entwicklung des Wirtschaftswachstums und aktuelle Trends in Deutschland
- Wachstumsbegründungen
- Wachstum schafft Wohlstand
- Wachstum schafft sozialen Frieden
- Wachstum schafft Arbeitsplätze
- Wachstum verringert Staatsschulden
- Wachstum kann die ökologische Krise aufhalten
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die aus Sicht von Politik und Ökonomie relevanten Begründungen für Wirtschaftswachstum. Sie analysiert, inwiefern die Lösung grundlegender Probleme nur auf Basis des Wirtschaftswachstums möglich ist und ob die damit verbundenen Versprechen auch eingelöst werden. Außerdem wird die Plausibilität der angenommenen Zusammenhänge und die Legitimität des Wachstumsglaubens hinterfragt.
- Definition und Messung von Wirtschaftswachstum
- Kritik am BIP als Wohlstandsindikator
- Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Deutschland
- Begründungen für Wachstum und Kritik an den Argumenten
- Bewertung der Effektivität von Wirtschaftswachstum als Problemlöser
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit behandelt die Bedeutung des Wirtschaftswachstums als Ziel der Wirtschaftspolitik und hinterfragt die Annahme, dass Wachstum ein universeller Wert ist und als Problemlöser dient.
Wirtschaftswachstum: Das BIP
Dieses Kapitel definiert Wirtschaftswachstum und erklärt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Messgröße der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Es wird die Problematik der Gleichsetzung von Wachstum und Wohlstand beleuchtet.
Wachstumsbegründungen
Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Argumenten für die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum aus Sicht von Politik und Ökonomie. Die Argumente für und gegen Wachstum werden gegenübergestellt.
Fazit und Ausblick
Dieses Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Wachstumsdiskurses.
Schlüsselwörter
Wirtschaftswachstum, BIP, Wohlstand, sozialer Frieden, Arbeitsplätze, Staatsschulden, ökologische Krise, Wachstumskrise, Produktivitätskrise, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, säkulare Stagnation.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das BIP als Wohlstandsindikator kritisiert?
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst nur die Marktleistung, lässt aber Aspekte wie Lebensqualität, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit weitgehend unberücksichtigt.
Kann Wirtschaftswachstum den sozialen Frieden sichern?
Wachstumsbefürworter argumentieren, dass Wachstum Verteilungskonflikte entschärft. Kritiker bezweifeln jedoch, dass die Versprechen von Wohlstand für alle in der Realität eingelöst werden.
Welche Rolle spielt Wachstum für den Arbeitsmarkt?
Traditionell gilt Wachstum als Motor für neue Arbeitsplätze. Die Arbeit untersucht jedoch auch Phänomene wie die Produktivitätskrise, die diesen Zusammenhang in Frage stellen.
Ist ökologisches Wachstum möglich?
Es wird diskutiert, ob technischer Fortschritt und Wachstum die ökologische Krise aufhalten können oder ob der „Wachstumsglaube“ selbst Teil des Problems ist.
Was bedeutet „säkulare Stagnation“?
Dieser Begriff beschreibt eine Phase langanhaltenden, schwachen Wirtschaftswachstums in entwickelten Volkswirtschaften, die neue Herausforderungen für die Politik mit sich bringt.
- Quote paper
- Manuela Plöger (Author), 2017, Wirtschaftswachstum als Problemlöser. Argumentationen von Politik und Ökonomie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/952824