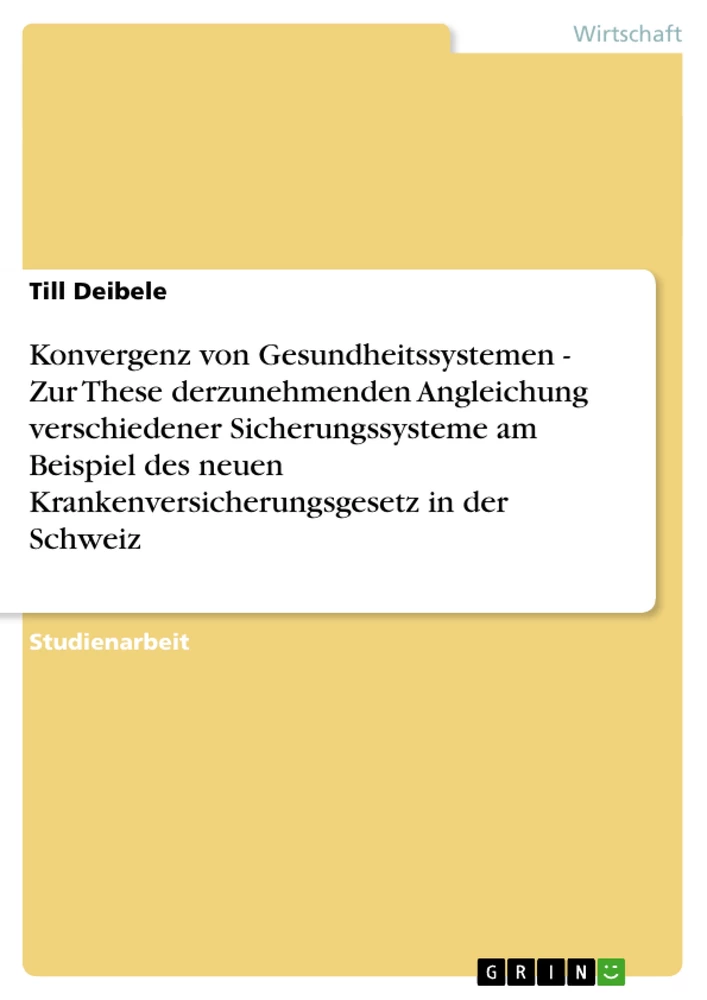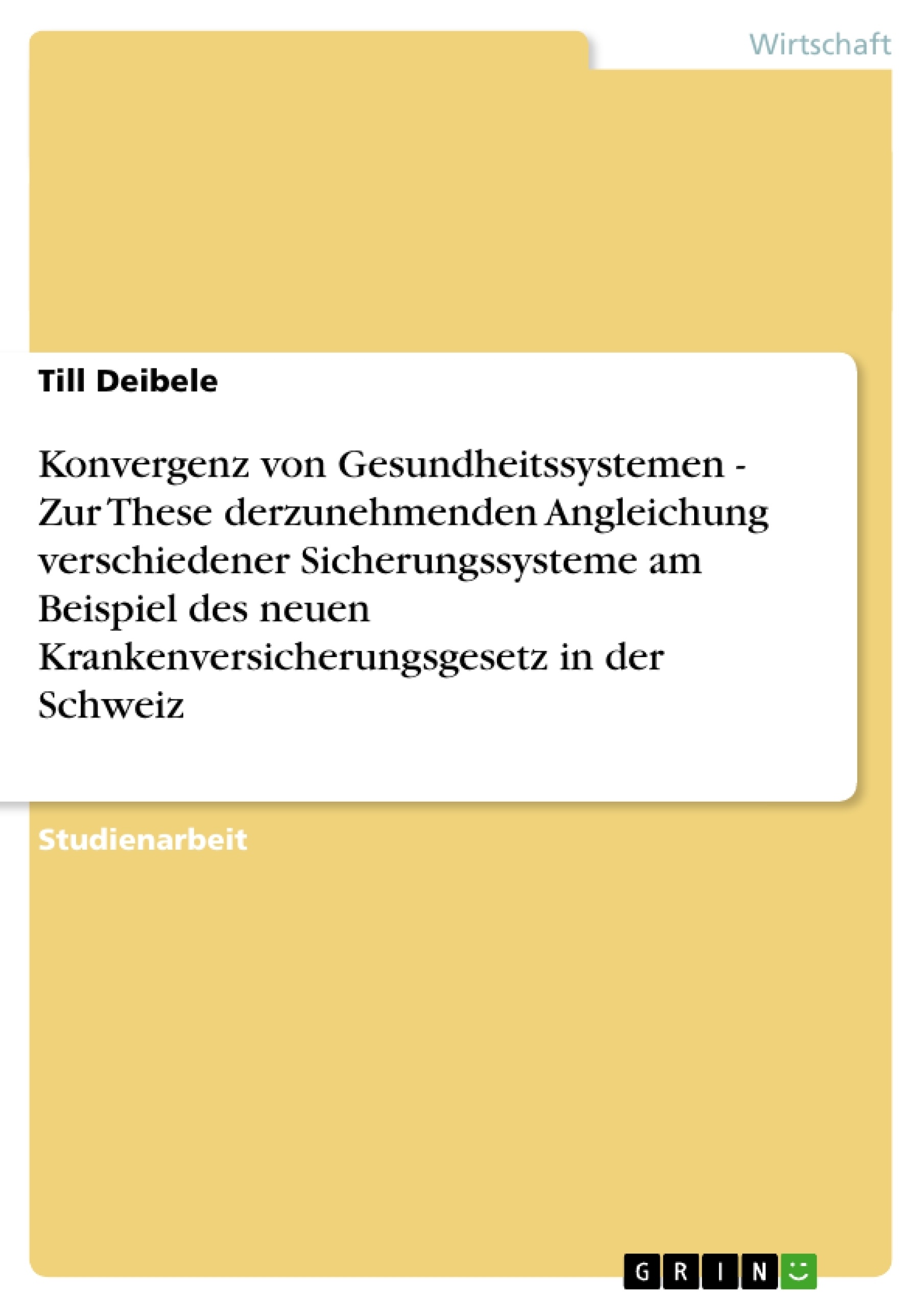Inhalt:
0 Einleitung
1 Krankenversicherung vor 1996 und die Schweizer Probleme
Die Teilrevision 1964
Kostenexplosion und Einnahmeerosion
2 Das neue KVG
Gleiche Versorgung
Solidarität
Konkurrenz
Managed Care
3 Managed Care
Organisationsstrukturen von Managed Care Organisationen
Managementtechniken von Managed Care Organisationen
Utilization Management
Gatekeepersysteme
Was ist neu an Managed Care?
4 Das neue KVG, ein Beleg für die Konvergenz der Systeme, und ein Schritt zu Managed Care?
Literatur
0 Einleitung
Alle westlichen Gesundheitssysteme haben Probleme bzw. es besteht in allen westlichen Staaten die Befürchtung, das Gesundheitswesen sei nicht zukunftssicher.
Wenn von Problemen des Gesundheitswesens gesprochen wird, bedeutet das immer die Befürchtung, das Gesundheitswesen könne seine Aufgabe nicht oder zukünftig nicht mehr erfüllen. In sämtlichen Diskursen über Gesundheitswesen stößt man früher oder später auf die mit mehr oder weniger Verve vorgebrachte Forderung, daß Gesundheitswesen solle eine umfassende, qualitativ hochstehende medizinische Versorgung für die gesamte Bevölkerung bei geringen Kosten sicherstellen. Die Befürchtungen gehen also entweder dahin, daß das Gesundheitswesen nicht mehr finanzierbar sei, oder dahin, daß es nicht mehr allen offenstehe.
Aufgrund der Einschätzung einer mit Variationen gleichen Problemlage in vielen Ländern, kommt die sozialpolitische Forschung dazu, system- oder ländervergleichend zu arbeiten und die politische Praxis kommt immer wieder auf die scheinbar heilbringende Idee, Systeme oder Verfahrensweisen aus anderen Ländern zu importieren.
Die sozialpolitische Forschung unterteilt drei Grundtypen der Organisation des Gesundheitswesens: Das Marktmodell, in dem Gesundheitsgüter (nahezu) wie alle anderen Güter behandelt werden und die Güterallokation über den Markt geschieht, das Sozialversicherungsmodell, bei dem eine Pflichtversicherung in Krankenkassen mit nicht risikoäquivalenten Beiträgen und einheitlichem Leistungskatalog besteht und das staatliche Modell, dessen Merkmale die Steuerfinanzierung, das Fehlen eines einheitlichen Leistungskatalogs und häufig das Verschmelzen von Leistungsanbietern und Finanziers sind (Schwartz/Busse 1997:1ff).
Diesen Modellen wiederum werden spezifische Stärken oder Schwächen bei der Erreichung des ersten oder zweiten Teilziels von Gesundheitspolitik zugeschrieben. Dies wiederum führt zur Adaption von Merkmalen des einen Typus in anderen Systemen, so daß die sozialpolitische Forschung vom Konvergieren zu einem Modell spricht (Schwartz/Busse 1997:1).
Die USA stehen vor dem gleichen Grundproblem wie viele andere westliche Staaten: Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP steigt immer mehr und etliche Millionen Amerikaner können sich die notwendige medizinische Versorgung nicht leisten. Die USA stehen also dort, wo alle anderen befürchten hinzukommen. Und dennoch meinen viele, in den USA den Hoffnungsschimmer zu sehen, auf den sie ein zukünftiges, leistungsfähiges, gerechtes und finanzierbares Gesundheitswesen bauen wollen.
Dieser Hoffnungsschimmer heißt Managed Care. Managed Care hat eine andere Form der Finanzierung und eine andere Form der Leistungserbringung, als z.B. das deutsche Sozialversicherungsmodell, und so hofft man mit Managed Care die deutschen Probleme der Kostenexplosion und der Unterfinanzierung (Absinken der Lohnquote) zu lösen.
Die Sinnhaftigkeit der Übernahme von Verfahrensweisen aus "Systemen mit unterschiedlichen internalisierten Normen" kann aber nicht allein am Erfolg des Verfahrens im ursprünglichen System ermessen werden. Es müssen auch die institutionellen Rahmenbedingungen in beiden Systemen bedacht werden, um die Erfolgschancen beurteilen zu können und eine Integration erfolgversprechend gestalten zu können (Milde 1992:2).
Sozialpolitische Maßnahmen zielen auf gesellschaftliche Verhältnisse, diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind in den westlichen Industriestaaten aber, insbesondere im Gesundheitswesen, schon stark durch frühere sozialpolitische Eingriffe geprägt. Sozialpolitik wird somit teilweise zu ihrem eigenen Gegenstand und sozialpolitische Maßnahmen müssen immer auch als Fortsetzung der Sozialpolitik angesehen werden (Kaufmann 1982:58f).
In dieser Arbeit möchte ich am Beispiel der Schweizer Reform des Gesundheitswesens durch das zum 1.1.1996 in Kraft getretene neue Krankenversicherungsrecht (KVG) die These von der Konvergenz der Gesundheitssysteme untersuchen und betrachten, wie in der Schweiz Managed Care Elemente in ein bisher in der Leistungserbringung und -vergütung am ehesten dem Marktmodell zuzurechnenden System eingefügt wurden.
Hierzu werde ich zunächst eine Darstellung des schweizerischen Systems der Gesundheitsfürsorge vor und nach dem 1.1.1996 vornehmen, dem werde ich ein Kapitel zu Managed Care folgen lassen, um abschließend die Veränderungen im schweizerischen Gesundheitswesen vor dem Hintergrund der Konvergenz der Systeme und speziell der Implementation von Managed Care zu reflektieren.
1 Krankenversicherung vor 1996 und die Schweizer Probleme
Als die schweizerische Bundesregierung sich zur Jahrhundertwende daran machte, eine bundeseinheitliche Regelung zur Krankenversicherung zu suchen, bestanden bereits zahlreiche freie Hilfskassen, die insgesamt 12,5% der Bevölkerung versicherten. Nicht zuletzt der Einfluß dieser Hilfskassen war es, der zur Ablehnung der "Lex Forrer" führte. Die "Lex Forrer" sah eine Pflichtversicherung nach deutschem Modell, mit behördlich eingerichteten Krankenkassen, lohnprozentualer Finanzierung und Arbeitgeberbeteiligung vor (Bernardi- Schenkluhn 1992:185). Die freien Hilfskassen gingen aus der Auseinandersetzung um die "Lex Forrer" gestärkt hervor und 1906 legte die Bundesregierung dann einen Gesetzentwurf vor, der den Hilfskassen deutlich mehr entgegenkam. Dieser bildete die Grundlage für das dann 1911 im Plebiszit verabschiedete "Kranken- und Unfallversicherungsgesetz" (KUVG).
Das KUVG implementierte kein neues System, sondern baute auf den bestehenden Hilfskassen auf. Es ließ die marktliche Koordination des Gesundheitswesens in ihren Grundzügen unangetastet, spannte aber einen ordnungspolitischen Rahmen auf, innerhalb dessen die Hilfskassen sich als anerkannte Krankenkassen registrieren lassen konnten und dadurch in den Genuß großzügiger Subventionen kamen.
Voraussetzungen für die Anerkennung als Krankenkasse nach KUVG war ein Mindestniveau an Leistungen, die nur gering eingeschränkte freie Arztwahl, die Freizügigkeit beim Kassenwechsel und die Gleichbehandlung von Mann und Frau.
Die Prämien für eine Krankenkasse in der Schweiz waren Pro-Kopf-Prämien und berechneten sich nach dem Eintrittsalter in die Kasse und dem Geschlecht.
Die Beiträge waren also nicht risikoäquivalent, wohl aber risikoorientiert. Nicht risikoäquivalent, da Vorerkrankungen sich nicht auf die Prämien auswirkten(1 ), und weil zur Prämienberechnung nicht das aktuelle Alter, sondern das Eintrittsalter in die Krankenkasse ausschlaggebend war. Risikoorientiert allerdings, da die Risikofaktoren Alter und Geschlecht zumindest teilweise in die Prämienberechnung einbezogen wurden.
Ein Solidarausgleich wurde in der Schweizerischen sogenannten sozialen Krankenversicherung nicht über die Beiträge, sondern über staatliche Subventionen, die an die Kassen nach Alter und Geschlecht ihres Mitgliederstamms vergeben wurden, erreicht (Bernardi-Schenkluhn 1992:185 & 196f).
Die Teilrevision 1964
Das KUVG blieb, was die Krankenversicherung (nicht die Unfallversicherung) betrifft, mit Ausnahme der Teilrevision von 1964, bis 1996 unverändert. Diese Teilrevision änderte aber nichts grundlegendes an der sozialen Krankenversicherung. So blieb z.B. die Frage des Bundesobligatoriums (Bundesweite Versicherungspflicht) ganz ausgeklammert.
Das System wurde mit der Teilrevision nicht geändert, aber es wurden einige Punkte präziser und verläßlicher gefaßt, als dies zuvor war. So wurde der staatliche Subventionsanteil an den Ausgaben der Kassen auf 30% festgeschrieben, was die Einnahmesituation der Kassen verbesserte, das Kostenerstattungsprinzip wurde zur Regel, die Sachleistung zur Ausnahme, die Selbstbeteiligung der Patienten wurde auf 10% festgesetzt, ebenso der maximale Prämienunterschied zwischen Männern und Frauen, so daß nun ein Solidarelement direkt in die Prämienberechnung Eingang fand. Eine Leistungsausweitung fand nur sehr eingeschränkt statt, indem die zeitliche Beschränkung der ambulanten Leistungen aufgehoben, und die der stationären ausgeweitet wurden, sowie durch die Zulassung von Chiropraktikern zur selbständigen Kassenpraxis, so daß deren Leistungen ohne die Überweisung eines Arztes in Anspruch genommen werden konnten (Bernardi-Schenkluhn 1992:188).
Kostenexplosion und Einnahmeerosion
Die Diskussion ums Gesundheitswesen ist in der BRD hauptsächlich eine Diskussion ums Geld. Seit Beginn der 70er Jahre wird von einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen gesprochen, die die Beitrage in die Höhe treibt. Auf diese Kostenexplosion wurde mit zahlreichen Kostendämpfungsgesetzen reagiert. Seit kurzem beginnt sich die Diskussion nicht mehr auf die Kostenexplosion, sondern auf die Einnahmeerosion durch Absinken der Lohnquote zu konzentrieren.
Die Diskussion um die Finanzen der Krankenversicherung bezieht sich auch in der Schweiz auf die Einnahmen- und Ausgabenseite.
Der Begriff der Kostenexplosion taucht hier schon früher als in der BRD auf, nämlich bereits Mitte der 60er Jahre, und trotz der Festsetzung der Subventionen zur sozialen Krankenversicherung auf 30% der Ausgaben durch die Teilrevision von 1964, und eine Einkommensunabhängige Pro-Kopf-Prämie sind auch auf der Einnahmeseite Probleme entstanden.
Für die Kostenexplosion in der Schweiz sind Gründe anzuführen, die auch in anderen Ländern und Systemen kostentreibend wirken. Medizinisch-technischer Fortschritt und zunehmende Alterung der Versicherten führen zu mehr und teureren Leistungen. Die Verdopplung der Ärztezahl führt in einem System mit Niederlassungsfreiheit und Einzelleistungsvergütung zu einer Leistungsexpansion (Cavalli 1998).
Die Erosion der Einnahmen hat in der Schweiz selbstverständlich andere Ursachen als in der BRD. In einem System mit lohnunabhängigen Prämien kann eine Veränderung der Lohnquote keine Auswirkungen auf die Einnahmen haben. Im staatlichen Modell sind die Einnahmen zwar nicht von der Lohnquote abhängig, dafür sind sie es vom Steueraufkommen und von den Zuteilungen zu anderen Teilhaushalten. Der Gesundheitshaushalt steht in jedem Haushaltsjahr wieder in Konkurrenz zu anderen Haushalten, so daß auch eine Steuerfinanzierung mit ihrer breiten Finanzierungsbasis keine gleichmäßigen Einnahmen garantieren kann.
Auch wenn die Schweiz als die USA Europas bezeichnet werden (Bernardi-Schenkluhn 1992: 179) und man somit kein staatliches Modell vermuten sollte, so sind doch die an die Krankenkassen gezahlten Subventionen, die 1964 auf das erkleckliche Maß von 30% festgesetzt wurden, eindeutig als ein Element des staatlichen Models im Schweizer Gesundheitswesen zu sehen. Und genau dieser Teil der Finanzierung ist für die Erosion der Einnahmen verantwortlich. Der 30%-Anteil wurde nämlich nicht beibehalten, sondern der Anteil der Bundeszuschüsse an den Ausgaben der Kassen hat sich von 1966 bis 1987 halbiert (Bernardi-Schenkluhn 1992:198).
Der Anstieg der Gesundheitsausgaben insgesamt von 8,1% am BIP in 1985 auf 9,7% in 1995 und das gleichzeitige Schrumpfen der Subventionen führte zu einer Preisexplosion bei den Versicherungsprämien (Oggier 1997:281).
Diese Preisexplosion war es, die nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen Mitte der 90er Jahre dann den nötigen Druck zu einer Totalrevision des Schweizerischen Krankenversicherungswesens erzeugte.
2 Das neue KVG
Das neue KVG soll die oben schon angesprochenen Ziele der Gesundheitspolitik erreichen helfen. Es "...soll der Bevölkerung durch entsprechende Ausgestaltung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung eine ausreichende medizinische Versorgung zu erträglichen Kosten gewährleisten" (Maurer 1996: 3). Daß dies, namentlich zu "erträglichen Kosten" mit dem alten KVG kaum mehr möglich war zeigte sich bereits seit Mitte der 80er Jahre.
Nun sollte aber nicht versucht werden, das schweizer Gesundheitswesen durch sich perpetuierende Kostendämpfungsgesetze bezahlbar zu halten, das System sollte nicht beschnitten werden, damit es dies an anderer Stelle durch Wucherungen auszugleichen trachtet. Die erste Totalrevision seit über 80 Jahren sollte vielmehr das System nachhaltig verändern und es zur Selbstregulierung befähigen.
Aus den Neuerungen, die das KVG brachte lassen sich vier Ziele der Reform ablesen. Dies ist eine gleiche Versorgung für alle Schweizer und in der Schweiz Wohnhaften, eine im Krankenversicherungswesen verankerte Solidarität zwischen Armen und Reichen, Kranken und Gesunden, Männern und Frauen wie auch zwischen Jungen und Alten. Dies sind die "Versorgungsziele" bzw. die gesellschaftspolitischen Ziele. Hinzu kommen Finanzziele oder wirtschaftspolitischen Ziele. Diese bestehen vorrangig in der Etablierung eines durch Konkurrenz und Markttransparenz effektiven und effizienten Versicherungsmarktes und eines Marktes der Leistungserbringer, sowie durch die Ermöglichung nicht nur der Konkurrenz von etablierten Formen der Leistungserbringung und -vergütung, sondern auch der Einführung neuer Managed-Care-Modelle. Das neue KVG setzt also in der Frage, wer welche Leistungen zu erhalten hat auf klare administrative Vorgaben; wie diese am wirtschaftlichsten erbracht werden legt es aber in den Hände von marktlich koordinierter Konkurrenz.
Die wesentlichen Neuerungen, die das KVG von 1996 im einzelnen brachte sind folgende:
1. Einführung des Bundesobligatoriums
2. Freie Kassenwahl, unabhängig von Alter und Vorerkrankungen
3. Abschließender und verbindlicher Leistungskatalog in der Grundversicherung
4. Gleiche Prämien innerhalb einer Kasse und Region
5. Subventionen gezielt für die wirtschaftlich schwächeren Versicherten
6. Risikoausgleich zwischen den Kassen bezüglich Alter und Geschlecht
7. Zulassung von Krankenkassen und Privatversicherern zur sozialen Krankenversicherung
8. Möglichkeit von Versicherungen mit eingeschränkter Wahl des Leistungserbringers
9. Möglichkeit der Einführung neuer Vergütungsformen jenseits der Einzelleistungshonorierung
10. Wegfall der Sondervertragsverbote und des Verbandszwangs für Ärzte
(Sommer 1997:225 & Maurer 1996:2)
Im folgenden werde ich diese einzelnen Neuerungen im Hinblick auf die vier genannten Ziele betrachten.
Gleiche Versorgung
Auf die Gewährung einer gleichen, ausreichenden Versorgung aller zielen im wesentlichen die Punkte 1. - 3.
Nachdem der Bund schon lange die Möglichkeit hatte, ein Obligatorium einzuführen, die Entscheidung aber an die Kantone abgetreten hatte, trägt er jetzt der Entwicklung zu immer mehr kantonalen Obligatorien Rechnung (Bernardi-Schenkluhn 1992:207) und führt ein Bundesobligatorium ein. An der Situation der Krankenversicherung in der Schweiz und ihrer Versichertenzahlen kann dies allerdings nicht viel ändern, da bereits 1993, auch ohne Obligatorium, 99,9%(2 )der Schweizer in der sozialen Krankenversicherung versichert sind (Sommer 1997:221).
Die genaue Einordnung der oben genannten zehn Punkte in die vier Dimensionen der Krankenversicherungsreform fällt nicht immer ganz leicht. Die freie Kassenwahl kann auch unter Konkurrenzaspekten betrachtet werden. Wichtig an der durch das KVG ausgeweiteten Kassenwahlfreiheit ist aber auch der Versorgungsaspekt. Nicht die gleiche Versorgung mit Gesundheitsleistungen ist hier gemeint, sondern die gleiche Versorgung mit Versicherungsleistungen. Alten und Kranken steht durch die einheitliche Kopfpauschale unabhängig von Alter und Gesundheitszustand und den Kontrahierungszwang der Kassen, die gleiche Palette an Versicherungen zur Verfügung, wie Jungen und Gesunden.
Der wichtigste Punkt für eine gleiche und ausreichende Versorgung ist aber sicherlich die Festlegung eines einheitlichen und verbindlichen Leistungskatalogs, der sehr umfassend ist und nicht unterschritten werden darf. Vor allem das Zusammenspiel von Obligatorium und verbindlichem Leistungskatalog sichert die ausreichende Versorgung jedes einzelnen.
Solidarität
Solidarisch zu sein heißt, für jemanden einzustehen (Kluge 1995: 770). Wenn der Souverän mit der Verabschiedung des neuen KVG, wie ich oben postuliere, die Solidarität zwischen einigen Gruppen der Gesellschaft befördern möchte, so muß er dafür sorgen, daß einer für den anderen einsteht.
Das neue KVG verpflichtet jeden Schweizer sich für den Krankheitsfall zu versichern.
Solidarität bedeutet nun, daß diejenigen, denen dies - aus welchen Gründen auch immer - leichter fällt, einen Teil der Verpflichtung derer, denen daß schwerer fällt, mit übernehmen.
Dieses Ziel wird vor allem mit den oben in Punkt 4. - 6. genannten Regelungen verfolgt.
Punkt vier zielt durch einen ordnenden Eingriff des Staates in den Versicherungsmarkt (in die Vertragsbeziehung zwischen Versichertem und Versicherer) auf die Herstellung einer Solidarität der unterschiedlichen Risikogruppen, die ohne diesen Eingriff unterschiedliche Prämien bezahlen würden. Mit diesem Eingriff bezahlen die "guten Risiken" aber eine im Verhältnis zum Versicherungsrisiko zu hohe Prämie. Dieser "zu viel" bezahlte Betrag kommt den "schlechten Risiken" zugute.
Punkt fünf (die Subventionen) zielen nun nicht auf die Solidarität zwischen den Risikogruppen, sondern auf eine durch Steuern und Subventionen staatlich veranlaßte Solidarität zwischen Armen und Reichen. Hier greift der Staat nicht ins Vertragsgeschehen an sich ein, sondern senkt bei bestehenden Verträgen durch selektive Subventionen an die Minderbemittelten deren Prämien.
Nachdem Punkt vier sich mit der Solidarität der Risikogruppen innerhalb einer Kasse beschäftigt versucht Punkt sechs, einen kassenübergreifenden Solidarausgleich zwischen den aus den Merkmalen Alter und Geschlecht sich bildenden Risikogruppen zu realisieren. Auch dies ist ein ordnungspolitischer Eingriff, der erst nach dem Abschluß des Versicherungsvertrags ansetzt und verhindern soll, daß "gute Risiken" durch die Wahl einer Kasse, in der überwiegend auch wieder gute Risiken versichert sind, sich dem Solidarausgleich entziehen können.
Konkurrenz
Ein Markt mit möglichst vielen konkurrierenden Anbietern gilt als eine der besten Voraussetzungen, um das, was die Verbraucher wünschen, auch ohne Verschwendung bereitzustellen. Hier können als Märkte, auf denen Konkurrenz zu Effizienz führen soll, sowohl der Krankenversicherungsmarkt als auch der Markt der Leistungserbringer genannt werden.
Die oben genannten Punkte 6. - 10. stehen alle in Zusammenhang mit der Bestrebung, die Konkurrenz im schweizerischen Gesundheitswesen zu beleben. Die Punkte 8. - 10. dienen alle dazu, den Versicherern zu ermöglichen, mit Hilfe von Managed-Care- Methoden die Effizienz der Leistungserbringung zu erhöhen und somit die Kosten zu senken. Da diese Punkte im folgenden Abschnitt "Managed Care" noch angesprochen werden, will ich mich hier auf die Punkte 6. und 7. beschränken.
Den Risikoausgleich habe ich schon unter Solidaritätsgesichtspunkten angesprochen, er hat aber auch für einen erfolgreichen Start in den Konkurrenzmarkt seine Bedeutung. Die bereits bestehenden Krankenkassen starten in die neue Situation seit 1996 mit unterschiedlichen Voraussetzungen, das heißt vor allem mit einer unterschiedlichen Klientel. Die Krankenkassen haben aus den unterschiedlichsten Gründen ganz verschiedene "Risikomischungen" in ihrer Klientel. Damit nun die Krankenkassen mit überwiegend schlechten Risiken nicht aufgrund ihrer hohen Prämien schnell vom Markt verschwinden und sich bald ein Oligopol der Versicherer mit vormals besonders guter Risikostruktur bildet, sieht das neue KVG einen auf zehn Jahre beschränkten Risikoausgleich zwischen den Versicherern vor. Damit soll allen Versicherern die gleiche Startchance im Wettbewerb eingeräumt werden und den Versicherern mit schlechter Risikostruktur die Chance zur Entwicklung hin zu einer repräsentativeren Struktur gegeben werden.
Ein entscheidender Punkt ist auch die Einbeziehung der privaten Versicherer in die soziale Krankenversicherung. Diese Neuerung bedeutet den Abbau von Markteintrittsbarrieren, und somit mit einfachen Mitteln eine Anhebung der Zahl der Konkurrenten. Noch dazu sind die neu an der sozialen Krankenversicherung teilnehmenden privaten Versicherer im Gegensatz zu den anerkannten Krankenkassen aus ihrem Stammgeschäft den Wettbewerb mit anderen Anbietern gewöhnt, so daß diese sicherlich mehr Schwung in den Markt bringen, als das die anerkannten Kassen untereinander tun würden.
Managed Care
Damit sich die Konkurrenz der Versicherungen nicht nur auf das Marketing und die Selektion guter Risiken beschränkt, sollte den Versicherungen die Möglichkeit gegeben werden, die Leistungen, die anzubieten das KVG sie verpflichtet, auf möglichst viele verschiedene Arten anzubieten. Den Versicherern diese Freiheit zu geben, vor allem die Freiheit Managed-Care- Methoden einzuführen, darauf zielen die Punkte 8. - 10.
Die in Punkt 8. genannte Möglichkeit, Versicherungen mit eingeschränkter Wahl des Leistungserbringers anzubieten, bedeutet, daß Hausarztmodelle, HMOs, PPOs, POSs usw.(3 ) nun Optionen für die Leistungserbringung in der sozialen Krankenversicherung sind. Punkt 9. ermöglicht es den Kassen, von der leistungsexpansiv wirkenden und damit kostentreibenden Einzelleistungsvergütung abzurücken, und in Managed-Care-Kontexten eingesetzte oder dort sogar entwickelte Vergütungsformen wie Kopf- und Fallpauschalen, Komplexgebühren oder ergebnisorientierte Bonus-Malus Systeme zu verwenden. Wichtig im Zusammenhang mit HMOs oder PPOs ist, daß Kassen und Ärzten die Möglichkeit eingeräumt wird, Einzelverträge abzuschließen. Dies ermöglicht den Kassen sowohl ihre Versicherten zu lenken als auch die Leistungserbringer besser auf bestimmte Vorgaben verpflichten zu können. Diese Einzelverträge können bei einer guten medizinischen Versorgung, wie sie in der Schweiz gegeben ist, allerdings auch zu einer deutlichen Schwächung der Verhandlungsposition der Leistungserbringer gegenüber den Kassen führen.
3 Managed Care
Managed Care ist kein viertes Modell in der oben genannten Trias der Ordnungstypen des Gesundheitswesens. Die drei Ordnungstypen (staatlich, marktlich und Sozialversicherung) definieren den Rahmen für die Gesundheitsversorgung (vor allem den Kreis der potentiellen Leistungsempfänger und die Art der Finanzierung).
Managed Care umfaßt zwei große Komplexe. Zum einen werden bestimmte Strukturen der Beziehung zwischen Leistungsanbietern, Versicherern und Versicherten mit Managed Care bezeichnet, zum anderen bestimmte Methoden der Leistungs- und Geldzuteilung.
Organisationsstrukturen von Managed Care Organisationen
Ersteres sind die bereits oben genannten HMOs, PPOs, POSs usw. Diese Akronyme standen ursprünglich für Organisationen, die die für Managed Care konstituierende Eigenschaft der Integration von Versicherung und Leistungserbringung in unterschiedlichem Masse oder auf unterschiedliche Weise erbrachten. Inzwischen werden diese Abkürzungen aber von vielen nur noch als "...confusing alphabet soup of initials" (Wagner 1993:13) angesehen, da im Laufe der Zeit z.B. HMOs Organisationsmuster von PPOs übernommen haben, und somit der Name allein keine sicheren Rückschlüsse auf die Struktur mehr zuläßt.
Integration von Versicherung und Leistungserbringung bedeutet, daß die im klassischen Versicherungsmodell getrennten Beziehungen zwischen einerseits Versichertem und Versicherung und andererseits zwischen Versichertem und Leistungserbringer zu einer einzigen Vertragsbeziehung verschmelzen (Abbildung 1 & 2). Dies kann durch eine Übernahme von Versicherungsaufgaben durch die Leistungserbringer, oder durch die direkte Leistungserbringung durch die Versicherer geschehen.
In beiden Fällen kann dann allerdings kaum mehr wirklich von einem Versicherungsverhältnis gesprochen werden, denn ein Versicherungsverhältnis besteht im allgemeinen Verständnis dann, wenn ein Vertragspartner (die Versicherung) gegen einen bestimmten Preis (die Prämie) eventuelle zukünftige Verpflichtungen des anderen Vertragspartners (Versicherter) übernimmt.
Bei Managed-Care-Modellen ist dies nicht so. Hier verkauft ein Unternehmen eine Leistung, die der Kunde eventuell in Zukunft nachfragen wird. Eine solche Konstruktion ist dann wohl eher mit einem Wartungsvertrag denn mit einem Versicherungsvertrag vergleichbar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Managementtechniken von Managed Care Organisationen
Ich habe in aller Kürze dargestellt, was die besonderen Organisationsmerkmale von ManagedCare-Organisationen sind und möchte nun noch die besonderen Managementtechniken darstellen, die durch solche Organisationsformen möglich werden.
Neuffer (1997:127) identifiziert insgesamt acht Bereiche, in denen Managed Care Organisationen spezifische Managementinstrumente verwenden können.
Bei der Leistungserbringung sind dies (a) Auswahl und Honorierung der Leistungserbringer (b) Vorgehen bei Diagnostik, Therapie und Pflege (c) Service (d) Lieferantenauswahl (e) Information und Kommunikation. Gegenüber den Versicherten können Managed Care Organisationen Einfluß auf die Bereiche (f) Lebensweise und Präventionsmaßnahmen (g) Auswahl des Leistungserbringers und (h) Mitwirkung bei der Therapie nehmen. Jeder dieser Bereiche besteht aus mehreren einzelnen Maßnahmen.
Um einen Einblick in die konkreten Maßnahmen zu geben, die eine Managed Care Organisation ergreifen kann, werde ich zwei Maßnahmen genauer darstellen: Das Utilization Management, welches sich im Bereich (b) Vorgehen bei Diagnostik, Therapie und Pflege wiederfindet und das Gatekeepersystem, das Mittel der Wahl für den Bereich (g) Auswahl des Leistungserbringers.
Utilization Management
Utilization Management bedeutet die Beobachtung und Beeinflussung der Inanspruchnahme von Leistungen durch die Managed Care Organisation.
Utilization Management findet aus zwei Gründen hauptsächlich im stationären Sektor statt. Einerseits, weil hier die kostspieligsten Leistungen anfallen (Neuffer 1997:132f), und andererseits, weil im stationären Sektor ganze Leistungsketten entstehen, bei denen eine Planung weitreichendere Konsequenzen haben kann als bei abgeschlossen für sich stehenden Einzelleistungen im ambulanten Sektor.
Utilization Management kann bereits vor der Inanspruchnahme einer Leistung (prospektives Utilization Management), während der Leistungserbringung (begleitendes Utilization Management) oder nach der Leistungserbringung (retrospektives Utilization Management) einsetzen.
Das retrospektive Utilization Management kann logischerweise keine großen Auswirkungen auf die beurteilte Leistung haben, diese ist dann schon erbracht. Es dient also vorwiegend der Qualitätssicherung und der Orientierung in zukünftigen, ähnlichen Fällen.
Prospektives Utilization Management setzt bei der Anordnung stationärer Behandlungen an. Jede stationäre Behandlung (oder auch nur bestimmte stationäre Behandlungen, je nach Ausprägung des Utilization Management) muß vor der Einweisung der Managed Care Organisation mitgeteilt werden, so daß diese den kostengünstigsten Behandlungsplan bestimmen kann. So können z.B. alle Voruntersuchungen ambulant geschehen und die Einweisung erst am Operationstag erfolgen, oder die Einweisung in ein nicht zur Managed Care Organisation kann vermieden werden und statt dessen nur die einzelnen Untersuchungen, die nicht im Krankenhaus der Managed Care Organisation durchgeführt werden können werden extern erbracht.
Begleitendes Utilization Management besteht im wesentlichen aus dem ständigen überprüfen, ob die stationäre Behandlung weiter nötig ist, und aus der rechtzeitigen Planung einer ambulanten, teilstationären oder einer Weiterbehandlung in einer Reha-Einrichtung.
Gatekeepersysteme
Gatekeepersysteme stehen in zweierlei Hinsicht auf einer anderen Seite als das Utilization Management. Einerseits soll hier die Leistungsmenge im ambulanten Bereich beeinflußt werden, andererseits handelt es sich entgegen dem Utilization Management um eine Maßnahme, die hauptsächlich das Verhalten der Patienten steuern soll.
In Gatekeeper- oder auch Hausarztsystemen verpflichtet sich der Versicherte bei allen gesundheitlichen Problemen (außer in Notfällen) zunächst einen Hausarzt zu konsultieren, den er zuvor aus dem Angebot der Managed Care Organisation gewählt hat. Dieser entscheidet dann über die Überweisung an einen Facharzt. Wird eine Facharztbehandlung vom Gatekeeper nicht befürwortet, so kann sich der Patient nicht, oder nur mit erheblicher Selbstbeteiligung auf Kosten der Managed Care Organisation von einem Spezialisten behandeln lassen.
Die Hauptperson im Gatekeepingsystem ist also (neben dem Patienten natürlich) der grundversorgende Arzt. Er empfängt den Patienten im Gesundheitssystem, fungiert als Weiche im System und nicht zuletzt auch als Knotenpunkt, an dem sich alle Informationen und Befunde sammeln (Böhlert et.al. 1997:489f).
Immer wieder konnte gezeigt werden, daß Hausarztsysteme mit ihrer eingeschränkten Arztwahl weitaus günstiger sind, als herkömmliche Versicherungen. Ob, und wenn ja in welchem Maße, diese Einsparungen aber auf die dem Gatekeeping zugeschriebenen Effekte, wie die Vermeidung von unnötigen Mehrfachuntersuchungen, zurückzuführen sind, oder ob die Patienten in Gatekeepingsystemen (in denen sie ja nicht zufällig, sondern durch ihre eigene Wahl sind) aus anderen Gründen weniger Kosten verursachen ist immer noch fraglich (vgl. auch Weber 1998).
Was ist neu an Managed Care?
Eine breitere Betrachtung des Managed-Care-Werkzeugkasten zeigt, daß viele der Managed Care Instrumente gar nicht so neu sind, sondern, daß vor allem die Anwendung vieler solcher Instrumente in Zusammenhang mit ihrer rigiden, bürokratisierten Anwendung das ausmacht, was Managed Care genannt wird.
Im Vergleich zwischen der deutschen GKV und der schweizerischen Krankenversicherung könnte man sagen, daß der Zugang zum Chiropraktiker nur auf Überweisung im Vergleich zum freien Zugang in der Schweiz ein Managed-Care-Element ist.
Kurleistungen an bestimmte Voraussetzungen zu binden ist genauso selbstverständlich wie eine Krankenhausbedarfsplanung, oder der in der deutschen Pflegeversicherung deutlich akzentuierte Grundsatz ambulant vor stationär. All dies könnte man auch als Managed-Care- Instrumente bezeichnen.
Der Aussage von Perneger et. al. (Perneger et. al. 1996:55) "tous les soins sont gérés" läßt sich also ohne weiteres zustimmen.
Und trotzdem spricht Kühn (1997:7) von "...einer unbestreitbar umwälzenden sozialen Innovation im Gesundheitswesen" (Hervorhebung im Original), die es zu verstehen gelte.
Was ist aber das Innovative? Die Managementtechniken an sich sind es nicht, sie finden wir auch in anderen Versicherungsverhältnissen, und die organisatorische Zusammenfassung von Versicherung und Leistungserbringung ist es wie Perneger et.al. (1996:48ff) zeigen, nicht neu.
Das Besondere, das Neue ist einerseits, die bereits erwähnte strikte Anwendung möglichst vieler Managed-Care-Techniken andererseits eine Machtverschiebung innerhalb dieser bekannten Verfahren. Während im klassisch privaten Versicherungsverhältnis, oder auch in der deutschen Sozialversicherung, Leistungen, die durch Managed-Care-Instrumente rationiert sind, recht einfach mit Hilfe einer besonderen Begründung durch den Arzt doch erbracht werden können, verschiebt sich diese Entscheidungsgewalt in Managed Care Organisationen zugunsten der betriebswirtschaftlich orientierten Verwaltung.
Eine weitere in den USA zu beobachtende Neuerung, die mit der Entstehung von Managed Care Organisationen einhergeht, ist, daß das Kriterium der möglichst effizienten Kapitalanlage auch in der Sphäre der Leistungserbringung und nicht mehr nur bei Versicherungsunternehmen oder bei Medizinprodukten Einzug hält. Dies führt natürlich dazu, daß Diagnose- und Therapieentscheidungen nicht mehr alleine nach medizinischen, sondern zunehmend auch nach ökonomischen Gesichtspunkten und weniger im Interesse des Patienten, als des Anteilseigners der Managed Care Organisation getroffen werden.
4 Das neue KVG, ein Beleg für die Konvergenz der Systeme, und ein Schritt zu Managed Care?
Besteht in der Schweiz denn nun seit dem 1.1.1996 auch ein "Managed-Care- Gesundheitswesen"?
Wenn man damit Managed Care nach dem Vorbild der USA meint sicher nicht. In den USA sind die Managed Care Plans an keinen Leistungskatalog gebunden, die Prämien sind in der Schweiz weit mehr staatlich reguliert, und durch sozialgerechte Subventionen kann in der Schweiz vermieden werden, daß Managed Care die Billigmedizin für die Unterschichten wird, was Managed Care Plans in den USA vorgeworfen wird (vgl. z.B. Neue Solidarität Nr. 16 1997).
In der Schweiz wurde durch das neue KVG und die Zulassung von Einzelverträgen zwischen Ärzten/Arztgruppen und Versicherungen, sowie der Zulassung der eingeschränkten freien Arztwahl vor allem einem Instrument des Managed Care eine Tür geöffnet, dem Gatekeeperprinzip nämlich.
Die Schweiz kann also nach wie vor, auch wenn das sicherlich weiterhin geschehen wird, nicht als die USA Europas bezeichnet werden, aber wie sieht es denn jetzt mit ihrer Einordnung in das Analysedreieck aus Sozialversicherung, Marktmodell und staatlichem Modell aus?
Die Schweiz ist vielleicht nicht das geeignetste Beispiel, um die zunehmende Konvergenz der Systeme der Gesundheitsfürsorge zu illustrieren. Denn ein Land, in dem die Krankenversicherung noch nie nach einem der aufgeführten reinen Typen organisiert war, kann schwerlich den Weg vom reinen zum Mischtypus illustrieren.
Vielleicht ist es dennoch ein interessantes Beispiel, denn bei genauem Hinsehen wird man auch in den vermeintlich typischsten Ländern (Deutschland für das Sozialversicherungsmodell oder Großbritannien für das staatliche Model) Elemente anderer Idealtypen finden, und des weiteren zeigt die Schweiz einen Versuch, mit einer klaren Zäsur bewußt und gezielt Ideen zu importieren.
Ich werde nun noch einmal die oben aufgeführten zehn wesentlichen Neuerungen, die das KVG brachte aufgreifen, und sie daraufhin untersuchen, ob sie eine neue Mischung der drei reinen Typen im Schweizer Modell bedeuten.
Die Einführung des Bundesobligatoriums bedeutet sicherlich einen Schritt in Richtung Sozialversicherungsmodell. Es bleibt nicht jedem selbst überlassen, ob und wie er sich versichert (Marktmodell), und es erhält auch nicht jeder ohne Gegenleistung medizinische Leistungen (staatliches Modell), sondern Menschen werden verpflichtet, sich einer Versichertengemeinschaft (ihrer Wahl) anzuschließen.
Die freie Kassenwahl erscheint zunächst als ein Element einer marktlichen Ordnung, bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, daß diese nur durch nicht risikoäquivalente, ja nicht einmal risikoorientierte Prämien erreicht werden kann, also auch hier ein Schritt hin zur Sozialversicherung.
Bei punkt drei: "Abschließender und verbindlicher Leistungskatalog" kann ich wiederum auf Schwartz und Busse (1997:1) verweisen, die dies als ein Kernmerkmal der Sozialversicherung ansehen.
Auch die Prämisse der gleichen Prämien in einer Kasse und Region sehe ich als Merkmal einer Sozialversicherung an. Denn dies bedeutet nicht risikoäquivalente Prämien und das Zusammenfassen von Versicherten in Solidargemeinschaften.
Die staatlichen Subventionen und damit das Element eines staatlichen Modells bleiben erhalten. Ob die Subventionen nun gleichmäßig oder nach bestimmten Bedürftigkeitsregeln vergeben werden, halte ich bei der Einordnung in ein Schema für zweitrangig.
Den Risikoausgleich zwischen den Kassen will ich hier nicht beurteilen, er ist zeitlich befristet und dient daher hauptsächlich der Flankierung anderer Änderungen.
Die oben aufgeführten Punkte 8. - 10. bedeuten einen Schritt hin zum Marktmodell, denn sie erweitern erstens den Kreis der Marktteilnehmer und legen Regelungskompetenzen, die vorher vom Gesetzgeber wahrgenomen wurden, in die Verantwortung der Marktteilnehmer.
In der Schweiz wurde also mit dem neuen KVG ein marktlicher Ordnungsrahmen für das Gesundheitswesen aufgespannt, in dem zunehmend Elemente der Sozialversicherung die Verfügbarkeit und Qualität der Gesundheitsversorgung für alle sichern, und Elemente eines staatlich finanzierten Gesundheitswesens dafür sorgen, daß auch alle an diesem System partizipieren können.
Literatur:
Bernardi-Schenkluhn, Brigitte: Schweiz, in: Alber, Jens / Bernardi-Schenkluhn, Brigitte: Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich Frankfurt/NewYork, Campus 1992, S.177-322
Böhlert, I. / Adam, I. / Robra, B.-P.: Das Schweizer Gatekeepersystem - ein Modell zur Verbesserung der Leistungsentwicklung und Wirtschaftlichkeit, in: Gesundheitswesen 59 (1997) S. 488 - 494
Cavalli, Franco: Mehr Markt oder mehr Rationalität?: Das Krankenversicherungsgesetz auf der Anklagebank, Neue Zürcher Zeitung 10.2.1998
Kaufmann, F.-X.: Elemente einer soziologischen Theorie sozialpolitischer Intervention, in: ders. (Hrsg.): Staatliche Sozialpolitik und Familie Müchen/Wien, Oldenbourg 1982, S.49-86
Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. erw. Auflage Berlin, de Gruyter, 1995
Kühn, Hagen: Managed Care: Medizin zwischen kommerzieller Bürokratie und integrierter Versorgung, Papers der Arbeitsgruppe Public Health P97-202 Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1997
Maurer, Alfred: Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt/M., Helbing & Lichtenhahn 1996
Milde, Petra C.: Institutionenökonomische Analyse alternativer Krankenversicherungssysteme - Das Beispiel der Gesetzlichen Krankenversicherung und der "Health Maintenance Organization", Hamburg 1992
Neuffer, Andreas B.: Managed Care: Umsetzbarkeit des Konzepts im deutschen Gesundheitssystem, Bayreuth, Verlag P.C.O. 1997
Oggier, Willy: Managed Care in der Schweiz: eine Bestandsaufnahme, in: Krankenversicherung 10/97 S.281-283
Perneger, Thomas V. / Etter, Jean-François / Gaspoz, Jean-Michel / Raetzo, Marc-André / Schaller, Philippe: Nouveaux modèles d'assurance-maladie et gestion de soins, in: Sozial- und Präventivmedizin 41 1996 S. 47-57
Schwartz, F.W. / Busse, R.: Sozialmedizinische Überlegungen zum Gesundheitswesen im Wandel, in: Gesundheitswesen 59 1997 S.207-212
Sommer, Jürgen H.: Managed Care in der Schweiz: Vorbild für Deutschland? in: Arnold, M. / Lauterbach, K.W. / Preuß, K.-J.: Managed Care, Ursachen, Prinzipien, Formen und Effekte, Stuttgart, Schattauer 1997
Wagner, Eric R.: Types of Managed Care Organizations in: Kongstvedt, Peter R.: The
Managed Health Care Handbook, Second Edition, Gaithersburg, Aspen Publishers 1993 Weber, Andreas: Grosses Potential für Hausarztmodelle - Braucht es künftig Budgets für neue Versorgungsmodelle? Neue Zürcher Zeitung 3.2.1998
[...]
1. Für Vorerkrankungen war lediglich ein Leistungsausschluß während der ersten fünf Jahre des Versicherungsverhältnisses zulässig.
2. Das BSV (Bundesamt für Sozialversicherung) geht bei solch eindrucksvollen Zahlen von Meßfehlern aus, gibt aber z.B. für 1988 die immer noch deutlich über der Quote der deutschen GKV liegende Zahl von 98% Schweizern in der sozialen Krankenversicherung an (Bernardi-Schenkluhn 1992:207).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text analysiert die Schweizer Reform des Gesundheitswesens durch das Krankenversicherungsgesetz (KVG) von 1996 und untersucht die Konvergenz der Gesundheitssysteme, insbesondere die Einführung von Managed-Care-Elementen in das Schweizer System.
Welche Probleme hatte das Schweizer Gesundheitssystem vor 1996?
Vor 1996 gab es eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen, die zu steigenden Prämien führte. Gleichzeitig erodierten die Einnahmen des Systems, vor allem durch sinkende Bundeszuschüsse an die Krankenkassen.
Was sind die Hauptziele des neuen KVG?
Die Hauptziele des neuen KVG sind die Gewährleistung einer gleichen Versorgung für alle, die Förderung der Solidarität im Krankenversicherungswesen, die Etablierung eines effektiven und effizienten Versicherungsmarktes durch Konkurrenz und die Ermöglichung der Einführung von Managed-Care-Modellen.
Welche wesentlichen Neuerungen brachte das KVG von 1996?
Die wesentlichen Neuerungen sind die Einführung des Bundesobligatoriums, die freie Kassenwahl, ein abschließender Leistungskatalog, gleiche Prämien innerhalb einer Kasse und Region, Subventionen für wirtschaftlich schwächere Versicherte, ein Risikoausgleich zwischen den Kassen, die Zulassung von Krankenkassen und Privatversicherern, die Möglichkeit von Versicherungen mit eingeschränkter Arztwahl, die Möglichkeit neuer Vergütungsformen und der Wegfall von Sondervertragsverboten für Ärzte.
Wie zielt das KVG auf eine gleiche Versorgung?
Das Bundesobligatorium, die freie Kassenwahl und der verbindliche Leistungskatalog zielen darauf ab, eine gleiche und ausreichende medizinische Versorgung für alle sicherzustellen.
Wie fördert das KVG die Solidarität?
Das KVG fördert die Solidarität durch gleiche Prämien innerhalb einer Kasse und Region, gezielte Subventionen für wirtschaftlich schwächere Versicherte und einen Risikoausgleich zwischen den Kassen.
Was ist Managed Care und welche Rolle spielt es im KVG?
Managed Care ist ein Ansatz, der darauf abzielt, die Effizienz der Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem die Finanzierung und Leistungserbringung integriert werden. Das KVG ermöglicht die Einführung von Managed-Care-Modellen, z.B. durch eingeschränkte Arztwahl und neue Vergütungsformen.
Welche Organisationsstrukturen sind typisch für Managed Care?
Typische Organisationsstrukturen sind HMOs (Health Maintenance Organizations), PPOs (Preferred Provider Organizations) und POSs (Point-of-Service Plans).
Welche Managementtechniken werden in Managed Care eingesetzt?
Wichtige Managementtechniken sind Utilization Management (Beobachtung und Beeinflussung der Leistungsnutzung) und Gatekeepersysteme (Hausarztmodelle).
Ist das Schweizer Gesundheitswesen seit dem KVG ein reines Managed-Care-System?
Nein, die Schweiz hat kein reines Managed-Care-System nach US-amerikanischem Vorbild. Es wurden jedoch Managed-Care-Elemente eingeführt, insbesondere das Gatekeeperprinzip.
Ist das KVG ein Beleg für die Konvergenz der Gesundheitssysteme?
Ja, das KVG zeigt, wie die Schweiz ein marktwirtschaftliches System durch Elemente der Sozialversicherung und staatliche Finanzierung ergänzt, um die Verfügbarkeit und Qualität der Gesundheitsversorgung für alle zu sichern.
- Quote paper
- Till Deibele (Author), 1998, Konvergenz von Gesundheitssystemen - Zur These derzunehmenden Angleichung verschiedener Sicherungssysteme am Beispiel des neuen Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95287