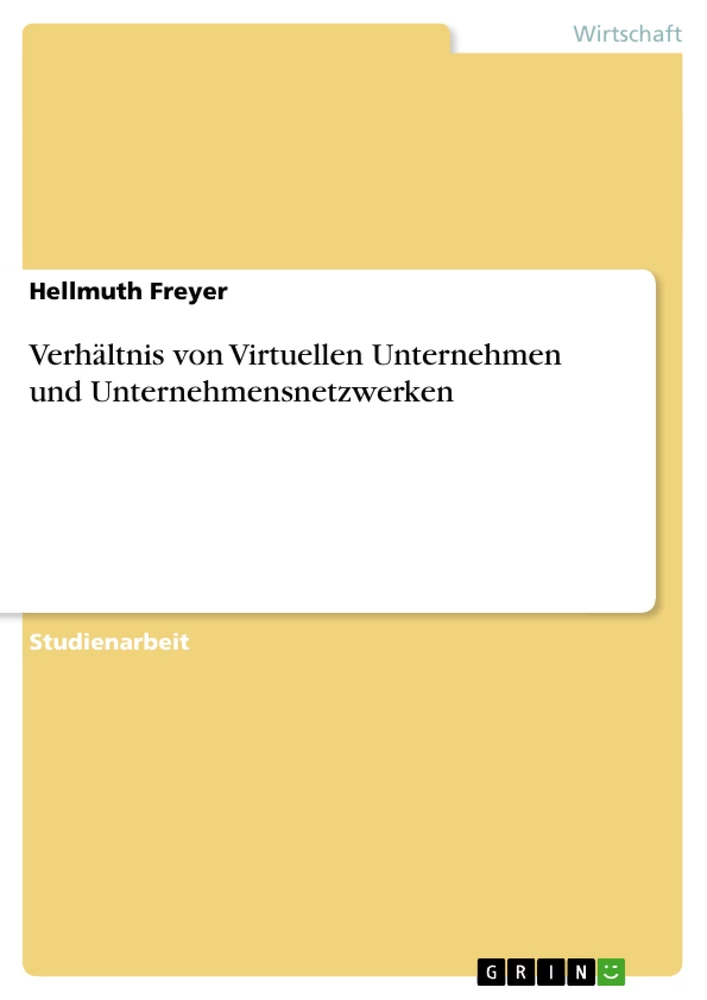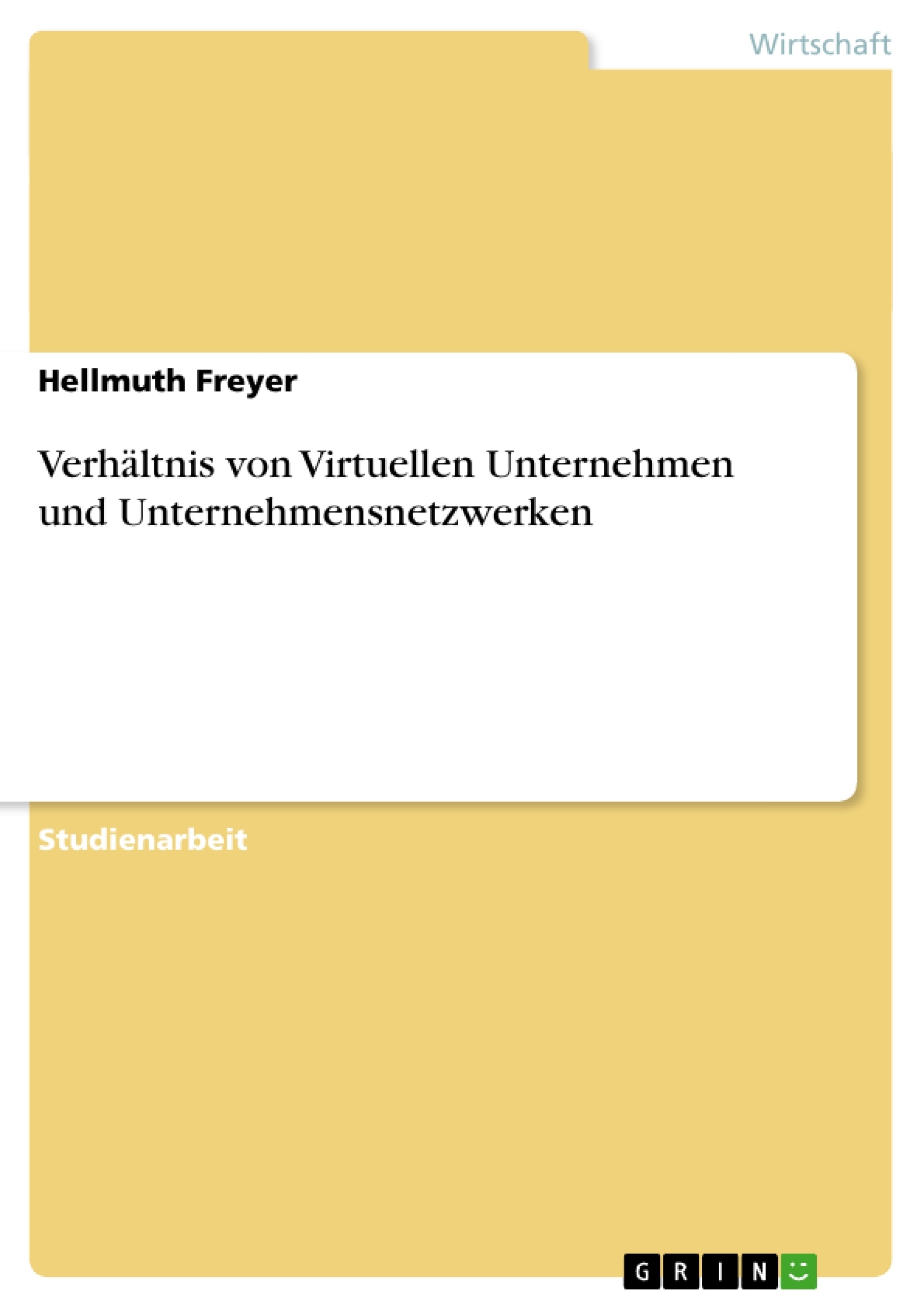Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Der Wandel von Wettbewerbsbedingungen und Unternehmensstrukturen
1.2 Gang der Untersuchung
2 Das Betrachtungsfeld der Unternehmensnetzwerke
2.1 Begriffsbildung des Unternehmensnetzwerkes
2.2 Evolutionsentwicklung von Unternehmensnetzwerken
2.3 Unternehmensnetzwerke aus wirtschaftlichem Betrachtungswinkel
2.3.1 Motive für Netzwerkarrangements
2.3.2 Typen von Netzwerkarrangements
2.4 Ausprägungsformen von Netzwerken
2.4.1 Regionale Netzwerke
2.4.2 Strategische Netzwerke
2.5 Theoretische Erklärungsansätze Interorganisationaler Netzwerke
2.5.1 Transaktionskostenansatz
2.5.2 Ressource Dependence Ansatz
2.5.3 Interaktionsorientierter Netzwerkansatz
2.6 Bedeutung von IuK-Technologien für zwischenbetriebliche Kooperation
3 Betrachtungsfelder im Kontext Virtueller Unternehmen
3.1 Begriffsbildung von Unternehmung, Virtualität und Virtualisierung
3.2 Evolution der Virtualitätskonzepte
3.3 Definition und Merkmale Virtueller Unternehmen
3.4 Lebensphasen eines Virtuellen Unternehmens
3.5 IuK-Technologien als Schlüssel zu virtuellen Unternehmensformen
4 Verhältnis von Virtuellen Unternehmen und Unternehmensnetzwerken
5 Zusammenfassung und kritische Würdigung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Entstehung von Netzwerkstrukturen
Abbildung 2: Typen von Netzwerkarrangements
Abbildung 3: Merkmale regionaler und strategischer Netzwerke
Abbildung 4: Virtualitätsbegriffe
Abbildung 5: Virtuelle Unternehmen als Unternehmensnetzwerk
Abbildung 6: Rekonfiguration eines virtuellen Unternehmens
Abbildung 7: Innovationspotentiale, Wettbewerbssituationen, Innovationsstrategien
Abbildung 8: Zunahme von Unternehmenskooperationen durch Vernetzung
Abbildung 9: Exemplarische Realisationsformen virtueller Objekte
Abbildung 10: Merkmale der Virtuellen Unternehmung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Der Wandel von Wettbewerbsbedingungen und Unternehmensstrukturen
Auf dem Weg in das nächste Jahrtausend werden unserer Gesellschaft ständig neue Formen des Infomationsaustausches mit unserer Umwelt geboten. Über Telex, BTX, Fax und E-Mail entwickelt sich z.B. die nonverbale Kommunikation bei sich parallel verbessernden Übertragungstechniken wie ISDN, ADSL und Breitband-Internet.[1]
Die Generationszyklen von Produkten werden unter überproportionalen Perfor- mancezuwächsen immer kürzer. Ist ein Produkt nicht im Geschäft zu erstehen, bestellt man es per Internet. Im Rahmen der Umorientierung unserer Wertesysteme gestalten sich Käufermärkte zunehmend dynamisch und geographisch unabhängiger.
Um als Unternehmen an diesen Gesellschafts- und Marktentwicklungen teilzunehmen sind neue Organisationsformen gefragt, die diesen Ansprüchen gerecht werden und entsprechende Kriterien erfüllen. Unter diesem Betrachtungswinkel kristallisieren sich Unternehmensnetzwerke und Virtuelle Unternehmen als zeitgemäße und zukunftsträchtige Organisationsformen heraus, die im folgenden näher betrachtet werden.[2]
1.2 Gang der Untersuchung
Ziel der Arbeit ist es, unter Herleitung wesensbestimmender Merkmale und Einflußgrößen bezüglich der Organisationsstrukturen, das Verhältnis von Unternehmensnetzwerken und Virtuellen Unternehmen darzustellen. Dazu werden in den Kapiteln zwei und drei die Betrachtungsfelder getrennt voneinander vorgestellt, um in Kapitel vier die Abhängigkeiten, also das Verhältnis zueinander, zusammenführend zu präsentieren. Im letzten Teil dieser Arbeit erfolgt eine abschließende Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse.
2 Das Betrachtungsfeld der Unternehmensnetzwerke
Seit Anfang der 90er Jahre vollzieht sich im Bereich des Handels und der Konsumgüterindustrie der Prozeß zunehmender wertschöpfungsübergreifender Zusammenarbeit[3]. Diese Entwicklung trägt der Tatsache Rechnung, daß Unternehmen oft allein nicht mehr in der Lage sind, den komplexen und zeitkritischen Erfordernissen des Marktes gerecht zu werden. Daraus resultieren verschiedene Formen der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, die z.B. in Form von Strategischen Allianzen und Netzwerken, Joint Ventures und Value-Added Partnerships zur Ausprägung kommen. In diesem Kapitel soll nun das Phänomen der Unternehmensnetzwerke erörtert werden.
2.1 Begriffsbildung des Unternehmensnetzwerkes
Für die weitere Vorgehensweise sei erwähnt, daß die Begriffe Unternehmens-, Unternehmungsnetzwerk und Interorganisationales Netzwerk gleichbedeutend verwendet werden. Unternehmensnetzwerke können wie folgt umschrieben werden: „Ein ION ist eine polyzentrische Organisationsform, die von einer oder mehreren zentralen Organisation(en) gesteuert wird und die durch komplex-reziproke Beziehungen kooperativer Natur auf Grundlage relativ stabiler und personaler Verknüpfungen zwischen autonomen Organisationen gekennzeichnet ist. ...“[4] Unternehmungsnetzwerke bezeichnen demnach wirtschaftliche Austauschbeziehungen zwischen rechtlich selbständigen Unternehmungen, die in verschiedenen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen. Sie sind durch kooperative und kompetetive Motive miteinander verbunden, wobei die Beziehungen flexibel sind und in der Regel eine größere Zahl von Unternehmungen gleichzeitig betreffen.[5]
2.2 Evolutionsentwicklung von Unternehmensnetzwerken
Bevor genauer auf die theoretischen Grundlagen der Unternehmensnetzwerke eingegangen wird, ist eine Betrachtung realer Ausprägungen sinnvoll. Die Etablierung von UNN im Marktgeschehen hat sich historisch über die Modularisierung[6] und Neuorganisierung von Unternehmenskonzernen und Großunternehmen entwickelt.[7] Reiß spricht in diesem Zusammenhang vom dem „Struktur folgt Strategie“-Postulat[8], wobei auf die Konzepte des Wandels der Change-Szene wie z.B. Reengineering, Lean-Ansätze und TQM an dieser Stelle nur hingewiesen werden kann.[9] Neben den Großunternehmen stellen die KMU weitere potentielle Netzwerkteilnehmer dar, deren Wettbewerbschancen gerade durch die erkennbaren Restrukturierungen von Großunternehmen steigen. In der Managementliteratur findet sich der Begriff der „KMUisierung“ von Großunternehmen[10], der die Umgewichtung des Chancenverhältnisses recht plakativ umschreibt. Damit schließt sich der Kreis zur Netzwerkbildung geeigneter Teilnehmer. Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie die KMU- und Netzwerkstrukturen unter sich modifizierenden Konzernstrukturen in Netzwerke integrierbar werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Entstehung von Netzwerkstrukturen
Quelle: Reiß, Michael: Mit Netzwerkkompetenz zu virtuellen Strukturen, in: Gablers Magazin, 1996, Heft 11 – 12, S. 13
2.3 Unternehmensnetzwerke aus wirtschaftlichem Betrachtungswinkel
Der kurze Ausblick in die Praxis hat uns Erkenntnisse über die Entwicklung von Unternehmensnetzwerken in realer Ausprägung gegeben. Der sich darunter befindliche theoretische Grundstock von Erklärungsversuchen soll nun ansatzweise beleuchtet werden. Der Fokus der Betrachtung liegt für unsere Zwecke auf den Netzwerkarrangements in Form von Strategischen Allianzen und Strategischen Netzwerken[11], die als Grundlage wertschöpfungsbedingter Unternehmenskooperationen gelten können und häufig dem Zweck dienen, KKVs zu erzielen.[12] Auf andere „Formen symbiotischer, die Unternehmensgrenzen verwischende Partnerschaften“[13] sei an dieser Stelle hingewiesen.
2.3.1 Motive für Netzwerkarrangements
Eine zentrale Frage des Betrachtungsfeldes stellen die Beweggründe für Unternehmen dar. Was konkret bewegt Unternehmen zur Bildung von Netzwerkarrangements? Die Abbildungen sieben und acht[14] geben hierzu schon einige Auskünfte. Zur Konkretisierung werden die Motive hier gebündelt vorgestellt:[15]
Unternehmen sind durch Kooperationen mit geeigneten Partnern in der Lage, sich Zugang zu Märkten und Ressourcen zu verschaffen, die auch finanzielle oder personelle Ressourcen für F&E betreffen können. Durch die Konzentration auf bestimmte Aktivitäten in der Wertschöpfungskette können sich Unternehmen Wissensvorsprünge durch Spezialisierungseffekte erarbeiten. Darüber hinaus ermöglichen die Vorteile der Spezialisierung Kostenvorteile, die über die Realisierung von Erfahrungskurveneffekten und Kostensenkungspotentiale erreicht werden. Backhaus hebt diesen Punkt sogar als teilweise konstitutiv hervor. Last but not least sind Zeitvorteile bei der Nutzung von Netzwerkstrukturen zu nennen, die in bezug auf Produktentwicklungen und Markteintrittszeitpunkte zum Tragen kommen. Aufbauend auf diesem motivierten Handeln entwickeln sich Netzwerkarrangements, die sich in verschiedene Kooperationsrichtungen klassifizieren lassen.
2.3.2 Typen von Netzwerkarrangements
Netzwerkarrangements sind nach Backhaus wie in Abb. 2 zu unterscheiden:
Abbildung 2: Typen von Netzwerkarrangements
Quelle: Backhaus, Klaus: Strategische Allianzen und Strategische Netzwerke, in WiSt, 1993, Heft 7, S. 330
In strategischen Allianzen verknüpfen Unternehmen auf gleicher Wertschöpfungs-stufe meist funktionsspezifisch Teile ihrer Unternehmungen, z.B. in F&E, Einkauf oder Vertrieb und entziehen diese Austauschbeziehungen damit der Markttransaktion. In den übrigen Marktfeldern oder Märkten bleiben sie Konkurrenten. Nur im gemeinsamen Geschäftsfeld vereinigen sie ihre Kräfte.[16] Demgegenüber stellen Strategische Netzwerke vertikal oder diagonal ausgerichtete Kooperationsformen dar, wobei es sich in der Regel um Kunden-Lieferanten-Beziehungen handelt (also um Prozesse, die in der Wertschöpfungskette nacheinander gelagert sind), deren Leistungsaustausch über den Markt stattfindet. Die gemeinsam erbrachten Leistungen stehen im Endmarkt in Konkurrenz zu Unternehmen außerhalb des Netzwerkes.[17] In welchen Ausprägungsformen die Netzwerkgebilde in Konkurrenz zur Umwelt treten, soll in einem folgenden Schritt erläutert werden.
2.4 Ausprägungsformen von Netzwerken
Bei der Formanalyse von Unternehmensnetzwerken stellen sich Regionale und Strategische Netzwerke als nennbare Phänotypen heraus. Morath trifft davon abweichend eine Definition von Internationalen Netzwerken, die mit dem Erklärungsansatz der Strategischen Netzwerke eine hohe Deckungsgleichheit aufweisen.[18]
2.4.1 Regionale Netzwerke
Regionale Netzwerke entstehen meist in Wirtschaftsräumen durch Agglomerationen von Unternehmen, die sowohl horizontal, als auch vertikal miteinander vernetzt sein können. Als Beispiele für regionale Netzwerke sind die Region Emilia Romagna, das Silicon Valey, die Region im M 4 Korridor und die Route 128 zu nennen[19]
2.4.2 Strategische Netzwerke
Von strategischen Netzwerken ist die Rede, wenn ein (fokales) Unternehmen die Führungsrolle innerhalb der Struktur übernimmt. Geographisch sind Strategische Netzwerke eher auf internationaler Ebene angesiedelt.[20]
Die Abbildung veranschaulicht die Abgrenzung der Netzwerkformen untereinander:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Merkmale regionaler und strategischer Netzwerke
Quelle: Sydow, Jörg: Netzwerkorganisation, in: WiSt, 1995, Heft 12, S. 631
2.5 Theoretische Erklärungsansätze Interorganisationaler Netzwerke
Um die Theorie von Unternehmensnetzwerken darzustellen werden in der Literatur verschiedene Betrachtungsebenen: individuell (Transaktionskostenansatz), organisational (Ressource Dependence Ansatz, Interaktionsorientierter Netzwerkansatz) und auf ION-Ebene (INA) genutzt.[21] Es wird im Anschluß lediglich eine wertfreie Vorstellung der häufig diskutierten Ansätze vorgenommen.
2.5.1 Transaktionskostenansatz
Die Transaktion bildet als „Prozeß der Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und u.U. Anpassung eines Leistungsaustausches“[22] die Grundlage dieses Ansatzes. Darauf aufbauend setzen sich Transaktionen als transaktionskostenspezifische Investitionen, Kosten für Unsicherheit und Häufigkeit zusammen.[23] Im Kern erklärt der TKA „welche Arten von Transaktionen [...] in welchen institutionellen Arrangements [...] relativ am kostengünstigsten abgewickelt und organisiert werden können.“[24]
2.5.2 Ressource Dependence Ansatz
Zur Erklärung setzt Sydow folgende Prämissen:[25]
- Ressourcen sind knapp
- Ressourcen können durch Austausch erlangt werden
- Durch Abhängigkeiten wird die Autonomie einzelner Unternehmen reduziert
- Organisationen versuchen Autonomie zu erhalten, indem sie interorganisationale Beziehungen aufbauen
Daraus resultiert, daß Unternehmen zur Erhaltung eigener struktureller Autonomie und zur Erlangung von Ressourcen mit entsprechenden Unternehmen interagieren.[26]
2.5.3 Interaktionsorientierter Netzwerkansatz
Dieser Ansatz setzt über begrenzte eigenen Ressourcen in Abhängigkeit von komplementären Fremdressourcen auf den Annahmen des RDA auf. Durch entstandene Partnerschaften folgt eine Vertiefung der Beziehungen auf verschiedenen Ebenen unter nicht opportunistischem Verhalten der Teilnehmer. Die erfolgsbestimmende Position des Unternehmens im Netzwerk definiert sich danach über die erfolgreiche Herstellung und Vertiefung solcher Beziehungen, als wertvollste Ressource des Unternehmens. Daraus begründet sich die Existenz von komplexen Netzwerken durch die Vielzahl von Beziehungen mit dynamischen Elementen durch interdependente Verhältnisse.[27]
2.6 Bedeutung von IuK-Technologien für zwischenbetriebliche Kooperation
Für Unternehmen ist heutzutage selbstverständlich, die mit Information zusammenhängenden Aktivitäten durch den Einsatz von IuK-Technologien zu bewältigen. Dies betrifft zum einen die informationstechnologische Komponente in Form von Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Rückgewinnung und Darstellung von Daten, und zum anderen den Informationstransfer mit Hilfe von Kommunikationstechnologien der aufgrund dessen häufigen Einsatzes zur Überwindung räumlicher Entfernungen auch Telekommunikation genannt wird. Hierdurch werden innerbetriebliche sowie gesamtunternehmerische Wirtschaftlichkeitseffekte erzielt, die entscheidende Vorteile bewirken können.[28] Gerade in bezug auf die Netzwerkfähigkeit von Unternehmen kann entsprechende Software durch Bereitstellung von kompatiblen Schnittstellen (z.B. EDI, TCP-IP) oder offener und modularer Systemarchitektur (z.B. SAP© R/3)[29] konstitutiven Charakter erlangen. Zur Vertiefung des Themas der Computergestützten Unternehmenskooperation sei an dieser Stelle hingewiesen.[30]
3 Betrachtungsfelder im Kontext Virtueller Unternehmen
Der Leser ist geneigt, aufgrund der tagespolitischen Vertrautheit der häufig bemühten Begriffe rund um die Virtualität, vage Vorstellungen von Virtuellen Unternehmen zu erzeugen, die folgend präzisiert werden. Augenscheinlich ist, daß es sich hierbei um die Kombination zweier Merkmale handelt.
3.1 Begriffsbildung von Unternehmung, Virtualität und Virtualisierung
VU sind auf der einen Seite Unternehmen. Dies impliziert, daß eine Unternehmung als „eine organisatorische Einheit, in der durch Kombination von Produktionsfaktoren Güter [und Dienstleistungen, der Verf.] erstellt werden.“[31], zu verstehen ist. Die Erklärung von Virtualität auf der anderen Seite gestaltet sich vergleichsweise umfangreicher. Abb. 4 gibt uns einen Überblick verschiedener Interpretationsmöglichkeiten des Virtualitätsbegriffs.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Virtualitätsbegriffe
Quelle: Jansen, Stephan A.: Virtuelle Unternehmen: Begriffe, Merkmale, Konzepte, Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 1998, Heft Nr. 15, S.5
Zusammenführend ist festzustellen, daß der Begriff „virtuell“ Eigenschaften beschreibt, die nicht real existieren, aber der Möglichkeit nach vorhanden sind. Diese Aussage ist allerdings ohne Objektbezug, so daß ein zweites Kriterium vorhanden sein muß, das spezifische virtualisierbare Merkmale aufweist. Virtualität existiert also nicht per se, sondern bezieht sich auf bestimmte Objekte. In unserem Fall ist das Objekt der Virtualisierung als historisch jüngste Erscheinung die Unternehmung.[32]
3.2 Evolution der Virtualitätskonzepte
Die Genese von virtuellen Objekten hat sich historisch bis hin zur virtuellen Organisation über vier Stufen (Virtueller Speicher, Virtuelle Realität, Virtuelle Erzeugnisse, Virtuelle Organisation) vollzogen.[33] Das Verhältnis Virtueller Unternehmen zu virtuellen Objekten verdeutlicht Abbildung 9.[34] Ergänzend hierzu können virtuelle Organisationen als temporäre Netzwerkverbünde beschrieben werden, die unter Nutzung informationstechnischer Möglichkeiten bestimmte wirtschaftliche Leistungen erbringen.[35]
Als letztes Teil im Puzzle wird jetzt noch die eigentliche Beschreibung des Blickfeldes Virtueller Unternehmen eingefügt: die Bestimmung von VU an sich.
3.3 Definition und Merkmale Virtueller Unternehmen
Ein Definitionsversuch virtueller Unternehmen wird nach Wüthrich unter Ableitung konstituierender Merkmale folgendermaßen getroffen:[36]
„Das Virtuelle Unternehmen ist eine freiwillige, temporäre Kooperationsform mehrerer, i. d. R. unabhängiger Partner (Unternehmen, Institutionen, Einzelpersonen), die dank optimierter Wertschöpfung einen hohen Kundennutzen stiften. Auf der Basis eines gemeinsamen Geschäftsverständnisses und ausgeprägter Vertrauenskultur stellen die Kooperationspartner ihre Kernkompetenzen in Form von Ressourcen und Fähigkeiten zur Verfügung, mit dem Ziel, besser, billiger, schneller, flexibler und international kompetetiver zu werden. Aus Kundensicht tritt das dynamische Netzwerk wie ein einheitliches Unternehmen auf und nutzt die Möglichkeiten modernster IuK-Technik.“ Die Ausprägung von VU innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes unter Bereitstellung von Kernkompetenzen wird in der Abbildung unten verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Virtuelle Unternehmen als Unternehmensnetzwerk
Quelle: Sydow, Jörg: Erfolg als Vertrauensorganisation?: Virtuelle Unternehmung, in: Office-Management, 1996, Heft 7/8, S. 11
Einen umfassenden Definitionsversuch von VU, der übergreifend wirtschaftliche, politische und soziologische Aspekte vereint, liefert Jansen.[37]
Es wird darin deutlich, daß zur Umschreibung dieses Phänomens mehrere wissenschaftliche Disziplinen gefordert sind, und daß strukuturelle Merkmale allein nicht genügen, wenn eine nähere Betrachtung Virtueller Unternehmen erfolgt.
3.4 Lebensphasen eines Virtuellen Unternehmens
Um die Dynamik, den prozeßhaften Charakter und die Endlichkeit Virtueller Unternehmen zu unterstreichen wird die Abbildung 5 aus dem vorangegangenen Kapitel aufgegriffen und erweitert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Rekonfiguration eines virtuellen Unternehmens Entworfen und gekennzeichnet: Verfasser, in Anlehnung an Zimmermann[38]
Zwischen den beiden virtuellen Unternehmen liegen 4 Phasen der Entwicklung:[39]
(1) Anbahnung – Partnersuche, (2) Vereinbarung, (3) Durchführung, (4) Auflösung
Diese vier Phasen folgen für jedes neue Projekt (Kundenauftrag) zyklisch aufeinander, wobei der Zeitrahmen zwischen VU1 und VU2 flexibel ist. Liegt ein Auftrag vor, werden die netzwerkimmanenten IuK-Strukturen aktiviert.
3.5 IuK-Technologien als Schlüssel zu virtuellen Unternehmensformen
VU ist eine informationstechnisch unterstützte Form der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit. Dementsprechend sind IuK-Technologien für VU von grundsätzlicher und konstitutiver Bedeutung. Die in Kapitel 2.6 getroffenen Aussagen finden hier besondere Geltung, da IuK-Technologien erst die Voraussetzungen für flexible Unternehmensvernetzung schaffen.[40] Ergänzend dazu sei an dieser Stelle auf den Einsatz performanter Systeme und moderne EDV-Programme in Form von Groupware-Produkten und Workflow-Sortware zur optimalen Gestaltung hingewiesen.[41] Zur Einführung und Vertiefung des Themas der IuK-Technologien incl. Software, Hardware, Netzwerktypologien, etc., wird an dieser Stelle verwiesen.[42]
4 Verhältnis von Virtuellen Unternehmen und Unternehmensnetzwerken
Nachdem in den beiden vorangegangen Kapiteln Unternehmensnetzwerke und virtuelle Unternehmen vorgestellt wurden, wird jetzt die thematische Zusammenführung vorgenommen. Betrachtet man die evolutorischen Entwicklungen von Unternehmensstrukturen und Virtualität, so stehen Virtuelle Unternehmen symbiotisch an der Spitze zweier sich unter zeitlichem Aspekt aufeinander zu entwickelnder Bereiche: der Informatik (Virtualität) und der Betriebswirtschaft (Unternehmensstrukturen). Durch die sich zuvor beschriebenen, verändernden Wettbewerbsbedingungen, integrieren Unternehmen zunehmend morderne IuK-Systeme, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die intraorganisationale geht der interorganisationalen Virtualisierung voran[43] und bildet dadurch die Grundlage für Unternehmensnetzwerke und Virtuelle Unternehmen. Dieser Trend beschreibt den Wandel von traditionellen Formen der „Palast-Organisationen“ hin zu hochflexiblen „Zeltorganisationen“ in prozeßorientierten Netzen.[44]
Unternehmensnetzwerke bilden gleichermaßen die Grundlage für die Virtualisierung von Unternehmen, da eine virtuelle Unternehmung m.a.W. auf zumindest latent vorhandenen Netzwerkbeziehungen basiert.[45] Dies ist kein Widerspruch, sondern unterstreicht den symbiotischen Charakter.
Genau genommen ist die Virtuelle Unternehmung also ein dynamisches Netzwerk von Unternehmungen, das erst durch massiven Einsatz von IuK-Technologien zustande kommt, und Dritten, darauf basierend, wie eine Unternehmung erscheint.[46]
5 Zusammenfassung und kritische Würdigung
Ziel der Arbeit war, daß Verhältnis von Virtuellen Unternehmen und Unternehmensnetzwerken darzustellen. Dafür wurden die Themenfelder getrennt voneinander analysiert, um in einem anschließenden Kapitel die Gemeinsamkeiten darzustellen. Zusammenfassend können folgende Aussagen getroffen werden:
Unternehmensnetzwerke basieren i.d.R. auf Unternehmenskooperationen, die durch horizontale, vertikale und diagonale Vernetzung entstehen und in Form von strategischen und regionalen Netzwerken auf Märkten in Erscheinung treten. IuK-Techno-logien besitzen für Unternehmensnetzwerke einen konstitutiven Charakter. Virtuelle Unternehmen sind wirtschaftliche Erscheinungen, die erst auf Basis von informa- tionstechnologischer Entwicklungen möglich wurden. Unternehmensnetzwerke sind für die Bildung virtueller Unternehmen konstitutiv, da sich VU i.d.R. temporär innerhalb bestehender Unternehmensnetzwerke bilden. Sie besitzen im Gegensatz zu diesen Unternehmensnetzwerken durch das Element der zeitlichen Ausprägung einen eher projektorientierten Charakter, der durch entsprechende Kundenwünsche eine „best-in-class“ Bündelung von Kernkompetenzen erzeugt. Virtuelle Unternehmen stehen derzeit an der Spitze der unternehmensevolutorischen Entwicklung, wodurch jedoch noch keine konkreten Aussagen über die Eignung von Virtuellen Unternehmen als „der Unternehmenstyp der Zukunft“ gemacht werden können.
6 Anhang
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Innovationspotentiale, Wettbewerbssituationen, Innovationsstrategien
Quelle: Picot, Arnold / Reichwald, Ralf / Wigand, Rolf T: Die grenzenlose Unternehmung, 3. Aufl., Wiesbaden 1998 S. 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Zunahme von Unternehmenskooperationen durch Vernetzung[47]
Quelle: Sihn, Wilfried, Hägele, Thomas: Durch die Zunahme der Kooperationen entstehen immer mehr vernetzte Unternehmen. in: itManagement 12.1998, S. 65
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Exemplarische Realisationsformen virtueller Objekte
Quelle: Scholz, Christian: Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, in: zfo, 1996, Heft 4, S. 206
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Merkmale der Virtuellen Unternehmung
Quelle: Jansen, Stephan A.: Virtuelle Unternehmen: Begriffe, Merkmale, Konzepte, Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 1998, Heft Nr. 15, S.5
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] Vgl. Reichwald, Ralf / Englberger, Hermann: Multimediale Telekooperationen in neuen Organisationsstrukturen, in: Reichmann, Thomas: Globale Datennetze, München 1998, S. 112 f
[2] Vgl. Abbildung 7: Innovationspotentiale, Wettbewerbssituationen, Innovationsstrategien, Anhang, S. 14
[3] Vgl. Friedrich, Stephan A. / Hinterhuber, Hans H.: Wettbewerbsvorteile durch Wertschöpfungspartnerschaft, in: WiSt, 1999, Heft 1, S. 2
[4] Morath, Frank A.: Interorganisationale Netzwerke: Dimensions – Determinants – Dynamics Konstanz 1996, in Anlehnung an Sydow, Jörg: Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation, Wiesbaden 1992
[5] Vgl. Klein, Stefan: Interorganisationssysteme und Unternehmensnetzwerke, Wiesbaden 1996, S. 88
[6] Vgl. hierzu ausführl.: Picot, Arnold / Reichwald, Ralf / Wigand, Rolf T: Die grenzenlose Unternehmung, 3. Aufl., Wiesbaden 1998, S. 201 ff
[7] Vgl. Abb. 8: Zunahme von Unternehmenskooperationen durch Vernetzung, Anhang, S.15
[8] Reiß, Michael / v. Rosenstiel, Lutz / Lanz Anette: Change Management, Stuttgart 1997, S. 73
[9] Vgl. z.B. Reiß, Michael / v. Rosenstiel, Lutz / Lanz Anette, a.a.O. S. 3 ff
[10] Pichler, Hanns J. / Pleitner, Hans J. / Schmidt, Karl-Heinz: Management in KMU, 2. Aufl., 1997 Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, S. 26
[11] Vgl. Backhaus, Klaus: Strategische Allianzen und Strategische Netzwerke, in WiSt, 1993, Heft 7, S. 330
[12] Vgl. Backhaus, Klaus: Industriegütermarketing, 5. Aufl., München 1997, S. 258
[13] Vgl. Picot, Arnold / Reichwald, Ralf / Wigand, Rolf T, a.a.O., S. 268
[14] siehe Anhang, S 14 f
[15] Vgl. Backhaus, Klaus, a.a.O., S. 259 ff
[16] Vgl. Backhaus, Klaus, a.a.O., S. 263
[17] Vgl. Backhaus, Klaus, a.a.O., S. 264; Jarillo, Carlos J.: On strategic networks, in: Strategic Management Journal, 1988, Heft 9, S. 33
[18] Vgl. Sydow, Jörg: Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation, Wiesbaden 1992, S 37 ff; Morath, Frank A., a.a.O. S. 15 f
[19] Vgl. Sydow, Jörg: Unternehmungsnetzwerke, in: Handbuch Unternehmensführung, Corsten, Hans, Wiesbaden 1995, S. 161
[20] Vgl. Sydow, Jörg: Netzwerkorganisation, in: WiSt, 1995, Heft 12, S. 630
[21] Vgl. Morath, Frank A., a.a.O., S. 21
[22] Sydow, Jörg: Strategische Netzwerke: Evolution und Organisation, Wiesbaden 1992, S. 130
[23] Morath, Frank A., a.a.O., S. 22 f
[24] Vgl. Williamson, O.E. in: Morath, Frank A., a.a.O., S. 22
[25] Sydow, Jörg, a.a.O., S. 196
[26] Vgl. Morath, Frank A., a.a.O., S. 27
[27] Vgl. Håkansson / Johanson / Mattson, in: Morath, Frank A., a.a.O., S. 29 ff
[28] Vgl. Rupprecht-Däullary, Marita: Zwischenbetriebliche Kooperation, Wiesbaden 1994, S. 120 f
[29] Wenzel, Paul: Betriebswirtschaftliche Anwendungen des integrierten Systems SAP R/3, 2. Aufl., Wiesbaden 1996, S. 15 f
[30] z.B. Kronen, Juliane: Computergestützte Unternehmenskooperation, Wiesbaden 1994, S. 133 – 172
[31] Siebert, Horst: Einführung in die Volkswirtschaftslehre, 11. Aufl., Stuttgart 1992, S. 84; Vgl. hierzu ausführl.: z.B. Wöhe, Günter: 1990, S. 91 ff, Schierenbeck, Henner: 1993, S 13 ff
[32] Vgl. Scholz, Christian: Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, in: zfo, 1996, Heft 4, S. 204 f
[33] Vgl. Scholz, Christian, a.a.O., S. 206
[34] Exemplarische Realisationsformen virtueller Objekte, Anhang, S. 15
[35] Vgl. Wüthrich, Hans / Philipp, Andreas: Virtuell in 21. Jahrhundert!?: Wertschöpfung in temporären Netzwerkverbünden, in: HMD, 1998, Heft 200, S. 14
[36] Wüthrich, Hans A. / Frentz, Martin H. / Philipp, Andreas F.: Vorsprung durch Virtualisierung: lernen von virtuellen Pionierunternehmen, Wiesbaden 1997, S. 96
[37] Jansen, Stephan A.: Abbildung 10: Merkmale der Virtuellen Unternehmung, Anhang, S. 16
[38] Vgl. Zimmermann, Frank-O.: Konzeptionelle Aspekte Virtueller Unternehmen, Abb. 4, S. 6
[39] Vgl. Mertens, Peter / Faisst, Wolfgang: Virtuelle Unternehmen: Eine Organisationsstruktur für die Zukunft?, in: WiSt, 1996, Heft 6, S. 284
[40] Vgl. Klein, Stefan: Virtuelle Organisation, in: WiSt, Heft 6, 1994, S. 309 f
[41] Vgl. Rentergent, Jürgen: Kooperation mit modernster Technologie, in: Gablers Magazin, Heft 11/12, 1996, S. 16 ff
[42] z.B. Kargl, Herbert: Grundlagen von Informations- und Kommunikationssystemen, München 1998
[43] Vgl. Krystek, Ulrich / Redel, Wolfgang / Reppegather, Sebastian: Erfolgsfaktoren und Elemente der Virtualität, in: Gablers Magazin, Heft 3, 1997, S. 12 f
[44] Vgl. Bleicher, Knut: Der Weg zum virtuellen Unternehmen, in: Office Management, 1996, Heft 1/2, S. 15
[45] Vgl. Winand, Udo / Nathusius Klaus: Unternehmungsnetzwerke und virtuelle Organisationen, Stuttgart 1998, S 31
[46] Vgl. Winand, Udo / Nathusius Klaus, a.a.O., S 31
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt Unternehmensnetzwerke und Virtuelle Unternehmen, deren Verhältnis zueinander, sowie die Bedeutung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) in diesem Kontext.
Was sind Unternehmensnetzwerke laut diesem Dokument?
Unternehmensnetzwerke werden als polyzentrische Organisationsformen beschrieben, die durch komplexe, reziproke Beziehungen kooperativer Natur und stabile, personale Verknüpfungen zwischen autonomen Organisationen gekennzeichnet sind.
Welche Motive gibt es für Unternehmen, Netzwerkarrangements einzugehen?
Motive sind unter anderem der Zugang zu Märkten und Ressourcen, Spezialisierungseffekte, Kostenvorteile und Zeitvorteile.
Welche Typen von Netzwerkarrangements werden unterschieden?
Es werden strategische Allianzen und strategische Netzwerke unterschieden.
Was sind regionale Netzwerke?
Regionale Netzwerke entstehen in Wirtschaftsräumen durch Agglomerationen von Unternehmen, die horizontal und vertikal vernetzt sind.
Was sind strategische Netzwerke?
Strategische Netzwerke sind dadurch gekennzeichnet, dass ein fokales Unternehmen die Führungsrolle übernimmt und geographisch eher auf internationaler Ebene angesiedelt ist.
Welche theoretischen Erklärungsansätze für interorganisationale Netzwerke werden genannt?
Es werden der Transaktionskostenansatz, der Ressource Dependence Ansatz und der interaktionsorientierte Netzwerkansatz genannt.
Welche Rolle spielen IuK-Technologien für zwischenbetriebliche Kooperation?
IuK-Technologien werden als essentiell für die Bewältigung von Informationsaktivitäten und den Informationstransfer angesehen und ermöglichen die Netzwerkfähigkeit von Unternehmen durch kompatible Schnittstellen und offene Systemarchitekturen.
Wie wird der Begriff "Virtuelles Unternehmen" definiert?
Ein Virtuelles Unternehmen (VU) wird als eine freiwillige, temporäre Kooperationsform unabhängiger Partner definiert, die dank optimierter Wertschöpfung einen hohen Kundennutzen stiften und ihre Kernkompetenzen zur Verfügung stellen, um wettbewerbsfähiger zu werden.
Welche Lebensphasen eines Virtuellen Unternehmens werden beschrieben?
Die Lebensphasen umfassen Anbahnung (Partnersuche), Vereinbarung, Durchführung und Auflösung.
Inwiefern sind IuK-Technologien wichtig für Virtuelle Unternehmen?
IuK-Technologien sind von grundlegender und konstitutiver Bedeutung, da sie die Voraussetzungen für flexible Unternehmensvernetzung schaffen.
Wie ist das Verhältnis zwischen Virtuellen Unternehmen und Unternehmensnetzwerken?
Unternehmensnetzwerke bilden die Grundlage für die Virtualisierung von Unternehmen, da ein VU auf vorhandenen Netzwerkbeziehungen basiert. Ein VU ist ein dynamisches Netzwerk, das durch den Einsatz von IuK-Technologien entsteht.
Was ist das Fazit der Analyse von Unternehmensnetzwerken und Virtuellen Unternehmen?
Unternehmensnetzwerke und Virtuelle Unternehmen erfordern Unternehmenskooperationen und die Etablierung strategischer und regionaler Netzwerke in den Märkten. Virtuelle Unternehmen sind ein Ausdruck der evolutionären Entwicklung von Unternehmen und basieren auf dem Aufbau von IuK-Technologien.
- Quote paper
- Hellmuth Freyer (Author), 1999, Verhältnis von Virtuellen Unternehmen und Unternehmensnetzwerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95311