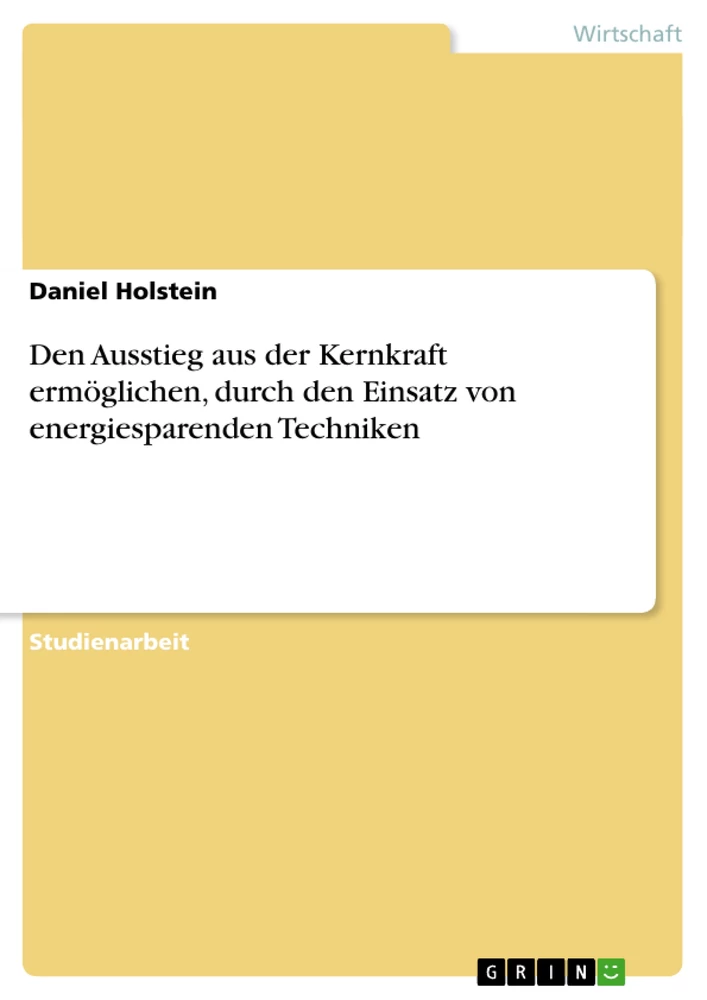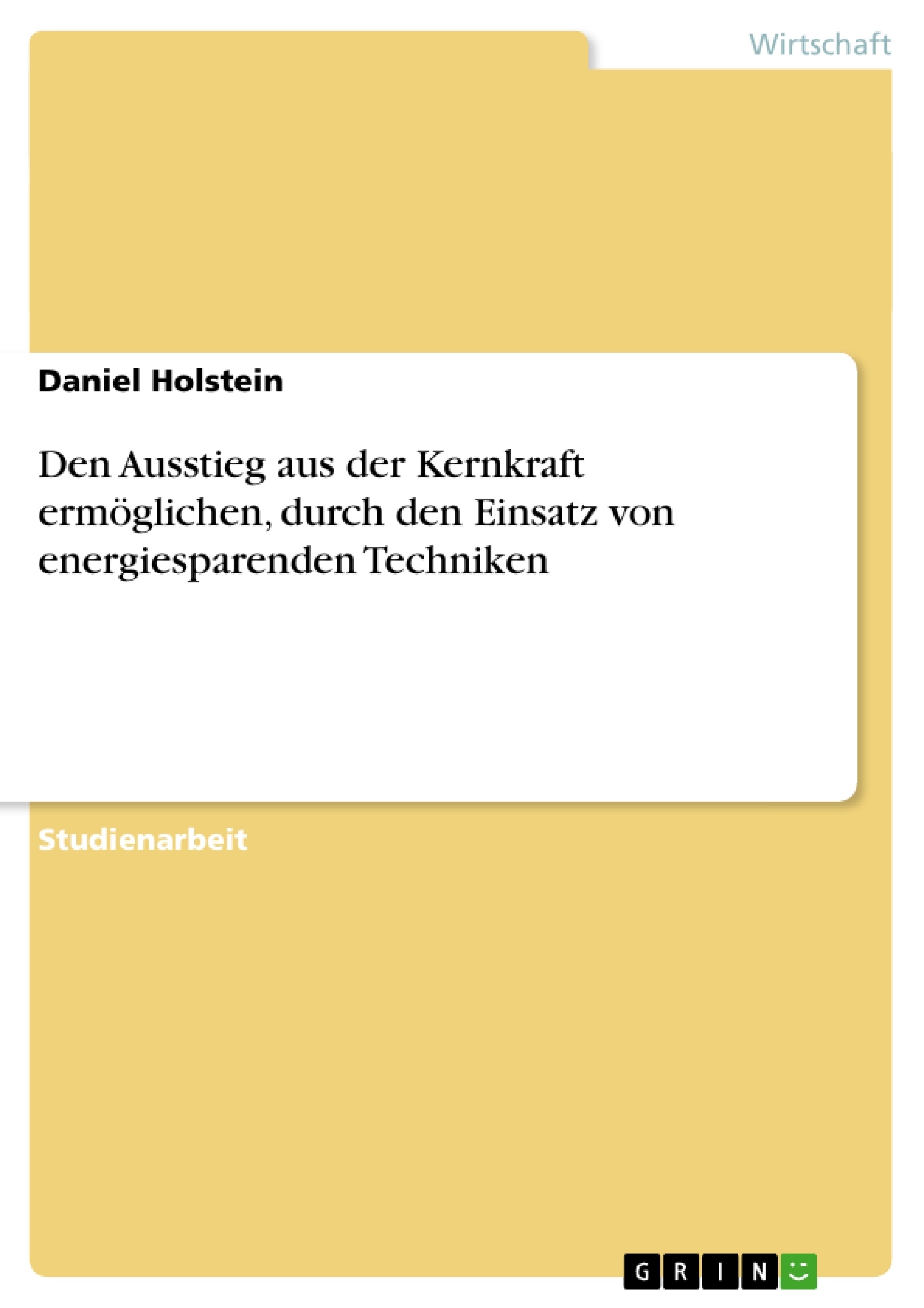Inhaltsverzeichnis:
1) Einleitung
2) Verhaltenstheorien
3) Was ist Least-Cost Planing (LCP) ?
4) Wer soll LCP- Programme durchführen bzw. finanzieren und unter welchen Bedingungen ?
5) Schlußbetrachtung
6) Literaturverzeichnis
1) Einleitung
Im Rahmen einer Studiengruppe in der Integrationsveranstaltung II für Sozialwissenschaftler habe ich mich mit möglichen Alternativen zur Kernenergie beschäftigt. Diese werden nicht nur aufgrund von Tschernobyl gebraucht. Tschernobyl war im Jahre 1986 der entscheidene Unfall, der die Gefahren der Kernenergie bis in weite Teile der deutschen Bevölkerung bewußt machte. Viele tausend Menschen sind unmittelbar nach dem Super-Gau gestorben. An den Folgen, Krebs, Fehlgeburten, `annormale' Geburten, langfristige Veränderung des Erbgutes, nicht betretbare Gebiete ... leidet die Region um Minsk noch heute. Zwar sind die Sicherheitsstandards in deutschen (und umliegenden) Kernkraftwerken wesentlich höher einzuschätzen, doch gibt es immer noch den Unsicherheitsfaktor Mensch. So wäre es in Biblis vor ein paar Jahren fast zu einem Beinahe-Gau gekommen, weil Techniker eine rot leuchtende Lampe für einen Fehlalarm hielten.
Hinzukommen tut bei der ganzen Sicherheitsproblematik auch die ungelöste Endlagerungsfrage für die verbrannten Brennelemente der AKWs, die noch zigtausend Jahre radioaktiv strahlen werden. Es existiert zwar ein Zwischenlager und (ein genehmigtes?) Endlager in Gorleben, doch dürfte aufgrund des hohen Widerstandes aus der Bevölkerung die weitere Einlagerung nicht durchsetzungsfähig sein.
Meinungsumfragen deuten mittlerweile daraufhin, daß die Mehrheit der Deutschen einem Auslaufszenario der Kernkraft positiv gegenüberstehen.
Zurück zu den möglichen Alternativen der Atomkraft.
Auf fossile Brennstoffe auszuweichen kann keine echte Alternative sein, weil man dann sprichwörtlich vom Regen in die Traufe kommt. Fossile Brennträger (Kohle, Öl, Gas...) sind die Hauptverursacher des Treibhauseffektes. Durch ihre Verbrennung gelangt CO2 in die Atmosphäre, was wiederum zu einem Anstieg der Temperaturen auf der Erde führt und dabei nachhaltige Probleme ( Überflutung ganzer Landstriche, globale Wetterveränderung) mit sich bringt. Praktisch wären die fossilen Brennträger aber am schnellsten in der Lage, die Kernkraft komplett zu ersetzen. Zum einen, weil das Angebot groß genug ist und zum anderen, weil es genügend Kraftwerks- Überkapazitäten gibt, um mehr oder weniger sofort mit der Stromproduktion anzufangen.
Regenerative Energien sind momentan noch nicht auf dem Entwicklungsstand, um die Kernkraft auch nur annähernd zu ersetzen. Der erzeugte Strom aus Windenergie ist noch ca. 10 Pf die Kilowattstunde(kWH) teurer, die kWH aus Solarstrom `dümpelt' bei ca. 2 DM ( ALTNER, 1995,37).
Was bleibt ist die Energieeinsparung und sie bietet eine echte Alternative in allen relevanten Ersatzbereichen an. Sie ist billiger zu `erzeugen'/ vermeiden als die `herkömmliche' Stromerzeugung und sie bietet (theoretisch) das Größenpotential Kernkraft zu vermeiden. So schätzt z.B. das Wuppertal Institut (1994, 21), daß unser privater, öffentlicher, als auch industrieller Energieverbrauch um ca. 45% senkbar ist. Die Enquete- Komission des deutschen Bundestages (1990, Band 3, 225) nennt eine nicht ganz so hohe Zahl von 35%, doch liegt sie bereits vier Jahre zurück. Der Anteil der Atomenergie hat sich seit Ende der 80 er Jahre bei ca. einem Drittel des gesamten Energiebedarfes eingependelt ( ALTNER, 1995, 7). Theoretisch würde also die Möglichkeit bestehen, durch Energieeinsparung die Kernkraft zu ersetzen.
In dieser Hausarbeit soll es nicht darum gehen, was für Energiesparmaßnahmen es gibt, sondern die zentrale Ausgangsfragestellung soll folgendermaßen formuliert werden :
` Wie müssen energiesparende Strukturen im Energiesektor aussehen, damit sie erfolgreich sind und somit die Atomkraft `überflüssig' machen können. `
Zum weiteren Vorgehen - Im nächsten Kapitel soll hinterfragt werden, wann Marktakteure im Sinne der Energieeinsparung tätig werden. Welche Anreize gegeben sein müssen, damit z.B. ein energiesparender Kühlschrank gekauft wird. Danach folgt eine Einführung in das Least- Cost Planning (LCP), ein Konzept das sich aus dem vorherigen `Anreizkapitel' ergibt. Herkunft, Konzeptionen, Nutzen und Beispiel im Zusammenhang mit dem LCP werden dargestellt.
Im nächsten Kapitel (4 ) geht es um die möglichen Akteure die LCP-Maßnahmen durchführen bzw. finanzieren können, nämlich die schon existierenden Energieversorgungsunternehmen (EVU) und unter welchen Bedingungen ihre Arbeit `Sinn' macht. Nach einer Schlußbetrachtung über die Sachanalyse wird in Kapitel 6 nach pädagogischen Umsetzungsstrategien in der Schule gefragt.
2) Verhaltenstheorien
Wann verändert der Energieverbraucher bzw. Energieerzeuger sein Verhalten - wann fängt er an in energiesparende Produkte zu investieren ?
Die Förderung des Umweltbewußtseins stand dabei zunächst im Vordergrund. Diese Strategie dürfte mittlerweile als gescheitert angesehen werden, weil a) zuwenige nicht handeln, trotz ihres Wissens um die Bedrohung und b) weil uns immer mehr die Zeit davon rennt. Wie kann nun aber menschliches Verhalten im Sinne der Energieeinsparung mobilisiert werden ? Hier wird zunächst die ökonomische Verhaltenstheorie, welche nicht mit dem Homo-Ökonomicus zu verwechseln ist und das Nachfragegesetz interessant. Zuerst zum ersteren. Die ökonomische Verhaltenstheorie sagt in seinem Kern eigentlich was wir schon alle wissen, nämlich das die überwiegende Zahl der Menschen sich eigennützig verhält. Die Weckung des aktiven Umweltbewußtseins müßte also mit der Chance auf die Verbesserung der individuellen ökonomischen Verhältnisse in Verbindung gebracht werden.
Eine andere Strategie Energie einzusparen geht über deren Verteuerung. Wenn Energie relevant verteuert wird, sinkt gleichzeitig meistens die Nachfrage, weil a) bewußter dann damit umgegangen wird und b) weil es sich eher lohnt in energiesparende Geräte/ Maschinen zu investieren. Im gewerblichen und industriellen Bereich müßte man sich gleichzeitig über Nutzenmaximierungseffekte Gedanken machen, weil hier der `Homo- Oekonomicus' keine Seltenheit ist. D.h. hier, die Akteure suchen für sich die beste, meistens die profitabelste Lösung heraus. Dazu ein Beispiel : Mal angenommen ein Unternehmen überlegt Energie einzusparen, um dadurch mittelfristig Kosten zu senken. Gleichzeitig könnte es aber mit dem gleichen Investitionskapital kurzfristig durch Spekulationen, Aktiengeschäfte u.ä. ein vielfaches mehr erwirtschaften als durch Energieeinsparmaßnahmen. Zu überlegen wäre also hier, ob sich für einige Abnehmer die Energiepreise deutlich erhöhen müssen. Wie könnte jetzt eine teilweise Umsetzung der für viele zutreffenden Verhaltensweisen in Strukturen / Rahmenbedingungen umgesetzt werden, so daß Energieverbraucher, als auch Erzeuger verstärkt energieeinsparend investieren ? Im Rahmen dieser Hausarbeit wird sich dabei besonders mit dem Prinzip des Least-Cost Planing beschäftigt, was im Sinne der Motivierung zum Energiesparen eine große Rolle spielen kann. ( vgl. HENZELMANN, 1995, Kap.3)
3) Was ist Least-Cost Planing ?
Das Konzept des LCP ist in Deutschland seit Anfang der 90er Jahre einem breiteren öffentlichen Publikum bekannt. Teilweise wird anstatt LCP auch der Begriff ` Integrierte Ressourcenplanung verwendet. Direkt übersetzen könnte man LCP mit `Minimalkostenplanung'. Es ist im eigentlichen Sinne der Versuch Strom so billig wie möglich zu erzeugen, wobei sich billig auf den volkswirtschaftlichen Nutzen bezieht. Das war nicht immer so. Ursprünglich ist das LCP ein Konzept amerikanischer Energieversorgungsunternehmen (EVUs), das dort in den 70er Jahren entwickelt wurde.
Hintergrund war die Überlegung, wie man es vermeiden könnte für Spitzenlastzeiten extra Kraftwerke zu bauen. Die Spitzenlast bezeichnet solche Zeiträume, in denen am meisten Strom verbraucht wird, so z.B. an kalten Wintertagen zur Mittagszeit. Da Strom nicht speicherbar ist, hätte man für diese wenigen Tage im Jahr zusätzliche Kraftwerke bauen müssen, was wirtschaftlich wenig sinnvoll gewesen wäre. In der Folgezeit entwickelte sich das LCP als Problemlösung in diesem Zusammenhang und auf staatlichen Druck immer mehr und ist mittlerweile fester Bestandteil der amerikanischen Energieversorgung und -planung ( vgl HERPPICH, 1989, 56-61). Es wurde nämlich schon damals erkannt, daß das investieren in Einspartechniken preisgünstiger ist, als die vergleichbare Produktion von Strom. Schlagworte sind in diesem Zusammenhang das investieren in Einsparkraftwerken oder die Erzeugung von `Nega-Watts' (Amory Lovins).
In Deutschland wurde erst eine Studie veröffentlicht, die sich mit den unterschiedlichen `Erzeugungspreisen' von Nega- und Mega-Watts beschäftigt hat. Im Rahmen einer größeren Fallstudie begleiteten das Wuppertal- und Öko-Institut ( 1994) die LCP-Maßnahmen der Stadtwerke Hannover. Im Resultat konnte festgestellt werden, daß eine eingesparte KiloWattstunde (kWH) bei 3.5 Pf lag, also ca. 2.5mal so kleine wie `herkömmlich' produzierter Strom. Nicht eingerechnet dabei sind die externen Kosten von fossilen oder nuklearen Brennträgern. D.h. neben dem bezahlten Strompreis verursachen sie auch noch volkswirtschaftliche Schäden die im Verkaufspreis nicht enthalten sind, so z.B. zusätzliche Belastungen für das Gesundheitssystem oder die staatlich finanzierte Endlagerung in den nächsten paar 100.000 Jahren. Die Größenordnung wird zwischen 4 und 40 Pf die kWH geschätzt. (vgl. Enquete 1995, Wuppertal Institut 1994, 93).
So sind denn auch die volkswirtschaftlichen Potentiale die im LCP liegen von nicht kleiner Größe. HENNICKE vom Wuppertal Institut (Bü90/Grüne, 1995, 17) stellt in diesem Zusammenhang fest :
- theoretisch würden bei 45% eingesparter Energie bundesweit etwa jährlich 100 Mrd. DM frei
- 30% des Stromsparpotentials ist im Moment aber erst wirtschaftlich realisierbar (LCPFallstudie Hannover)
- Mit 10 MRD. DM Energiekosteneinsparung können Effizienzinvestitionen von 35 bis 50 Mrd. DM pro Jahr rentabel finanziert werden
- es könnten 3000 Dauerarbeitsplätze (netto) pro eingesparte 1 Mio. t SKE entstehen. Die Zahl für den Ersatz der Kernkraft dürfte noch höher sein, da dies ein wenig arbeitsintensiver Bereich ist. Auch sind 500.000 (Netto-) Arbeitsplätze möglich, bei Realisierung des technischen Potentials.
Anzumerken in diesem Zusammenhang ist, daß durch LCP-Programme im Haushaltsbereich nur etwa ein Drittel der möglichen Stromsparpotentiale erschließbar ist. Wesentlich größere und häufig kosteneffektivere Potentiale liegen in den Bereichen Kleinverbrauch, Gewerbe und Industrie sowie bei der Substitution von Strom vor.
Jetzt zum Stand der LCP-Projekte in Deutschland. Inzwischen gibt bzw. gab es 160 LCP- Maßnahmen, die von 53 verschiedenen EVUs durchgeführt wurden (VDEW 1994).
Eigentlich eine recht hohe Zahl, doch viele Projekte haben einen sehr kleinen Kapitalumfang und dienen mehr als Public Relation Aktion. Wirkliche Pilotversuche sind eher die Ausnahme, ganz im Gegensatz zu einigen europäischen Nachbarn. In den Niederlanden kann die LCP- Testphase mittlerweile als abgeschlossen betrachtet werden und man bereitet sich auf eine flächendeckende Förderung vor.
Wie sehen aber nun LCP-Maßnahmen aus? Was kann man sich konkret darunter vorstellen :
a) Energiesparlampen (ESL) - Konzepte :
- Beispiel Langenhagen : Beim Kauf einer ESL wird eine zweite verschenkt; 8.500 ESL wurden in drei Wochen verteilt.
- Beispiel Bremen : Gemeinsame Aktion von EVU, Herstellern und Händlern; Verteilung von 1 Mio Gutscheinen für einen Zuschuß von 5 DM pro ESL; 30.000 Gutscheine wurden eingelöst.
- Beispiel Saarbrücken : Direktinstallationsprogramm; Gutschein für eine kostenlose ESL wurde an jeden Haushalt verschickt in Verbindung mit einem Beratungsangebot vor Ort. Unterstützt wurde das Programm durch eine extra dafür entwickelte Marketing-Kampagne; 50.000 ESL wurden abgegeben. Geschätzte Einsparung : in 8 Jahren 20 Mio kWH.
b) Prämienprogramme für Haushaltsgeräte, Motoren, Brennkessel etc.
- bei diesen Programmen bekommt der Käufer von bestimmtem energiesparenden Produkten einen Zuschuß zum Kaufpreis. Es soll ein Anreiz gegeben werden in die meist teureren energiesparenden Produkte zu investieren.
c) Einspar- Contracting
Einspar- Contracting ist momentan wohl eines der attraktivsten Modelle, wenn es um das Energiesparen geht. EVUs oder andere Unternehmen bieten größeren Stromabnehmern an, für sie in Einspartechniken zu investieren, d.h. meistens das neue Motoren oder die Wärmeisolierung für den Verbraucher bezahlt werden. Der für beide Seiten attraktive Deal funktioniert dabei folgendermaßen : Der Stromabnehmer hat zwar jetzt eine niedrigere Energierechnung, aber er muß über einen vorher festgelegten Zeitraum die Differenz zwischen alter ( vor den Einsparinvestitionen ) und neuer Stromrechnung an den Investor zahlen, damit seine Investitionskosten + angestrebter Gewinn gedeckt wird. Nach der Abbezahlung hat der Abnehmer eine wesentlich geringere Stromrechnung. Gerade in diesem Bereich etablieren sich in den letzten Jahren immer mehr die sogenannten Energie- bzw. Contractingfirmen. Sie sind im Prinzip eine Mischung aus Bank, Einsparberatung und deren Durchführung.
Besonders interessant ist das Contracting-Modell auch im öffentlichen Bereich. Aufgrund leerer Kassen scheuen sich z.B. viele Kommunen in Energiespartechniken zu investieren. In diesem fall können Stadtwerke als kompetente und finanzstarke Partner in Vorleistung treten. Die geschieht auch in Bielefeld, wo die Stadtwerke den Austausch von Lampen oder die Installation von Heizungssystemen finanziell übernehmen. Der Finanzrahmen ist bei 1.25 bzw. 4.7 Mio DM geplant. Eine genauere Aufteilung befindet sich in dem Vertrag zwischen der Stadt Bielefeld und ihren Stadtwerken, der dieser Hausarbeit als Anlage beigefügt ist.
Eine Frage ist bis jetzt offen geblieben. Wenn es heute schon so attraktiv ist in energiesparende Techniken zu investieren, es möglich ist damit Geld zu verdienen - warum tun es nur die wenigsten ? Zum einem fehlen vielfach die finanziellen Anschaffungsmöglichkeiten, zum anderen besteht aber auch ein großes Wissens- und `Faulheits'defizit in dem Bereich. HENNICKE vom Wuppertal Institut (Bü'90/Grüne, 18) spricht in diesem Zusammenhang auch davon, daß der ` Homo Oekonomicus' des Energiesparens in Privathaushalten nie, im Kleinverbrauch selten und in der Industrie manchmal existiert.
Wenn es also mit der Energieeinsparung voran gehen soll brauchen wir Instanzen oder Akteure, die das nötige `Kleingeld' haben, um LCP-Maßnahmen durchzuführen und die durch geschicktes Marketing und Beratung größere Bevölkerungskreise für energiesparende Techniken interessieren können. Wer dies sein könnte und unter welchen Bedingungen wird Thema im nächsten Kapitel.
5) Wer soll LCP- Programme durchführen bzw. finanzieren und unter welchen Bedingungen
Wie bereits erwähnt bedarf es eines großen Investitionskapitals, um auf dem Nega Watt - Markt Erfolge zu erzielen. In der Beschaffung bzw. Organisierung dieses Kapitals sind verschiedene Wege denkbar :
- In England wurde extra dafür eine staatliche Agentur ( Energy Saving Trust ) gegründet, die ihr Finanzvolumen ( 400 Mio Pfund p.a. ) bezieht aus Mitteln des Staates und der Energiewirtschaft.
- Bildung lokaler Stromfonds. Die Hamburger Elektrizitätswerke (HEW) verwenden jährlich 1% ihres Gewinnes (ca. 20 Mio DM) für die Investition in LCP-Maßnahmen und der Förderung von regernativen Energieträgern.
- In Deutschland hätte die Möglichkeit bestanden nach dem Wegfall des Kohlepfennigs1 die sinkenden Strompreise (ca. 12.5%) durch eine Energiesteuer (teilweise) aufzufangen. Momentan sind aber (Öko-) Steuern, ohne gleichzeitige, sofortige Entlastung in anderen Bereichen schwer durchsetzbar.
Eine andere Möglichkeit bieten die vielen Energieversorgungsunternehemen (EVUs), die mehrheitlich der öffentlichen Hand gehören :
- EVUs sind sehr finanzstarke Institutionen, zum einen aufgrund ihrer großen Gewinnspannen in den letzten Jahren, zum anderen weil die großen Verbundunternehmen überhöhte Rückstellungen für die Entsorgung von AKWs angesammelt haben ( -> durch erhöhte Stromrechnungen in einer Größenordnung von 40 Mrd. DM)
- EVUs haben bereits einen hervorragenden Marktüberblick und kontinuierliche Kundenbeziehungen.
- Gegen die Interessen der EVUs werden Energiesparaktivitäten nur sehr schwer durchsetzbar sein.
- EVUs unterliegen in den nächsten Jahren einem Zwang zum Wandel aufgrund sich ändernder Bedingungen (siehe unten ).
Wie bereits angeklungen gibt es verschiedene Arten von EVUs, nämlich Verbund-, regionale und kommunale . Verbundunternehmen bedienen in Monopolstellung regionale und kommunale EVUs. Ihnen gehören die großen Kohle- und Atomkraftwerke und vielfach auch noch Teile des Leitungsnetzes. Regionale und kommunale EVUs sind für die Verteilung im ländlichen Bereich oder einzeln kommunal zuständig; auch in Monopolstellung. Vielfach erzeugen sie kleinere Mengen Strom selber mit Blockheizkraft- oder kleineren Gaswerken. So ist es auch nicht verwunderlich, daß z.B. die Frankfurter Stadtwerke 1994 einen Stromumsatz von 824 Mio DM verbuchte, während der Branchengrößte, die RWE im gleichen Zeitraum 19.32 Mrd. DM umsetzte ( SPIEGEL 1996 (1), 62-64).
Im folgenden sollen nun Probleme und Möglichkeiten bei a) kommunalen EVUs ( Stadtwerke) und b) Verbundunternehmen aufgezeigt werden, die im Rahmen von LCP von Bedeutung sind.
In Punkt c) wird dann versucht, die Resultate in einer Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zu formulieren.
a) Stadtwerke
Stadtwerke haben teilweise das Problem bei ihrem Investitionsvermögen, weil sie ihren Eigentümern, den Städten und Kommunen finanziell aus ihrer prekären Situation helfen müssen. In Bielefeld werden z.B. die Gewinne aus Strom dazu verwendet die anfallenden Verluste aus dem Öffentlichen-Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zu decken. Außerdem wird jedes Jahr ein einstelliger Millionenbetrag in den Stadthaushalt überwiesen. Städte sind deswegen auf der einen Seite nicht sonderlich daran interessiert LCP-Programme aufzulegen, weil dies kurzfristig weniger Geld zum Ausgeben bedeutet. Mittelfristig besteht aber durchaus der Wunsch nach niedrigeren Energiekosten, auch im Zusammenhang mit einem gestiegenen Umweltbewußtsein.
Gleichzeitig unterliegen die Stadtwerke auch einem Zwang zum Wandel. Sie werden mit entgangenen Erlösen konfrontiert, weil immer weitere Teile der Bevölkerung die Vorteile von energiesparenden Techniken für sich in Anspruch nimmt und Energie/ Contracting - Agenturen ein immer offensiveres Marketing betreiben. Für die Stadtwerke besteht die Möglichkeit, sich vom Energieversorger zum Energiedienstleister zu entwickeln. Einnahmeeinbußen durch geringeren Stromabsatz wird kompensiert durch verstärkte Dienstleistungsangebote, z.B. im Bereich der Beratung und Installation. Dies ist aber nur ein Teil der Lösung. Mittelfristig muß es auch zu einer gesetzlichen Änderung des Energiesektors kommen, doch dazu später mehr.
Fassen wir zusammen : Stadtwerke können eine wichtige Rolle spielen beim sozialen Wandel und der Suche nach neuen Wohlstandsmodellen. Sie sind als kommunale Einrichtungen dem Gemeinwohl verpflichtet und deswegen offen für eine Zukunft mit LCP. Anstrengungen lassen sich erkennen, nicht zuletzt auch auf der Gründung der ASEW ( der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Versorgungsunternehmen zur Förderung rationeller, sparsamer und umweltschonender Energieverwendung und rationeller Wasserverwendung ), wo inzwischen 200 kommunale Versorgungsunternehmen ihre Erfahrungen bündeln und austauschen.
Nicht als so engagiert kann man die Rolle der großen Verbundunternehmen interpretieren, die z.T. sehr kämpferisch in bestehenden Positionen verharren.
b) Verbundunternehmen
In der Bundesrepublik gibt es 9 große Verbundunternehmen, wie nämlich RWE, VEBA, Bayernwerke, Preussen Elektra, Viag, Schleswag oder Bewag. Wie bereits erwähnt bedienen sie fest abgesteckte Gebiete monopolartig mit Energie. Für sie gilt das gleiche, wie für die Stadtwerke : Wenn sie in LCP-Programme investieren, ginge der Stromabsatz herunter und somit ihre Gewinne. Hinzukommt, daß die Kosten für LCP-Maßnahmen nicht auf den Strompreis umgerechnet werden dürfen, bzw. nur teilweise mit Sondergenehmigungen. Das kommt daher, daß die Stromerzeuger ihre Preise nicht selbstständig festlegen können, sondern dies durch eine staatliche Energieaufsicht geschieht, die sich auf den Grundlagen des Energiewirtschaftsgesetzes von 1935 bewegt.
Ein weiterer Grund, warum sich die Verbundunternehmen nicht als Vorreiter in Sachen Energieeinsparung definieren wollen ist ihr Engagement in anderen Geschäftszweigen. Dies gilt besonders für den Telekommunikationsmarkt, wo in den nächsten Jahren Milliardeninvestitionen von Nöten sind, wenn man etwas von dem sehr gewinnträchtigen `Kuchen' abhaben möchte. Das Investitionskapital ist auch aufgrund der schon erfolgten Anfangsinvestitionen in diesem Bereich stark gebunden. Ein Umschwenken würde große Verluste bedeuten.
Diese Erschließung neuer Geschäftsfelder2 hängt mit dem bereits erwähnten Zwang zum Wandel zusammen - und gleichzeitig dem nötigen Kapital, resultierend aus der gewinnträchtigen Monopolstellung.
Für die großen Verbundunternehmen sieht die Zukunft noch weniger erfreulich aus, als für die der Stadtwerke. Ausschlaggebend ist hier ihre Rolle als primärer Erzeuger von Energie, vorwiegend mit fossilen und nuklearen Brennträgern. Aktiver Umwelt- und Ressourcenschutz sowie steigende Preise für ÖL, Kohle und Gas werden ihre Kraftwerksgrundlagen in 2-3 Jahrzehnten unwirtschaftlich machen. Schon heute ist die Stromerzeugung in dezentralen, kleinen Blockheizkraftwerken genauso billig und dazu noch umweltfreundlicher. Der immer stärkere Ausbau von Fern- und Nahwärme, die Kraftwärmekopplung sowie die bereits erwähnten Energieagenturen führen zu weiteren großen Umsatzeinbußen.
Mittelfristig ist die Verteidigung der momentanen Stellung der Verbundunternehmen noch möglich, langfristig aber ruinös, aufgrund entgangener Erlöse. Der Nega Watt- Markt stellt die großen EVUs vor die Wahl, ob sie teilnehmen oder untergehen wollen, bzw. auf andere Geschäftsfelder wechseln. Damit nicht letztere Variante eintritt und somit viel kostbare Zeit beim Energiesparen verloren geht, ist der Gesetzgeber gefragt bei der Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes.
c) Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) aus dem Jahre 1935 diente einst zur Kriegsvorbereitung und sollte die Versorgung der Industrie mit Energie sicherstellen. Wie bereits erwähnt bietet es keinen Anreiz für die EVUs in Energieeinsparung zu investieren. Der Grund hierfür liegt im Verfahren der Energiepreisbestimmung. Die von der Energieaufsichtsbehörde zu genehmigenden Energiepreise basieren auf der im voraus geschätzten Absatzmenge von Energie. Investiert ein EVU zusätzlich in Einsparprogramme, führt dies erst einmal zu erhöhten Kosten, ohne das diese auf die Preise umgelegt werden können. Dadurch sinkt der Gewinn.
Es sind momentan mehrere Optionen im Gespräch wie das EnWG in Bezug auf Energieeinsparung verändert werden könnte. Hier soll die, nach Meinung des Verfassers, erfolgsversprechenste Alternative dargestellt werden ( vgl. HENNICKE, 1991, Kap 7) :
Reformschritt 1: Energieverteilung von Energieerzeugung trennen
- der entscheidene Reformschritt dafür ist, die Monopolstruktur zu deregulieren : Unternehmen, die die Energieverteilung an die Endverbraucher übernehmen, dürfen nicht gleichzeitig in der Energieerzeugung tätig sein. Das wird dazu führen, daß das Verteilungsunternehmen den Strom selbst kaufen muß. Nur dann stellt der vom Netz abgenommene Strom für den Verteiler Kosten dar, die er zu vermeiden sucht.
Reformschritt 2: Kosten f ü r Energieeinsparung auf die Energierechnung umlegen
- Die Kosten für den Kauf von Energie kann das Verteilerunternehmen minimieren, ohne Umsatz einzubüßen, wenn es die Maßnahmen zur Energieeinsparung auf die Energierechnung der Kunden umrechnen kann, also die Dienstleistung (z.B. warme Wohnung) als Kostenmix aus Energiesparmaßnahmen und benötigter Restenergie und nicht ausschließlich die Energie zur Erwärmung der Wohnung ohne gleichzeitige Energiesparmaßnahmen verkauft. Die Kunden bezahlen also dann mit ihrer Energierechnung einen Mix aus Energieangebot und Energiesparmaßnahmen wie Energiesparlampen, Prämien für Haushaltsgeräte mit niedrigem
Energieverbrauch, Wärmedämmung etc.. Das Energieversorgungsunternehmen wandelt sich zu einem Dienstleistungsunternehmen : Es stellt die Dienstleistung (warme Wohnung) in Rechnung und wird dabei ein wirtschaftliches Interesse haben, jede Maßname zur Energieeinsparung durchzuführen, die sich rechnet, d.h. billiger ist als der ausschließliche Verbrauch von Energie für dieselbe Dienstleistung.
Auch zu überlegen wäre, als Anreiz nicht die Kosten für die LCP-Maßnahmen auf die Stromrechnungen umzurechnen, sondern den höheren, wenn `herkömmliche' Mega Watts produziert worden wären.
Mit den beschriebenen Reformschritten wären die strategischen Weichen für den Durchbruch des Prinzips des Least-Cost Planing gestellt. Der Marktmechanismus kann gezielt zur Erschließung von Effizienzpotentialen mit betriebswirtschaftlichen Gewinn bei den Stadtwerken genutzt werden.
6) Schlußbetrachtung
In der Einleitung wurde folgende Ausgangsfragestellung formuliert : Wie müssen energiesparende Strukturen im Energiesektor aussehen, damit sie erfolgreich sind und somit die Kernkraft `überflüssig' machen können. Was bleibt als Resumee zu ziehen ? Bei einem kurzfristigen Ausstiegsszenario innerhalb von 2-4 Jahren können energiesparende Techniken nur eine sehr kleine Rolle spielen und es müßte auf fossile Brenstoffe ausgewichen werden ( ALTNER, 1994,65 ). In einer mittelfristig, d.h. bis zu 10 Jahren angelegten Konzeption könnte man die Einsparpotentiale von ca. 30% an Primärenergie gut ausschöpfen, was eine echte Alternative bedeutet. Doch falls es dazu kommen sollte bedarf es einer ganzen Reihe von Voraussetzungen. Ordnungspolitische Eingriffe durch Verbote o.ä. dürfen als schwer durchsetzbar eingestuft werden. Eine andere Alternative existiert aber, nämlich die Energieeinsparung zum Gewinnprinzip zu machen. Mit Energieeinsparung also Geld verdienen können und gleichzeitig die Umwelt schonen - keine schlechte Vorstellung. Der Marktmechanismus des Gewinnprinzips, der ja bekanntlich eine große Dynamik entfachen kann, sollte für alle bzw. möglichst viele gelten, also Verbraucher und Erzeuger/Verteiler. Das Least-Cost Planing mit zusätzlichen Aktivitäten der EVUs ist hierbei der richtige Weg, diese Voraussetzungen zu erfüllen.
Dem Verbraucher wird seitens der Angebotsseite finanziell bei dem Erwerb von energiesparenden Produkten unter die `Arme gegriffen'. Dieses führt zu sinkenden Stromrechnungen, die für den Verbraucher attraktiv sind. Auf der Erzeugerseite ist dies nicht so einfach, weil weniger Stromverbrauch bisher immer niedrigere Gewinne bedeutet hat..
Damit die EVUs, die am besten geeignet sind LCP-Maßnahmen durchzuführen, nicht zu den Verlierern gehören, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein :
- EVUs müssen sich von der reinen Energieversorgung hin zu Energiedienstleistungs- unternehmen (EDUs) entwickeln. Verluste durch weniger Stromabsatz werden kompensiert durch Beratung und Installation von energiesparenden Techniken. EVUs sollten gezielt neue Geschäftsfelder erschließen
- Durch die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes von 1935, findet eine Trennung von Energieerzeugung und Endverteiler statt. Die Endverteiler ( hauptsächlich kommunale Stadtwerke) sind daran interessiert möglichst wenig `herkömmlichen' Strom zu kaufen, wenn sie billiger Strom einsparen können. Besonders interessant wird es unter der Konstellation, wenn sie nicht den LCP-Preis in den Strompreis einrechnen, sondern den teureren Preis, als hätten sie Strom produziert.
`Leider' kann die ursprünglich ausgestellte Maxime, daß jeder Beteiligte an der Energieeinsparung verdienen sollte, nicht erfüllt werden. Die großen Verbundunternehmen, die hauptsächlich in die Stromproduktion mit Großkraftanlagen involviert sind, werden Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, aufgrund des abgesackten Stromverbrauchs3. Doch auch für sie gilt die Möglichkeit in anderen Geschäftsfeldern im Energiesektor sich zu etablieren.
Der eigentliche Gewinner im Rahmen des LCP wurde bisher immer nur am Rande erwähnt, nämlich die Volkswirtschaft bzw. das Gemeinwohl. Der Einsatz energiesparender Produkte ist weitaus arbeitsintensiver als die Betreibung von Kernkraftwerken. Viele kleine und mittelständische Unternehmen hätten eine Chance zur Gründung, wenn mit dem LCP ernst gemacht würde. Auch gebe es weniger anfallendes radioaktives Material, was die Endlagerungskosten für die kommenden Generationen senken würde. Daß das LCP ein intelligenter Steuerungsmechanismus für gesellschaftliche Entwicklung darstellt, steht außer Frage. Ob das Potential jedoch für den Ausstieg aus der Kernkraft genutzt werden sollte ist fragwürdig. Meiner Meinung nach existieren in dieser Republik drängendere Probleme, wie z.B. der Treibhauseffekt, für die der LCP-Einsatz sinnvoller wäre.
Leider bin ich zu spät auf die anstehende Liberalisierung im Energiesektor gestoßen. Die monopolartigen Strukturen in Deutschland lassen sich nicht mit dem EG- Binnenmarkt vereinbaren und müssen deswegen in den nächsten Jahren geändert werden. Dabei dürfte es zu einem sinken der Strompreise kommen, wegen des erhöhten Wettbewerbes. Nega Watts bleiben aber auch dann eine preiswerte Alternative zu Mega Watts.
Auch nicht eingegangen wurde aus Zeitgründen auf die mögliche Rolle von Ökosteuern im Zusammenhang mit dem LCP.
Zum Schluß soll noch ein positiver Ausblick in die Zukunft formuliert werden : Man kann Verbraucher über teure Marketing- Strategien oder höhere Energiepreise dazu bringen in energiesparende Produkte zu investieren - man kann aber auch ein Klima des Aufbruchs und der Veränderung schaffen. Dieses passiert momentan in England (auf anderem Terrain), wo der neue Premier Tony Blair die Vision einer Insel belebt, die den Problemen der Zukunft souverän gegenüber steht.
Es gilt allgemein die Menschen aus ihrer politischen Lethargie zu reisen und sie für ein Ziel zu begeistern zu dem sie beitragen können - eine moderne Gesellschaft die ihre Ressourcen und ihre Umwelt schont, also höhere Lebensqualität bietet und wo gleichzeitig genügend (befriedigende) Arbeit vorhanden ist.
Umweltschutz muß endlich in Deutschland zur `Chefsache' gemacht werden, wobei LCP nur eines von vielen Reformprojekten darstellt. In dieser Euphoriephase der gesellschaftlichen Veränderung treten die gewandelten EVUs / andere Marktakteure als massive Anstoßer von LCP- Programmen auf , die auf eine interessierte Verbraucherschaft stoßen, weil ein `Mitmachklima' und die eigene Gewinnerwartung existieren.
7) Literaturverzeichnis
ALTNER/ DÜRR: Zukünftige Energiepolitik, Bonn 1995
Bündnis `90/ Die Grünen: Neue Wege im Klimaschutz am Beispiel Least-Cost Planing, Bonn 1995
Enquete- Kommission ,, Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre": Energie und Klima; 10 Bände, Bonn 1990
Enquete- Kommission ,, Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages: Mehr Zukunft für die Erde, Bonn 1995
HENNICKE, Peter: Den Wettbewerb im Energiesektor planen, Berlin 1991
HENZELMANN, Thorsten : Contracting : Ein effizientes Instrument auf dem Weg zum Least-Cost Planing, Kaiserslautern 1995
HERPPICH, Wolfram: Least-Cost Planing in den USA, München 1989
LEPRICH, Uwe: Least-Cost Planing als Regulierungskonzept, Freiburg 1994
Wuppertal Institut/ Öko-Institut: Endbericht Least-Cost Planing im Auftrag der ,,Gruppe Energie 2000", Wuppertal 1994
[...]
1 Aufschlag auf den Strompreis, um nicht wettbewerbsfähige deutsche Steinkohle zu subventionieren.
2 RWE kaufte sich in den letzten 10 Jahren bei annähernd 300 Firmen ein, hauptsächlich im Entsorgungs-, Wasser- und Energiebereich ( SPIEGEL 1996 (1), 62-64 )
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieser Ausarbeitung über Least-Cost Planning (LCP)?
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Frage, wie energiesparende Strukturen im Energiesektor aussehen müssen, damit sie erfolgreich sind und somit die Atomkraft überflüssig machen können. Sie untersucht verschiedene Verhaltensweisen von Energieverbrauchern und -erzeugern, führt in das Konzept des Least-Cost Planning (LCP) ein, analysiert mögliche Akteure, die LCP-Maßnahmen durchführen oder finanzieren können, und schlägt eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes vor.
Was ist Least-Cost Planning (LCP)?
Least-Cost Planning (LCP), auch als Integrierte Ressourcenplanung bekannt, ist der Versuch, Strom so billig wie möglich zu erzeugen, wobei sich "billig" auf den volkswirtschaftlichen Nutzen bezieht. Es geht darum, die kosteneffektivsten Wege zur Deckung des Energiebedarfs zu finden, einschließlich Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare Energien.
Wer soll LCP-Programme durchführen oder finanzieren?
Die Ausarbeitung diskutiert verschiedene Akteure, die LCP-Programme durchführen oder finanzieren könnten, darunter:
- Energieversorgungsunternehmen (EVUs), insbesondere Stadtwerke
- Staatliche Agenturen wie der Energy Saving Trust in England
- Lokale Stromfonds
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit LCP erfolgreich ist?
Für einen erfolgreichen Einsatz von LCP sind laut der Ausarbeitung folgende Bedingungen erforderlich:
- Eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, um Anreize für EVUs zur Investition in Energieeffizienz zu schaffen
- Eine Trennung von Energieerzeugung und Energieverteilung
- Die Möglichkeit, die Kosten für Energieeinsparung auf die Energierechnung umzulegen
- Eine Entwicklung der EVUs von reinen Energieversorgern zu Energiedienstleistungsunternehmen
Welche Rolle spielen Stadtwerke bei der Umsetzung von LCP?
Stadtwerke können eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von LCP spielen, da sie als kommunale Einrichtungen dem Gemeinwohl verpflichtet sind und offen für eine Zukunft mit LCP sind. Sie können sich vom Energieversorger zum Energiedienstleister entwickeln und Einnahmeeinbußen durch geringeren Stromabsatz durch verstärkte Dienstleistungsangebote kompensieren.
Warum sind große Verbundunternehmen nicht so engagiert in Sachen Energieeinsparung?
Große Verbundunternehmen zögern oft, in Energieeffizienz zu investieren, da dies ihren Stromabsatz und somit ihre Gewinne reduzieren würde. Darüber hinaus sind sie oft in andere Geschäftszweige wie den Telekommunikationsmarkt involviert, in denen sie ebenfalls Investitionen tätigen müssen.
Welche konkreten LCP-Maßnahmen gibt es?
Die Ausarbeitung nennt verschiedene konkrete LCP-Maßnahmen, darunter:
- Energiesparlampen (ESL) - Konzepte
- Prämienprogramme für Haushaltsgeräte, Motoren, Brennkessel etc.
- Einspar-Contracting
Was ist Einspar-Contracting?
Einspar-Contracting ist ein Modell, bei dem EVUs oder andere Unternehmen größeren Stromabnehmern anbieten, für sie in Einspartechniken zu investieren. Der Stromabnehmer hat zwar jetzt eine niedrigere Energierechnung, aber er muss über einen vorher festgelegten Zeitraum die Differenz zwischen alter und neuer Stromrechnung an den Investor zahlen, damit seine Investitionskosten + angestrebter Gewinn gedeckt werden.
Welche Reformschritte sind im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) notwendig?
Laut der Ausarbeitung sind folgende Reformschritte im EnWG notwendig:
- Energieverteilung von Energieerzeugung trennen
- Kosten für Energieeinsparung auf die Energierechnung umlegen
Was ist die Schlussfolgerung der Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung kommt zu dem Schluss, dass energiesparende Techniken mittelfristig eine echte Alternative zur Kernkraft darstellen können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört insbesondere die Umwandlung der Energieeinsparung in ein Gewinnprinzip, bei dem sowohl Verbraucher als auch Erzeuger/Verteiler profitieren.
- Citation du texte
- Daniel Holstein (Auteur), 1999, Den Ausstieg aus der Kernkraft ermöglichen, durch den Einsatz von energiesparenden Techniken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95391