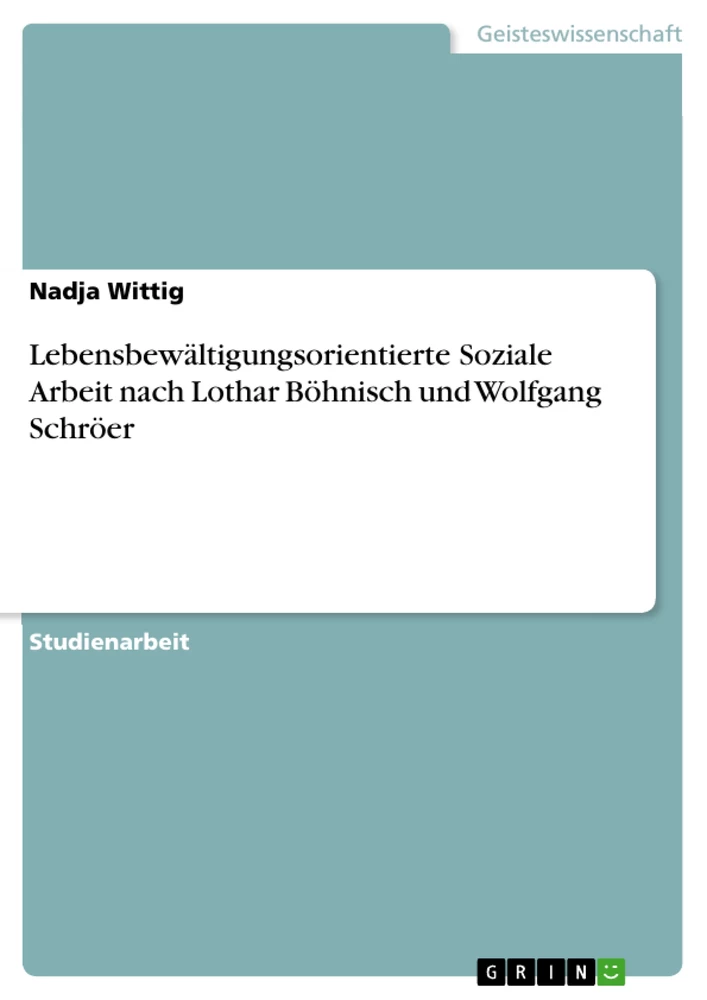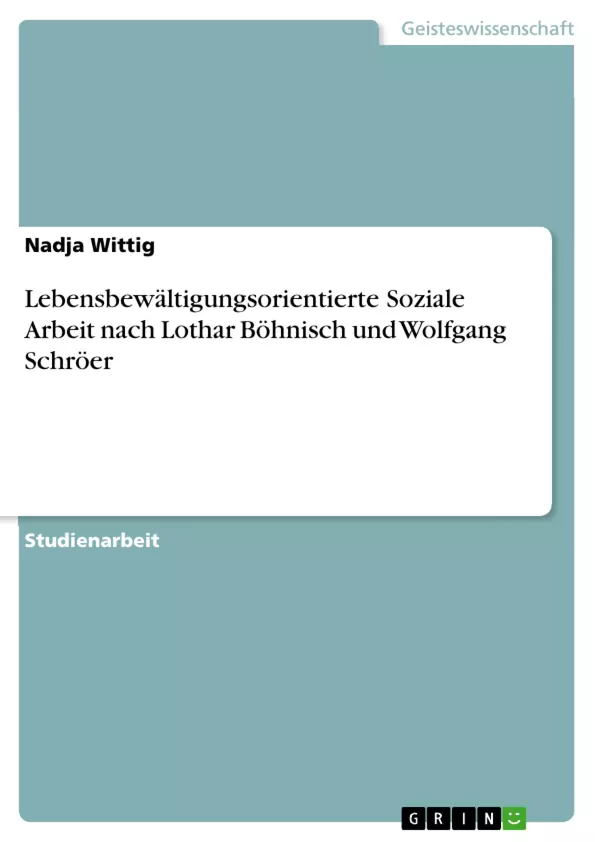Mit dieser Hausarbeit soll zunächst der historisch-gesellschaftliche Hintergrund des Ansatzes der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit beleuchtet werden. Hierbei sollen die durch die Arbeitsteilung im Industriekapitalismus bedingte Entstehung von sozialstrukturellen und individuellen Problemen sowie das Paradigma von Freisetzung und Bewältigung im Fokus stehen.
Anschließend werden die theoretischen Grundlagen des sozialpädagogischen Konzepts Lebensbewältigung dargestellt. Dabei wird neben allgemeinen Grundzügen auch auf das Drei-Ebenen-Modell und die analytische Abgrenzung der verschiedenen Stufen eingegangen. In diesem Zusammenhang sollen die subjektive Handlungsfähigkeit von Adressat*innen Sozialer Arbeit und die damit einhergehenden Herausforderungen beschrieben werden.
Aus der Perspektive der Lebensbewältigung lassen sich mehrere Dimensionen des Gegenstandsverständnisses Sozialer Arbeit festmachen, welche im Verlauf dieser Ausarbeitung charakterisiert werden sollen. Konkret betrachtet werden dabei die Kategorien Bewältigungstatsache, Zuständigkeit der Sozialen Arbeit sowie Lebensbewältigung in der zweiten Moderne.
Anschließend werden übergreifende Implikationen für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der historisch-gesellschaftliche Hintergrund des Ansatzes
- 3. Erläuterung der theoretischen Grundlagen
- 3.1 Allgemeine Grundlagen
- 3.2 Die personal-psychodynamische Ebene
- 3.3 Die relational-intermediäre Ebene
- 3.4 Die sozialstrukturelle und sozialpolitische Ebene
- 4. Der Gegenstand der Sozialen Arbeit aus der Perspektive der Lebensbewältigung
- 5. Implikationen für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Ansatz der lebensbewältigungsorientierten Sozialen Arbeit nach Böhnisch und Schröer. Ziel ist die Darstellung der theoretischen Grundlagen, des Beitrags zur Gegenstandsklärung und der Implikationen für methodisches Handeln. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Lebensbewältigung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und individueller Herausforderungen.
- Historisch-gesellschaftlicher Hintergrund der Lebensbewältigung
- Theoretische Grundlagen und das Drei-Ebenen-Modell
- Subjektive Handlungsfähigkeit und Bewältigungsstrategien
- Gegenstandsverständnis der Sozialen Arbeit aus der Perspektive der Lebensbewältigung
- Methodische Implikationen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen. Sie gibt einen Überblick über die zu behandelnden Themen: den historisch-gesellschaftlichen Kontext, die theoretischen Grundlagen der lebensbewältigungsorientierten Sozialen Arbeit, das Verständnis des Gegenstands Sozialer Arbeit aus dieser Perspektive und die daraus resultierenden methodischen Implikationen.
2. Der historisch-gesellschaftliche Hintergrund des Ansatzes: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des lebensbewältigungsorientierten Ansatzes im Kontext der Moderne und Postmoderne. Es beschreibt den Wandel von stabilen, linear verlaufenden Lebensläufen hin zu instabileren Identitäten und pluralisierten Lebensformen. Die zunehmende Freisetzung des Individuums in modernen Gesellschaften wird als Ursache für neue Bewältigungsprobleme dargestellt, auf die die Soziale Arbeit reagieren muss. Der historische Wandel von repressiven zu pädagogischen Ansätzen in der Sozialen Arbeit wird ebenfalls thematisiert, ebenso wie das Paradigma von Freisetzung und Bewältigung.
3. Erläuterung der theoretischen Grundlagen: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen des Konzepts der Lebensbewältigung dar. Es beschreibt die verschiedenen Ebenen des Drei-Ebenen-Modells (personal-psychodynamisch, relational-intermediär, sozialstrukturell und sozialpolitisch) und erläutert den Begriff der subjektiven Handlungsfähigkeit. Dabei werden die verschiedenen Formen der Handlungsfähigkeit (regressiv, einfach, erweitert) differenziert und deren Relevanz für sozialpädagogisches Handeln herausgestellt. Der Bezug zum Coping-Konzept aus der Stressforschung wird hergestellt, und es werden zentrale Bewältigungsschwierigkeiten wie Selbstwertverlust, soziale Orientierungslosigkeit und fehlender sozialer Rückhalt identifiziert.
Schlüsselwörter
Lebensbewältigung, Soziale Arbeit, Handlungsfähigkeit, Moderne, Postmoderne, Drei-Ebenen-Modell, Böhnisch, Schröer, Coping, sozialpädagogisches Handeln, Bewältigungsschwierigkeiten, sozialstrukturelle Probleme.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Lebensbewältigungsorientierte Soziale Arbeit nach Böhnisch und Schröer
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Ansatz der lebensbewältigungsorientierten Sozialen Arbeit nach Böhnisch und Schröer. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, den Beitrag zur Gegenstandsklärung der Sozialen Arbeit und die Implikationen für methodisches Handeln. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Lebensbewältigung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und individueller Herausforderungen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, historisch-gesellschaftlicher Hintergrund des Ansatzes, Erläuterung der theoretischen Grundlagen (inkl. des Drei-Ebenen-Modells), der Gegenstand der Sozialen Arbeit aus der Perspektive der Lebensbewältigung, Implikationen für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit und Fazit.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die theoretischen Grundlagen des Konzepts der Lebensbewältigung, insbesondere das Drei-Ebenen-Modell (personal-psychodynamisch, relational-intermediär, sozialstrukturell und sozialpolitisch). Es werden der Begriff der subjektiven Handlungsfähigkeit und verschiedene Formen der Handlungsfähigkeit (regressiv, einfach, erweitert) differenziert. Der Bezug zum Coping-Konzept aus der Stressforschung wird hergestellt, und zentrale Bewältigungsschwierigkeiten wie Selbstwertverlust, soziale Orientierungslosigkeit und fehlender sozialer Rückhalt werden identifiziert.
Welchen Stellenwert hat der historisch-gesellschaftliche Kontext?
Die Hausarbeit beleuchtet die Entstehung des lebensbewältigungsorientierten Ansatzes im Kontext der Moderne und Postmoderne. Der Wandel von stabilen zu instabileren Lebensläufen, die zunehmende Freisetzung des Individuums und der historische Wandel von repressiven zu pädagogischen Ansätzen in der Sozialen Arbeit werden als relevante Faktoren betrachtet.
Welche methodischen Implikationen werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht die Implikationen des lebensbewältigungsorientierten Ansatzes für das methodische Handeln in der Sozialen Arbeit. Die konkreten Auswirkungen der theoretischen Grundlagen auf die Praxis werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Hausarbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Lebensbewältigung, Soziale Arbeit, Handlungsfähigkeit, Moderne, Postmoderne, Drei-Ebenen-Modell, Böhnisch, Schröer, Coping, sozialpädagogisches Handeln, Bewältigungsschwierigkeiten, sozialstrukturelle Probleme.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist die Darstellung der theoretischen Grundlagen der lebensbewältigungsorientierten Sozialen Arbeit nach Böhnisch und Schröer, deren Beitrag zur Gegenstandsklärung und der daraus resultierenden Implikationen für das methodische Handeln.
Wie wird das Verständnis von Lebensbewältigung in der Arbeit dargestellt?
Die Hausarbeit betrachtet Lebensbewältigung im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und individueller Herausforderungen. Sie analysiert subjektive Handlungsfähigkeit und Bewältigungsstrategien im Angesicht dieser Herausforderungen.
- Citar trabajo
- Nadja Wittig (Autor), 2020, Lebensbewältigungsorientierte Soziale Arbeit nach Lothar Böhnisch und Wolfgang Schröer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/955819